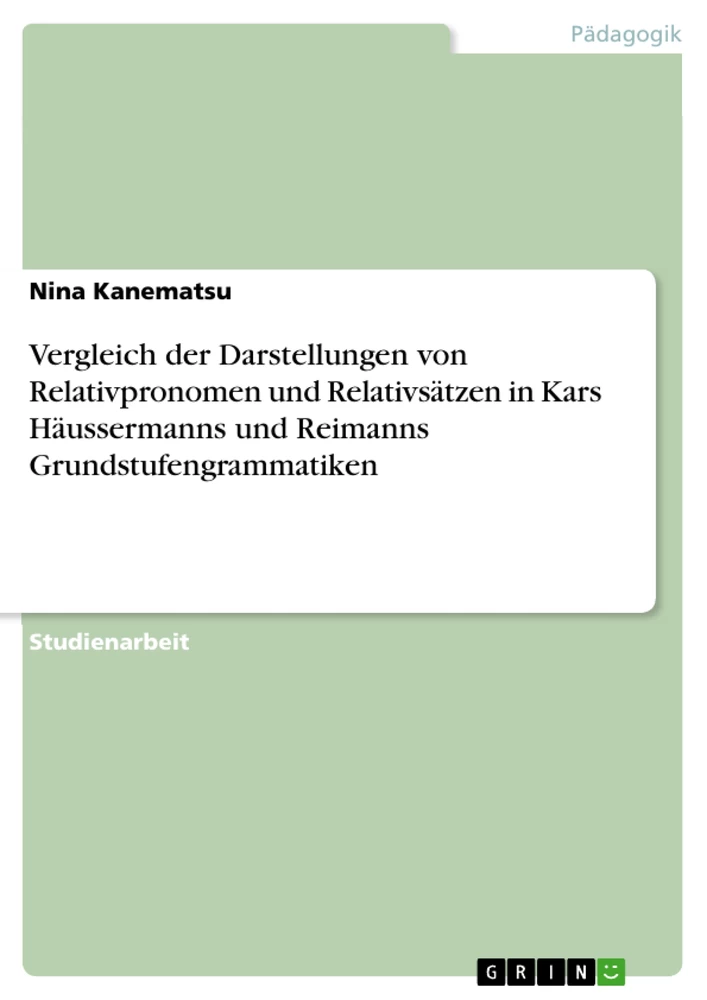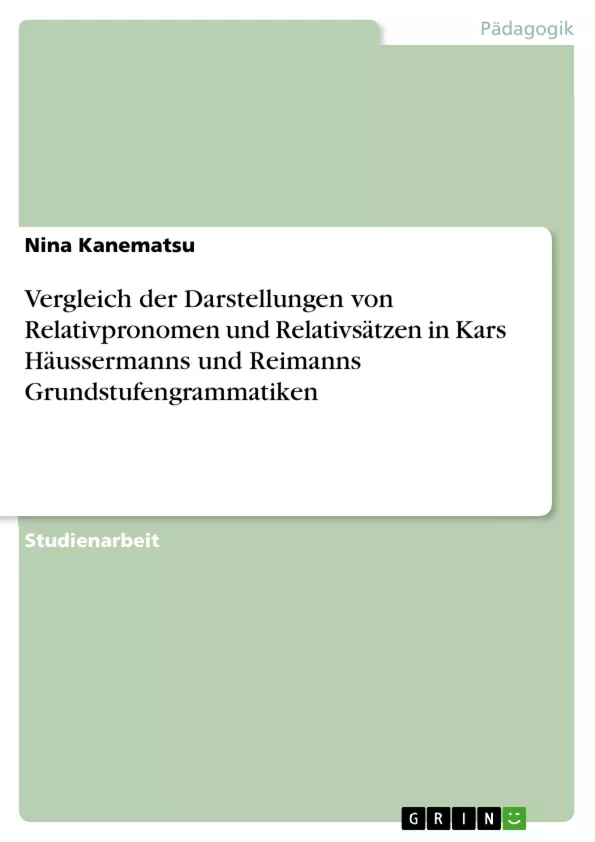Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Grammatiken für Deutsch - die Liste reicht von linguistischen Grammatiken für die Forschung über Grammatiken, die sich explizit an Lehrende wenden, bis hin zu Lernergrammatiken, deren Ziel es ist, Deutschlernenden die Grammatikregeln so einfach wie möglich zu vermitteln und autonomes Lernen zu fördern. Lehrende und auch Lernende müssen sich daher genau überlegen, welche Grammatik sie für den Unterricht bzw. das Selbststudium nutzen.
Vor diesem Hintergrund sollen in dieser Arbeit zwei Lernergrammatiken, Jürgen Kars/Ulrich Häussermanns „Grundgrammatik Deutsch“ (1997) und Monika Reimanns „Grundgrammatik“ (2010), miteinander verglichen werden. Dabei wird in dieser Arbeit ausschließlich auf die Darstellung von Relativsätzen und Relativpronomen in den beiden Werken Bezug genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relativsätze und Relativpronomen
- Zur Konzeption der behandelten Grammatiken
- Die Beschreibung von Relativsätzen und Relativpronomen in Monika Reimanns "Grundstufen-Grammatik" und Kars/Häussermanns "Grundgrammatik Deutsch" - ein Vergleich
- Monika Reimann: "Grundstufen-Grammatik" (2010)
- Kars/Häussermanns "Grundgrammatik Deutsch" (1997)
- Bewertung der beiden Grammatiken
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und vergleicht zwei gängige Lernergrammatiken für Deutsch als Fremdsprache: die "Grundstufen-Grammatik" von Monika Reimann und die "Grundgrammatik Deutsch" von Kars/Häussermann. Im Fokus stehen die Darstellungen von Relativsätzen und Relativpronomen in beiden Werken. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Konzepte, Methoden und Schwerpunkte der beiden Grammatiken aufzuzeigen und ihre Eignung für den Deutschunterricht zu beurteilen.
- Darstellung von Relativsätzen und Relativpronomen in beiden Grammatiken
- Vergleich der Konzepte und Methoden zur Erklärung von Relativsätzen
- Analyse der didaktischen Eignung der beiden Grammatiken
- Bewertung der Stärken und Schwächen beider Grammatiken im Hinblick auf die Vermittlung von Relativsätzen
- Bedeutung der visuellen Gestaltung und des didaktischen Ansatzes in den Grammatiken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Problematik der Auswahl geeigneter Grammatiken für den Deutschunterricht. Kapitel 2 führt in das Thema Relativsätze und Relativpronomen ein und erläutert ihre grammatischen Eigenschaften und Funktionen. Kapitel 3 beleuchtet die Konzeption der beiden untersuchten Grammatiken, "Grundstufen-Grammatik" und "Grundgrammatik Deutsch", in Bezug auf ihre Zielgruppe, ihren didaktischen Ansatz und ihre Schwerpunkte. Kapitel 4 bietet eine detaillierte Gegenüberstellung der Darstellungen von Relativsätzen und Relativpronomen in beiden Grammatiken, wobei die jeweiligen Stärken und Schwächen analysiert werden.
Schlüsselwörter
Relativsätze, Relativpronomen, Lernergrammatik, Deutsch als Fremdsprache, "Grundstufen-Grammatik", Monika Reimann, "Grundgrammatik Deutsch", Kars/Häussermann, Vergleich, didaktische Eignung, Konzeption, Dependenzmodell, Grammatikbeschreibung, Visualisierung, kommunikative Grammatik, autonome Lernen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen linguistischen Grammatiken und Lernergrammatiken?
Linguistische Grammatiken dienen der Forschung, während Lernergrammatiken Regeln vereinfachen und autonomes Lernen für Deutschlernende fördern sollen.
Welche Grammatiken werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden die 'Grundgrammatik Deutsch' von Kars/Häussermann (1997) und die 'Grundstufen-Grammatik' von Monika Reimann (2010).
Wie werden Relativsätze in Lernergrammatiken dargestellt?
Die Darstellung variiert zwischen rein formalen Erklärungen und didaktischen Ansätzen, die Visualisierungen und das Dependenzmodell nutzen, um Funktionen von Relativpronomen zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt die Visualisierung beim Grammatiklernen?
Gute Visualisierungen helfen Lernenden, komplexe Strukturen wie Satzbau und Deklination von Pronomen schneller zu erfassen und sich einzuprägen.
Was ist ein kommunikativer Grammatikansatz?
Ein Ansatz, der Grammatik nicht als isoliertes Regelsystem betrachtet, sondern deren Anwendung in realen Gesprächssituationen und Texten in den Vordergrund stellt.
- Arbeit zitieren
- Nina Kanematsu (Autor:in), 2018, Vergleich der Darstellungen von Relativpronomen und Relativsätzen in Kars Häussermanns und Reimanns Grundstufengrammatiken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426912