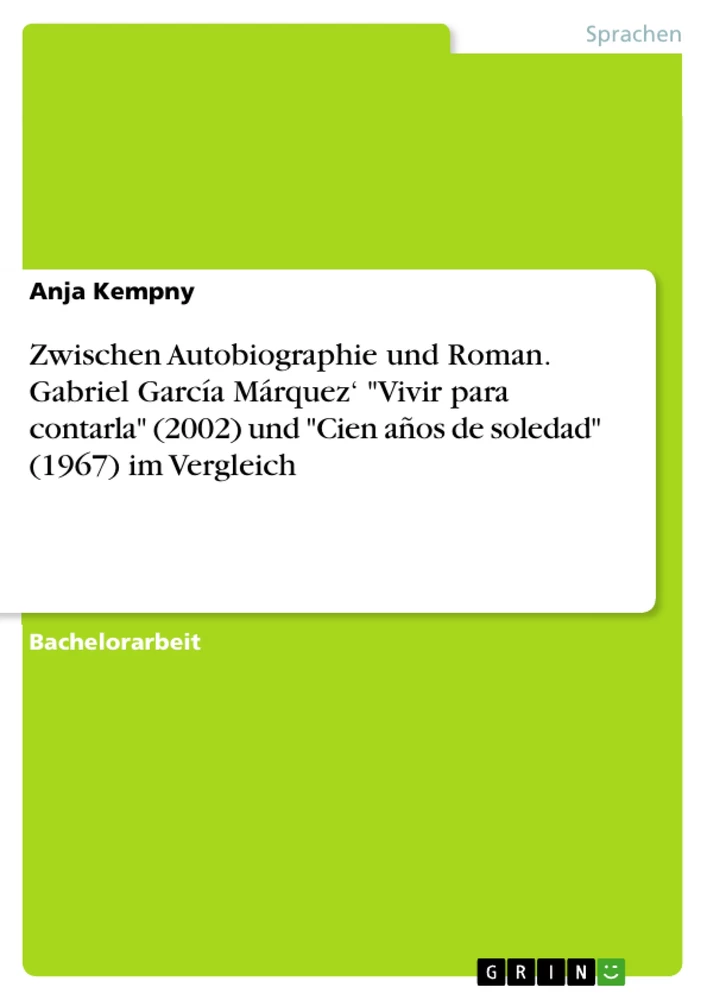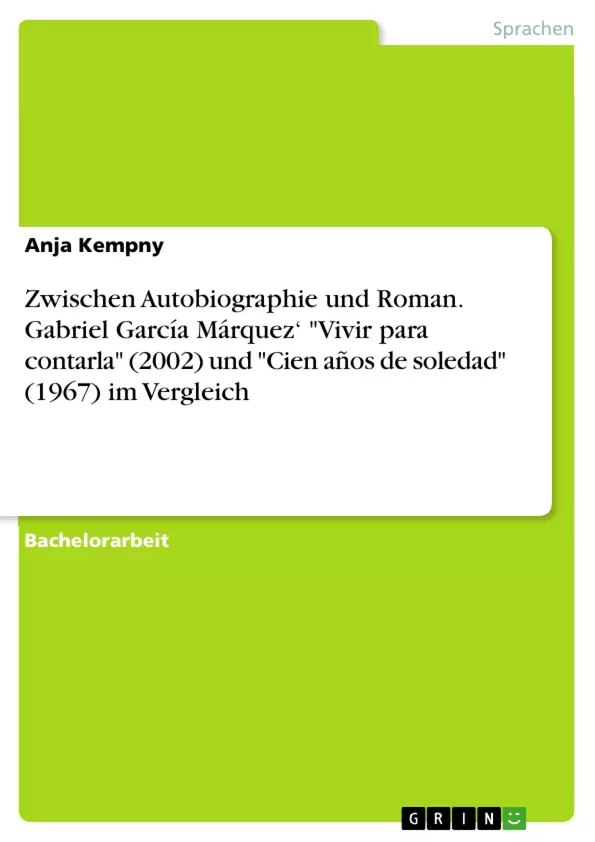Diese Arbeit untersucht, inwiefern García Márquez in Form einer anekdotischen Sichtweise über sein Leben berichtet und dabei das Erzählen selbst in seiner Autobiographie in den Vordergrund rückt. Der Ausgangspunkt ist also das autobiographische Werk. Im Fokus steht darüber hinaus die Frage ob der Autor das Schreiben seiner Autobiographie nutzt, um persönliche Erlebnisse und Erfahrungen, die er bereits in seinem berühmten Roman Cien años de soledad (1967) auf fiktive Weise eingebettet hat, nun in einem „angemessenen“ und wahrhaftigen Rahmen erneut zu thematisieren. Inwieweit lässt sich das Verhältnis von Fakten und Fiktionen voneinander abgrenzen, wo liegen Differenzen und Schnittstellen zwischen Autobiographie und Roman?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Gabriel García Márquez
- 2. Die Autobiographie
- 2.1. Forschungsansätze und Theorien
- 2.2. Aufbau und Form
- 2.3. Autobiographie und Roman = ,Autofiktion'?
- 2.4. Erinnerung, Gedächtnis und Wahrheit
- 3. Faktuales und fiktionales Erzählen
- Exkurs: Wirklichkeitserzählungen
- 3.1. Erzählstruktur in Vivir para contarla (2002)
- 3.2. Erzählstruktur in Cien años de soledad (1967)
- 3.3. Die Erzählperspektive
- 4. Analyse der Werke
- 4.1. Orte
- 4.2. Personen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Autobiographie Vivir para contarla von Gabriel García Márquez im Kontext seines Romans Cien años de soledad. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse des Verhältnisses von Fakten und Fiktionen, der Unterscheidung zwischen Autobiographie und Roman sowie der Rolle des Erzählens im Werk García Márquez.
- Die Bedeutung des Erzählens in García Márquez' Autobiographie
- Das Verhältnis zwischen Fakten und Fiktionen in Vivir para contarla und Cien años de soledad
- Die Frage, ob sich Autobiographie und Roman in García Márquez' Werken zu „Autofiktion“ vermischen
- Die Rolle des Erinnerns und des Gedächtnisses in beiden Werken
- Die Analyse der Erzählstrukturen in Vivir para contarla und Cien años de soledad
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, die Autobiographie Vivir para contarla, und führt in die Biographie des Autors ein. Zudem werden die zentralen Fragestellungen der Arbeit definiert.
- Kapitel 2: Die Autobiographie: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Forschungsansätzen und Theorien zur Autobiographie. Darüber hinaus analysiert es Aufbau und Form von Vivir para contarla und befasst sich mit der Frage, ob sich Autobiographie und Roman in García Márquez' Werk zu „Autofiktion“ vermischen.
- Kapitel 3: Faktuales und fiktionales Erzählen: Dieses Kapitel untersucht die Erzählstrukturen in Vivir para contarla und Cien años de soledad. Dabei wird die Erzählperspektive in beiden Werken betrachtet.
- Kapitel 4: Analyse der Werke: Dieses Kapitel analysiert die Orte und Personen in Vivir para contarla und Cien años de soledad im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Gesamtwerk.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Autobiographie, Roman, Erzähltheorie, Faktualität, Fiktion, „Autofiktion“, Erinnerung, Gedächtnis, García Márquez, Vivir para contarla, Cien años de soledad, lateinamerikanische Literatur.
- Citar trabajo
- Anja Kempny (Autor), 2016, Zwischen Autobiographie und Roman. Gabriel García Márquez‘ "Vivir para contarla" (2002) und "Cien años de soledad" (1967) im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427232