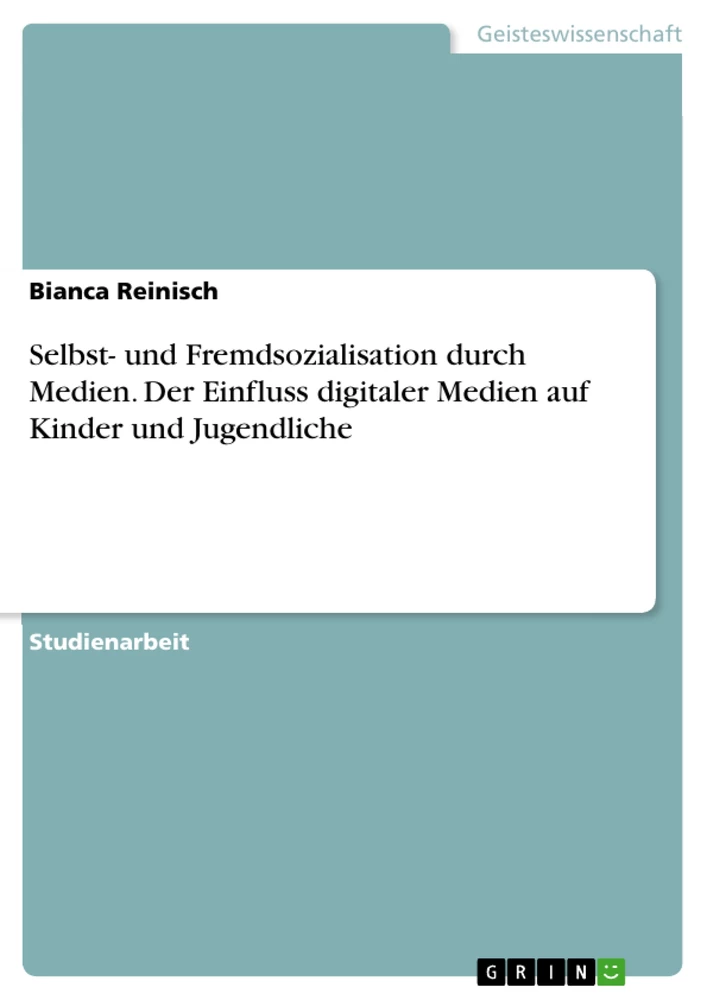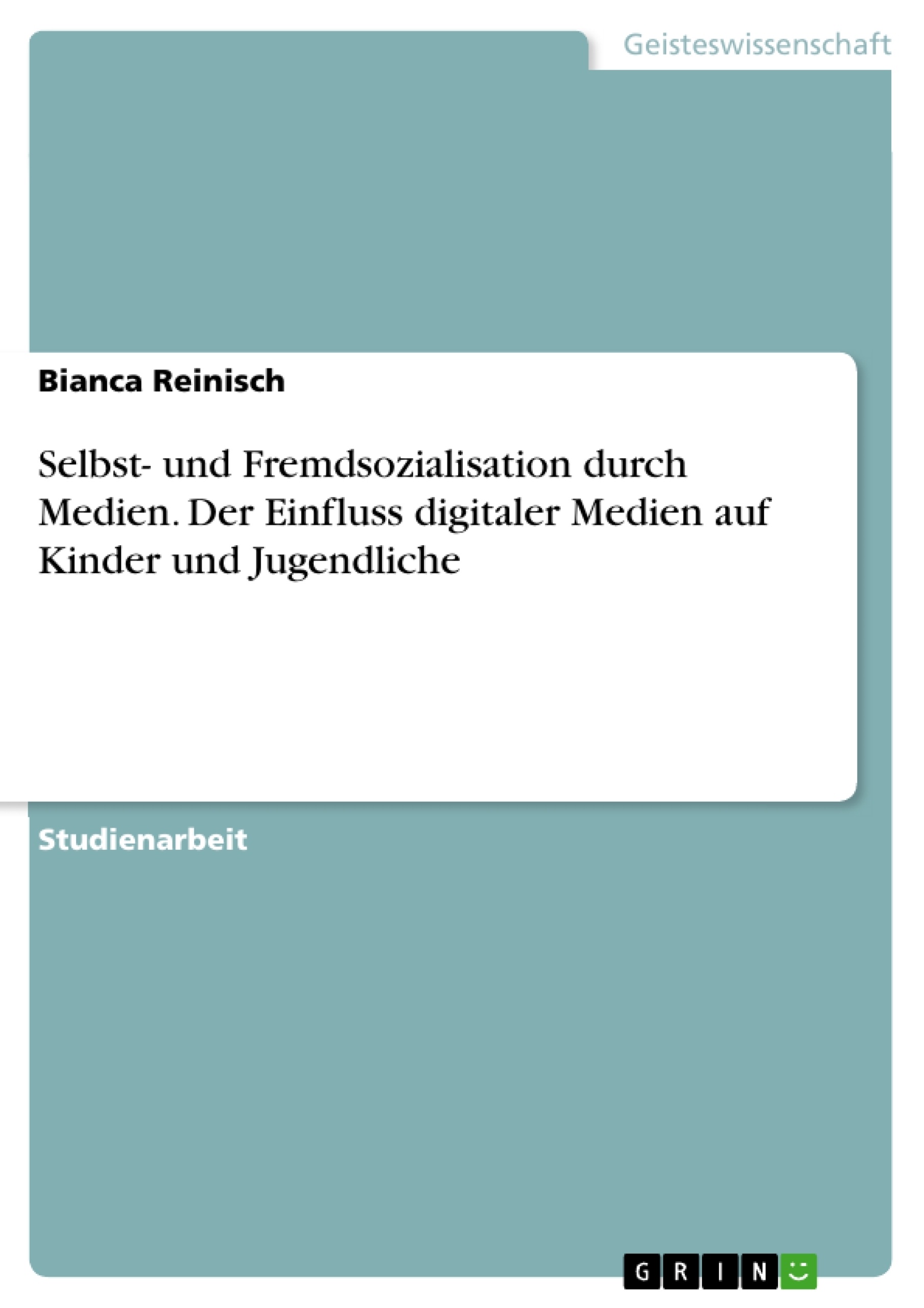Die westliche Gesellschaft des 21. Jahrhunderts beschäftigt sich vor allem mit einem: der Kommunikation. Jeder der nicht kommuniziert, wird vom kulturellen und sozialen Leben, sowie der Gesellschaft sanktioniert, ja gar ausgeschlossen, denn es existiert kein Leben, kein Aufwachsen ohne Medien. Insbesondere Kinder und Jugendliche wachsen in mediengesättigten Haushalten auf und ihre Lebenswelten werden immer mehr von der Fülle an Medien durchdrungen. Die Nutzung von digitalen Medien steigt stetig an und Kinder beschäftigen sich heutzutage lieber mit dem Fernseher anstatt Bücher zu lesen.
In dieser Arbeit beziehen wir uns auf die drei Leitmedien der Kinder und Jugendlichen: dem Fernseher, gefolgt vom Handy, welches besonders bei den Mädchen beliebt ist und dem Computer samt Internet, welchen die Jungen bevorzugen.
In den ersten Schritten dieser Ausarbeitung, befassen wir uns theoretisch mit den Begriffen der Selbst- und Fremdsozialisation und versuchen, sie zu definieren. Darauf folgt die kritische Auseinandersetzung verschiedener Sozialisationsforscher, da keine Einigung über eine feste Definition der oben genannten Begriffe herrscht. Es folgen die Chancen und Risiken der drei Leitmedien in der Mediensozialisation für den Sozialisanten, bevor wir zum Schluss einen Ausblick in Bezug auf Fremd- und Selbstsozialisation, sowohl auf der individuellen wie auch institutionellen Ebene durch Förderprogramme darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Sozialisation durch Medien
- 1.1 Mediennutzung als Selbstsozialisation
- 1.2 Mediennutzung als Fremdsozialisation
- 1.3 Kritik an den Definitionen
- 1.4 Anwendung auf die Social Network Plattform „Facebook“
- 2 Chancen und Risiken der drei Leitmedien
- 2.1 Handy
- 2.2 Fernsehen
- 2.3 Internet/Computer
- 3 Fazit
- 4 Ausblick für den schulischen Kontext
- 4.1 individuelle und institutionelle Förderprogramme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Sozialisation durch Medien im Kontext der Kinder- und Jugendentwicklung. Sie analysiert die Rolle von Medien wie Fernsehen, Handy und Internet in der Selbst- und Fremdsozialisation von Heranwachsenden und erörtert Chancen und Risiken dieser Mediennutzung. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Medienkompetenz und die Herausforderungen der Medienaneignung im digitalen Zeitalter.
- Die Bedeutung von Medien in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
- Die Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdsozialisation im medialen Kontext
- Chancen und Risiken der drei Leitmedien (Fernsehen, Handy, Internet) für die Entwicklung von Heranwachsenden
- Die Rolle von Peer-Groups als Sozialisationsinstanzen im digitalen Zeitalter
- Der Einfluss von Medien auf die Bildung und das soziale Miteinander
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mediensozialisation ein und beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Medien im Leben von Kindern und Jugendlichen. Sie stellt die drei Leitmedien (Fernsehen, Handy, Internet) vor und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
Kapitel 1 definiert die Begriffe Selbst- und Fremdsozialisation im Zusammenhang mit Medien. Es analysiert verschiedene Definitionen und zeigt die Bedeutung von Medienkompetenz für die Gestaltung der eigenen Mediennutzung auf. Die Anwendung dieser Konzepte auf die Social Network Plattform „Facebook“ verdeutlicht die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mediennutzung und sozialer Interaktion.
Kapitel 2 befasst sich mit den Chancen und Risiken der drei Leitmedien (Handy, Fernsehen, Internet/Computer) für die Sozialisation von Heranwachsenden. Es werden sowohl positive Aspekte wie die Erweiterung des Handlungsspielraums und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung als auch negative Aspekte wie die Gefahr der Abhängigkeit und der Verbreitung von negativen Inhalten beleuchtet.
Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und unterstreicht die Relevanz der Thematik für die Pädagogik und die gesellschaftliche Entwicklung.
Der Ausblick richtet den Fokus auf die Bedeutung von Mediensozialisation für den schulischen Kontext und die Notwendigkeit von individuellen und institutionellen Förderprogrammen, um Medienkompetenz zu fördern und die Herausforderungen der digitalen Welt zu bewältigen.
Schlüsselwörter
Mediensozialisation, Selbstsozialisation, Fremdsozialisation, Medienkompetenz, digitale Medien, Leitmedien, Chancen und Risiken, Peer-Group, Bildung, soziale Ungleichheit, Förderprogramme.
- Arbeit zitieren
- Bianca Reinisch (Autor:in), 2013, Selbst- und Fremdsozialisation durch Medien. Der Einfluss digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427414