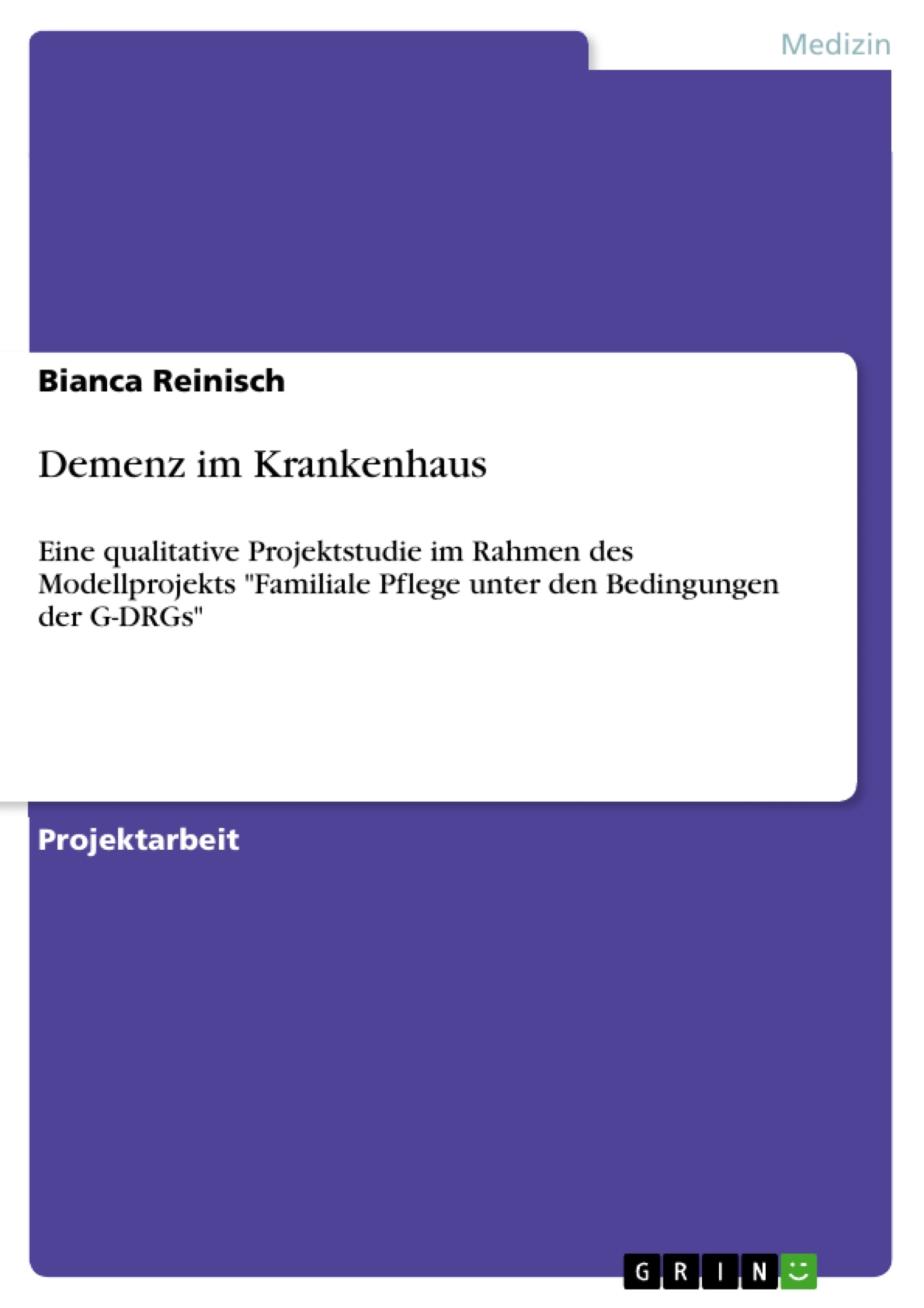Der vorliegende Forschungsbericht zur Projektstudie „Demenz im Krankenhaus“ gliedert sich in fünf Abschnitte. Es beginnt mit der hinführenden Darstellung der thematischen Ausgangslage für diese Projektstudie im Rahmen der demografisch bedingten Zunahme an hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen in unserer Gesellschaft und dem an dieser Problemlage anknüpfenden Modellprojekts „Familiale Pflege“, unter den Bedingungen der G-DRG’s“. Es folgt das zweite Kapitel,welches sich mit der Herstellung des theoretischen Bezugsrahmens zwischen der bereits genannten allgemeinen Ausgangslage und der in diesem Forschungsbericht behandelten spezifischen Thematik der Demenz im Krankenhaus beschäftigt. Darin wird außerdem der aktuelle Stand der thematisch angegliederten Forschungsergebnisse wiedergegeben. In Verbindung damit wird hierzu im ersten Unterkapitel des zweiten Abschnittes zunächst auf den demografischen Wandel im Zusammenhang mit Demenz eingegangen. Daran anschließend wird der theoretische Begriff „Demenz“ einerseits aus monodisziplinär medizinischer und andererseits aus interdisziplinär geisteswissenschaftlicher Perspektive beleuchtet und einführend erklärt. Im zweiten und abschließenden Teil des zweiten Kapitels soll die Verknüpfung des bisher allgemein dargestellten Phänomens Demenz mit der aktuellen Situation demenzkranker Menschen in der Institution Krankenhaus stattfinden und der Übergang zum Forschungsinteresse der eigenen Projektstudie gebildet werden.
Das zentrale Element des dritten Kapitels stellt der methodologische Bezugsrahmen dar. Zunächst soll im ersten Abschnitt des dritten Kapitels ein kurzer Einblick in die qualitative Sozialforschung als methodologischer Forschungsrahmen gegeben werden. Nachfolgend werden dann die Gruppendiskussion als gewähltes Verfahren der Datenerhebung und die dokumentarische Methode sowie ihre einzelnen Interpretationsschritte als Instrument der Datenauswertung expliziert.
Im Anschluss daran bildet das vierte Kapitel den Übergang zur eigenen, in diesem Forschungsbericht präsentierten Projektstudie „Demenz im Krankenhaus“. Hier sollen zunächst eigene forschungspraktische Details zum Erkenntnisinteresse, zur Stichprobe sowie die Begründung der Methodenwahl bei der von uns durchgeführten Projektstudie erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Bezugsrahmen und Forschungsstand
- 2.1 Demografischer Wandel und Demenz im gesellschaftlichen Kontext
- 2.2 Demenz im Krankenhaus
- 3. Methodologischer Bezugsrahmen
- 3.1 Die Qualitative Sozialforschung als methodologischer Forschungsrahmen
- 3.2 Die Gruppendiskussion als Verfahren der Datenerhebung
- 3.3 Die Dokumentarische Methode als Instrument der Datenauswertung
- 4. Eigene Projektstudie „,Demenz im Krankenhaus”
- 4.1 Erkenntnisinteresse, Begründung der Methoden- und Stichprobenwahl
- 4.2 Entwicklung und Aufbau des Diskussionsleitfadens
- 4.3 Praktische Durchführung der Gruppendiskussion
- 4.4 Auswertung der Gruppendiskussion: Die formulierende Interpretation
- 4.5 Auswertung der Gruppendiskussion: Die reflektierende Interpretation
- 4.6 Ergebniszusammenfassung und dokumentarischer Sinn
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektstudie „Demenz im Krankenhaus“ untersucht die Erfahrungen und Perspektiven von Pflegefachkräften im Umgang mit demenziell erkrankten Patient_innen in Akutkrankenhäusern. Sie ist eingebettet in das Modellprojekt „Familiale Pflege unter den Bedingungen des G-DRG-Systems“, welches den Übergang von Patient_innen aus dem Krankenhaus in die häusliche familiäre Versorgung begleitet und unterstützt.
- Erfahrungen von Pflegefachkräften im Umgang mit Demenz im Krankenhaus
- Herausforderungen und Chancen der Pflege demenziell erkrankter Patient_innen im Krankenhaus
- Die Rolle des G-DRG-Systems im Kontext der Pflege demenziell erkrankter Patient_innen
- Die Bedeutung der familialen Pflege im Kontext der Demenz
- Die Weiterentwicklung des Modellprojekts „Familiale Pflege“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den demografischen Wandel und die Zunahme demenzieller Erkrankungen im Kontext des Modellprojekts „Familiale Pflege“ vor. Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Bezugsrahmen von Demenz und den Forschungsstand, wobei sowohl der demografische Wandel als auch die Herausforderungen der Demenz im Krankenhaus beleuchtet werden. Das dritte Kapitel widmet sich dem methodologischen Rahmen der Studie, insbesondere der Qualitativen Sozialforschung, der Gruppendiskussion und der dokumentarischen Methode. Im vierten Kapitel wird die eigene Projektstudie „Demenz im Krankenhaus“ vorgestellt, inklusive der Begründung der Methodenwahl, der Entwicklung des Diskussionsleitfadens, der Durchführung der Gruppendiskussion sowie der Auswertung mittels der formulierenden und reflektierenden Interpretation.
Schlüsselwörter
Die Projektstudie „Demenz im Krankenhaus“ fokussiert auf Themen wie Demenz, Pflege, Krankenhaus, G-DRG-System, Qualitative Sozialforschung, Gruppendiskussion, Dokumentarische Methode, familiäre Pflege, Modellprojekt, Erfahrungen, Perspektiven, Herausforderungen, Chancen.
- Quote paper
- Bianca Reinisch (Author), 2014, Demenz im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427416