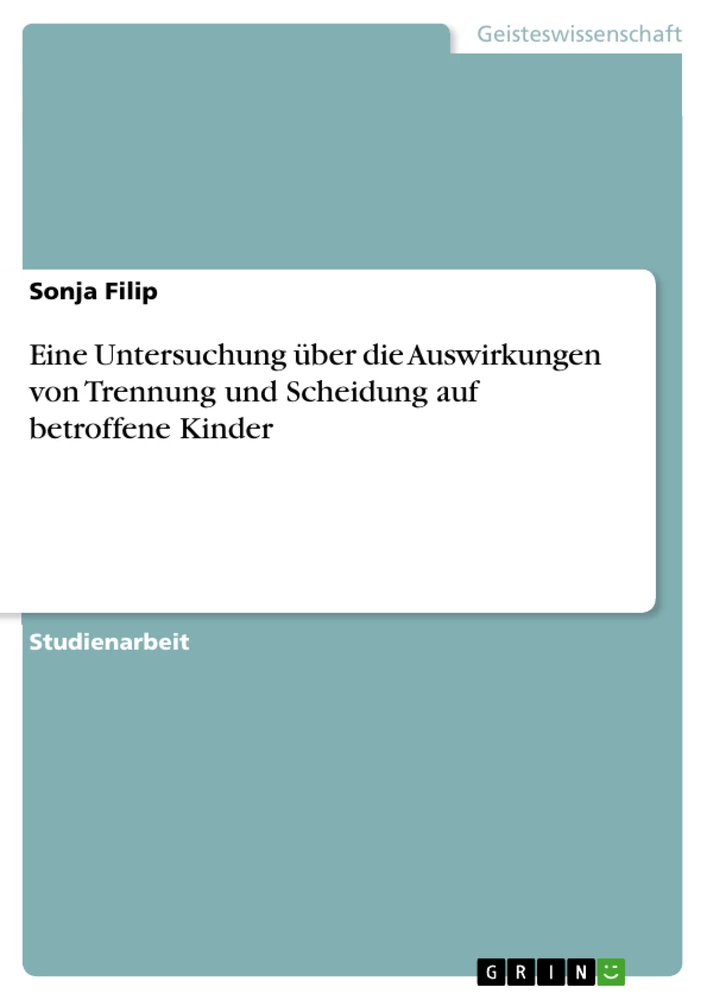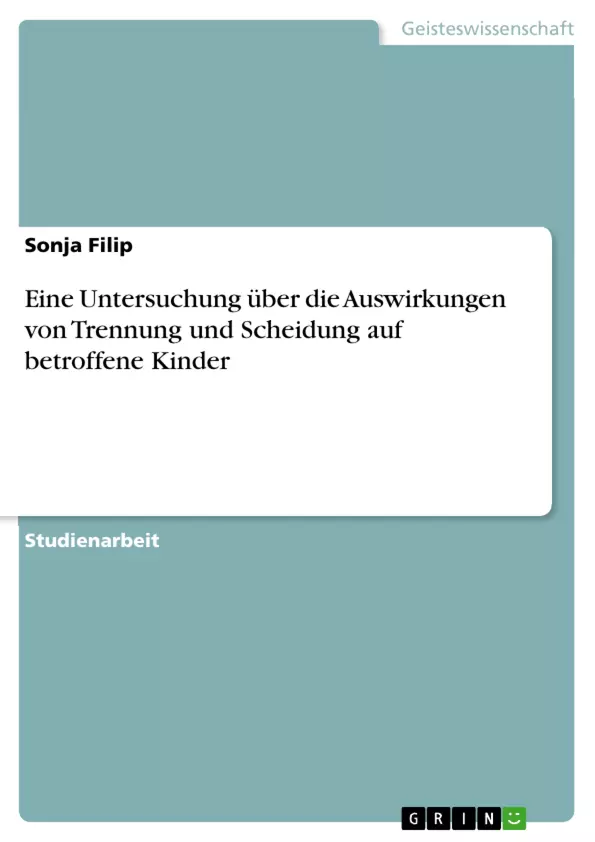Obwohl auch heute noch rund 80% der jungen Menschen in Umfragen angeben, dass sie traditionell eine Familie gründen, heiraten und Kinder kriegen wollen, so kann man ganz allgemein sagen, dass die Scheidungsrate seit den 60er Jahren kontinuierlich ansteigt. Im Jahr 2008 beispielsweise wurden insgesamt 191.948 Ehen geschieden – dazu ist noch die vermutlich nicht geringe Anzahl derer zu rechnen, die ohne Trauschein zusammengelebt haben. Die durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung betrug 2008 14,1 Jahre und es waren 150.187 minderjährige Kinder von einer Scheidung der Eltern betroffen (plus ca. 100.000 Trennungskinder unverheirateter Eltern).1 Jedes 4. Kind erlebt also im Verlauf seiner Kindheit, dass seine Eltern sich scheiden lassen und insgesamt sind es 3,7 Millionen Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben – 86 % hiervon wohnen bei der Mutter.
Die Gründe dafür, dass die Scheidungsrate seit den 60er Jahren doch deutlich wächst, sind vielfältig. Eine wichtige Rolle spielen hier sicherlich die zunehmende Liberalisierung, Pluralisierung und Individualisierung der Gesellschaft – die Akzeptanz für unterschiedliche Lebensstile und auch die Toleranz dieser hat zugenommen. Dagegen ist die Religiosität im Durchschnitt doch deutlich gesunken – und damit endete so manche Ehe, die nicht mehr intakt war, aber in früheren Zeiten ‚bis dass der Tod euch scheidet‘ aufrechterhalten worden wäre, doch vor dem Scheidungsrichter.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fakten rund um die Scheidung
- 2. Phasen einer Scheidung
- 2.1 Die Vor(ent)scheidungsphase / Ambivalenzphase
- 2.2 Die Scheidungsphase
- 2.3 Die Nachscheidungsphase
- 3. Wie sagen wir es unseren Kindern?
- 4. Wie verstehen Kinder Liebe, Ehe, Trennung?
- 5. Verständnis von sozialen Strukturen, Raum und Zeit
- 6. Vermissen
- 7. Folgen einer Trennung
- 7.1 Kurzfristige Folgen
- 7.2 Langfristige Folgen
- 8. Weshalb ist eine Scheidung für Jugendliche so belastend?
- 9. Getrennt leben, gemeinsam erziehen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat befasst sich mit dem Thema Trennung und Scheidung, analysiert die steigende Scheidungsrate in Deutschland und beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte, die zu dieser Entwicklung führen. Es werden die Phasen einer Scheidung, die Auswirkungen auf Kinder und die Folgen für die beteiligten Personen diskutiert.
- Steigende Scheidungsrate in Deutschland
- Phasen einer Scheidung: Vor-, Scheidungs- und Nachscheidungsphase
- Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder
- Soziale, emotionale und psychologische Folgen für die Eltern
- Herausforderungen der gemeinsamen Erziehung nach einer Trennung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die steigende Scheidungsrate in Deutschland und untersucht die Faktoren, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Das zweite Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen einer Scheidung, beginnend mit der Vor(ent)scheidungsphase, über die eigentliche Scheidungsphase bis hin zur Nachscheidungsphase. Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, wie Eltern ihren Kindern die Trennung am besten mitteilen können. Das vierte Kapitel analysiert, wie Kinder Liebe, Ehe und Trennung verstehen.
Schlüsselwörter
Scheidung, Trennung, Ehescheidung, Kinder, Folgen, Auswirkungen, Phasen, Scheidungsrate, Emanzipation, Individualisierung, Gesellschaft, Recht, Lebensgemeinschaft, Unterhalt, Erziehungs- und Familienberatung, soziale Strukturen, Raum, Zeit, Vermissen, Belastung, gemeinsame Erziehung
- Quote paper
- Sonja Filip (Author), 2010, Eine Untersuchung über die Auswirkungen von Trennung und Scheidung auf betroffene Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427478