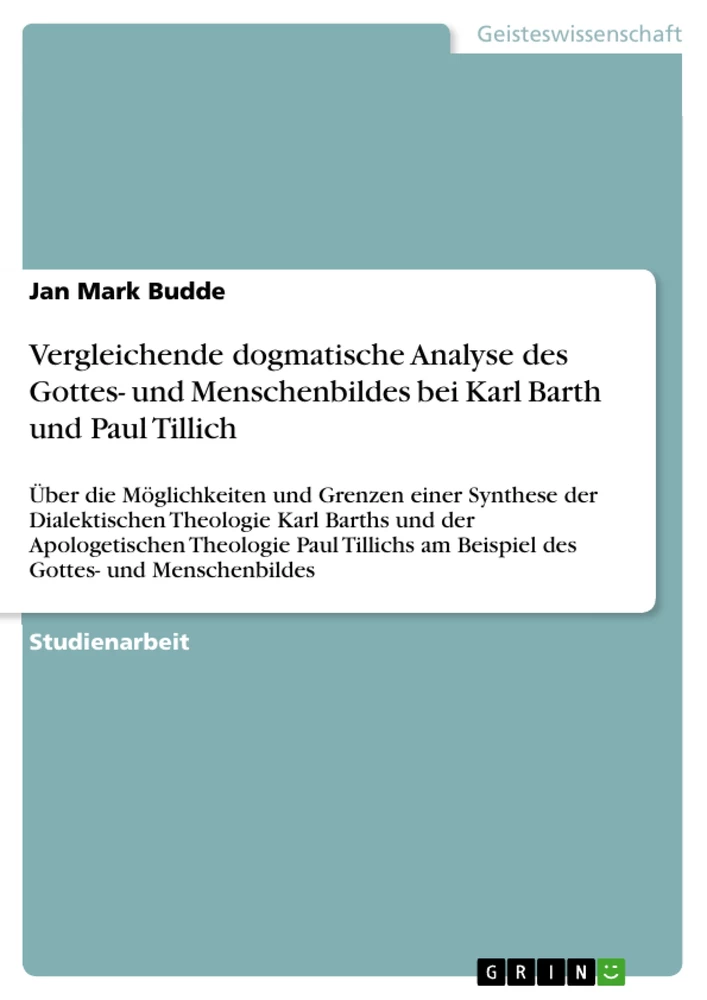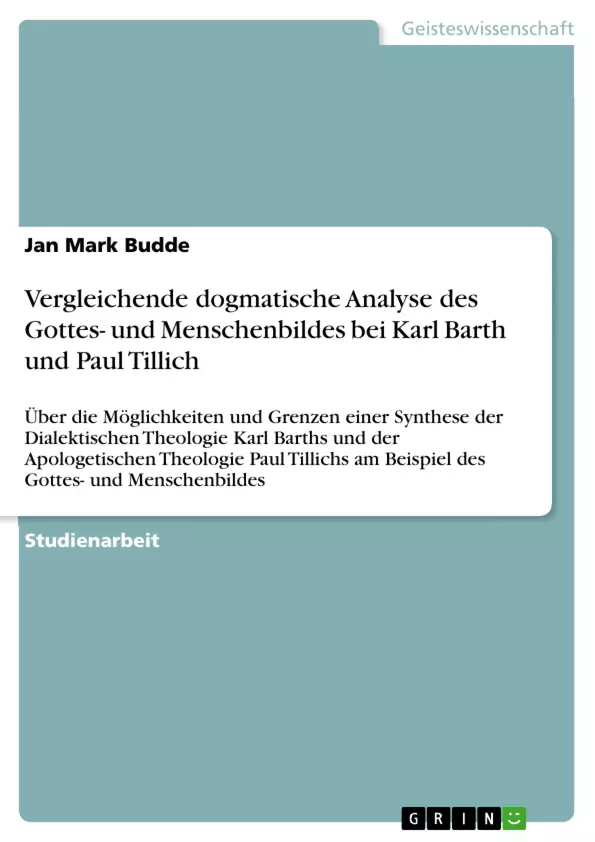Paul Johannes Tillich (1886-1965) und Karl Barth (1886-1968) waren zwei der prägendsten Dogmatiker im Bereich der deutschsprachigen protestantischen Theologie des vergangenen Jahrhunderts.
Am Beispiel des Gottes- und Menschenbildes werden im Hauptteil dieser Arbeit zunächst die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden theologischen Konzeptionen herausgearbeitet, wobei zuvor ein kurzer Abriss der beiden Dogmatiken erfolgt.
Zum Schluss dieser Proseminararbeit erfolgt ein kurzes Resümee, in welchem die Möglichkeiten und Grenzen eines synthetisierten Gottes- und Menschenbildes diskutiert und erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Methodische Vorbemerkungen und Zielsetzung der Arbeit
- Prolegomena: Kurzer Abriss der theologischen Konzeptionen
- Karl Barth als Begründer der Dialektischen Theologie
- Paul Tillich und seine Apologetische Theologie
- Gottes- und Menschenbild von Barth und Tillich im Vergleich
- Vergleich des Gottesbildes
- Das Gottesbild in der Dialektischen Theologie Karl Barths
- Das Gottesbild in der Apologetischen Theologie Paul Tillichs
- Vergleich des Menschenbildes
- Das Menschenbild bei Karl Barth
- Das Menschenbild bei Paul Tillich
- Vergleich des Gottesbildes
- Resümee: Möglichkeiten, Grenzen und Konzeption eines einheitlichen Gottes- und Menschenbildes
- Möglichkeiten eines einheitlichen Gottes- und Menschenbildes
- Grenzen eines einheitlichen Gottes- und Menschenbildes
- Konzeption eines einheitlichen Gottes- und Menschenbildes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die theologischen Konzeptionen von Karl Barth und Paul Tillich, insbesondere ihre Gottes- und Menschenbilder, vergleichend zu analysieren und die Möglichkeiten und Grenzen einer Synthese beider Ansätze zu erörtern. Die Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Dialektischen Theologie Barths und der Apologetischen Theologie Tillichs. Eine mögliche Synthese wird angestrebt, um neue Impulse für den theologischen Diskurs zu liefern.
- Vergleichende Analyse der Gottesbilder von Barth und Tillich
- Vergleichende Analyse der Menschenbilder von Barth und Tillich
- Möglichkeiten einer Synthese der beiden theologischen Konzeptionen
- Grenzen einer Synthese der beiden theologischen Konzeptionen
- Konzeption eines möglichen einheitlichen Gottes- und Menschenbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Methodische Vorbemerkungen und Zielsetzung der Arbeit: Das Vorwort führt in die Thematik ein und stellt die beiden Theologen Karl Barth und Paul Tillich als prägende Figuren der deutschsprachigen protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts vor. Es hebt den Unterschied zwischen Barths „Wort Gottes“-Orientierung und Tillichs Ansatz hervor, der eine weniger strikte Ausrichtung auf die Heilige Schrift aufweist. Die Arbeit wird die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konzeptionen am Beispiel des Gottes- und Menschenbildes untersuchen und schließlich eine mögliche Synthese erörtern. Der methodische Ansatz wird skizziert, wobei die chronologische Reihenfolge der Publikationen berücksichtigt wird, beginnend mit Barths Dialektischer Theologie und gefolgt von Tillichs Apologetischer Theologie. Das Vorwort betont den ambitionierten Versuch, eine Synthese zu schaffen, und die möglichen Herausforderungen sowie den wissenschaftlichen Mehrwert dieser Arbeit.
Prolegomena: Kurzer Abriss der theologischen Konzeptionen: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die theologischen Konzeptionen von Karl Barth und Paul Tillich. Es werden die zentralen Aspekte der Dialektischen Theologie Barths, insbesondere die Bedeutung des Kerygma und die Betonung des Gehorsams gegenüber Gott, erläutert. Gleichzeitig wird die Apologetische Theologie Tillichs vorgestellt, wobei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze herausgearbeitet werden. Der Abschnitt unterstreicht die Notwendigkeit eines Vergleichs, da die Unterschiede oft überbetont und die Gemeinsamkeiten vernachlässigt werden. Das Kapitel dient als Grundlage für den detaillierten Vergleich der Gottes- und Menschenbilder in den folgenden Kapiteln.
Schlüsselwörter
Dialektische Theologie, Apologetische Theologie, Karl Barth, Paul Tillich, Gottesbild, Menschenbild, Synthese, Kerygma, Wort Gottes, Rechtfertigung, Glaube, Gehorsam, Schöpfung, Dogmatik, protestantische Theologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der theologischen Konzeptionen von Karl Barth und Paul Tillich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die theologischen Konzeptionen von Karl Barth und Paul Tillich, insbesondere ihre Gottes- und Menschenbilder. Sie analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Dialektischen Theologie Barths und der Apologetischen Theologie Tillichs und erörtert die Möglichkeiten und Grenzen einer Synthese beider Ansätze.
Welche Theologen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die theologischen Konzeptionen von Karl Barth (Dialektische Theologie) und Paul Tillich (Apologetische Theologie), zwei einflussreichen Theologen der deutschsprachigen protestantischen Theologie des 20. Jahrhunderts.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleichende Analyse der Gottesbilder von Barth und Tillich; Vergleichende Analyse der Menschenbilder von Barth und Tillich; Möglichkeiten einer Synthese der beiden theologischen Konzeptionen; Grenzen einer Synthese der beiden theologischen Konzeptionen; Konzeption eines möglichen einheitlichen Gottes- und Menschenbildes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort mit methodischen Vorbemerkungen und Zielsetzung, Prolegomena mit einem kurzen Abriss der theologischen Konzeptionen beider Theologen, einen Hauptteil mit dem Vergleich der Gottes- und Menschenbilder und ein Resümee mit Möglichkeiten, Grenzen und Konzeption eines einheitlichen Gottes- und Menschenbildes. Die Arbeit berücksichtigt die chronologische Reihenfolge der Publikationen beider Theologen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die theologischen Konzeptionen von Barth und Tillich vergleichend zu analysieren und die Möglichkeiten und Grenzen einer Synthese beider Ansätze zu erörtern. Sie möchte neue Impulse für den theologischen Diskurs liefern.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methode, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Dialektischen Theologie Barths und der Apologetischen Theologie Tillichs untersucht werden. Die chronologische Reihenfolge der Publikationen wird berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dialektische Theologie, Apologetische Theologie, Karl Barth, Paul Tillich, Gottesbild, Menschenbild, Synthese, Kerygma, Wort Gottes, Rechtfertigung, Glaube, Gehorsam, Schöpfung, Dogmatik, protestantische Theologie.
Welche Unterschiede zwischen Barth und Tillich werden hervorgehoben?
Die Arbeit hebt den Unterschied zwischen Barths „Wort Gottes“-Orientierung und Tillichs weniger strikten Ansatz bezüglich der Heiligen Schrift hervor. Weitere Unterschiede werden im Vergleich der Gottes- und Menschenbilder beider Theologen detailliert dargestellt.
Welche Gemeinsamkeiten zwischen Barth und Tillich werden betont?
Die Arbeit sucht nach Gemeinsamkeiten zwischen den Ansätzen von Barth und Tillich, obwohl die Unterschiede oft überbetont und die Gemeinsamkeiten vernachlässigt werden. Diese Gemeinsamkeiten werden im Vergleich der Gottes- und Menschenbilder und der Suche nach einer möglichen Synthese herausgearbeitet.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Das Ergebnis der Arbeit ist eine vergleichende Analyse der Gottes- und Menschenbilder von Barth und Tillich, sowie eine Erörterung der Möglichkeiten und Grenzen einer Synthese beider Ansätze. Die Arbeit liefert konzeptionelle Überlegungen zu einem möglichen einheitlichen Gottes- und Menschenbild.
- Arbeit zitieren
- Jan Mark Budde (Autor:in), 2016, Vergleichende dogmatische Analyse des Gottes- und Menschenbildes bei Karl Barth und Paul Tillich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427736