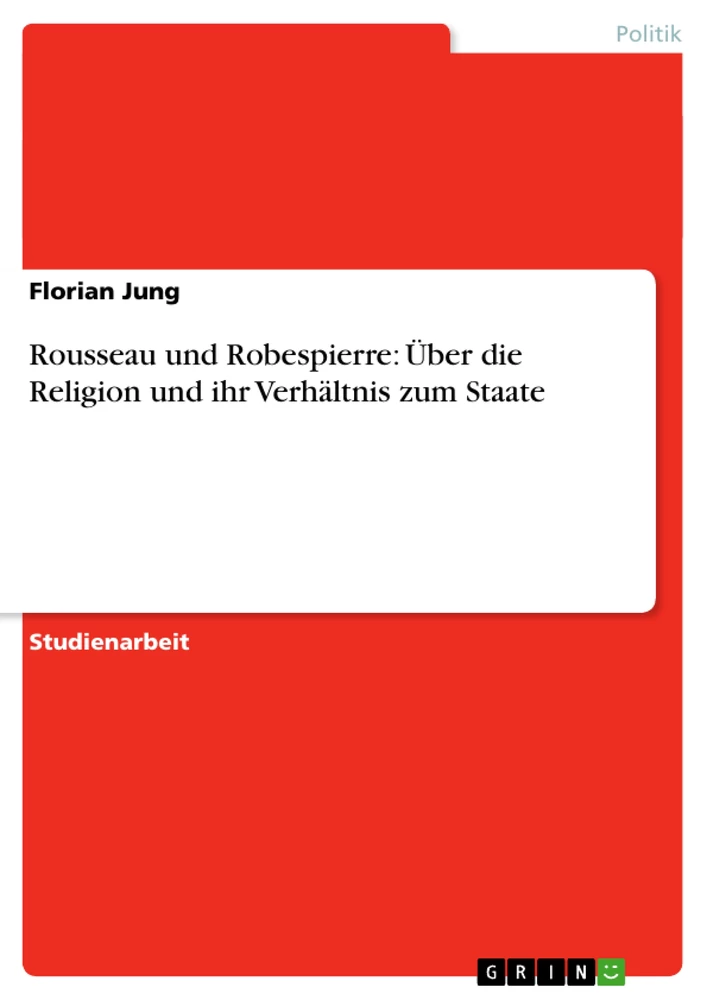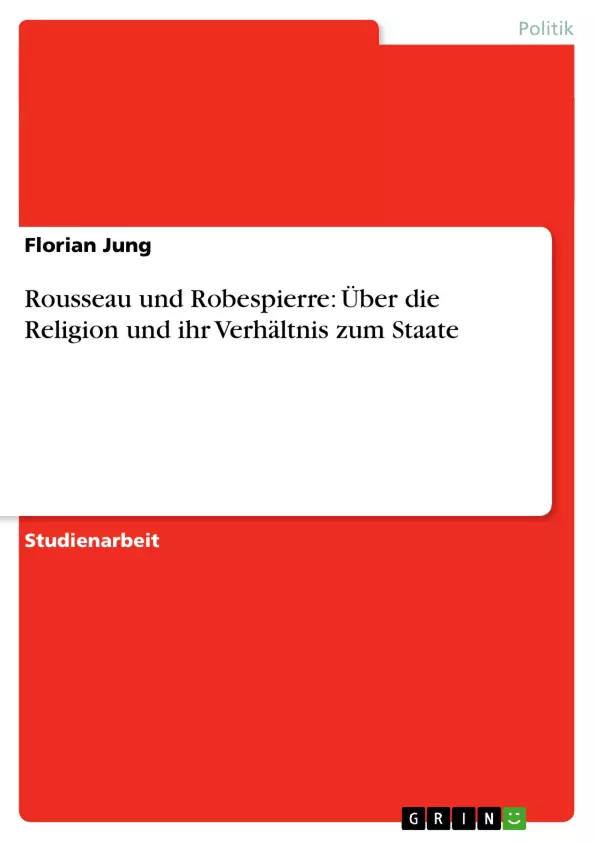Es sind dies zweifelsohne Zeiten des Umbruchs, in denen sich entscheidende weltpolitische Akteure neu orientieren und positionieren. Viel ist spekuliert worden über die Zeit nach dem Kalten Krieg. Viele Menschen, die nach langer Zeit von der latenten Angst vor einem dritten Weltkrieg befreit waren, glaubten trotz zahlreicher regionaler Konflikte an ein beginnendes Zeitalter weltweiten Friedens. Doch bereits eine Dekade später nähren nur noch blinder Optimismus oder stoischer Wille einen solchen Glauben. Das Ansehen der Vereinten Nationen als Quell des Weltfriedens hat durch das Vorgehen der „Koalition der Willigen“ enormen Schaden erlitten, und eine Kraft droht die Menschheit zu spalten, die bereits Millionen Menschenleben kostete und zumindest in westlichen Demokratien weitgehend in der Bedeutungslosigkeit verschwunden zu sein schien. Diese Kraft, die religiöse Intoleranz, peitscht islamistische Fundamentalisten zum Terror und begründet gleichzeitig eine Wertegemeinschaft mit, welche sie diesem entgegenstellt. Die Religion hat als Motiv menschlichen und damit auch gesellschaftlichen Handelns wieder verstärkt an Bedeutung gewonnen, und ihr Verhältnis zu einem anderen entscheidenden Prinzip menschlicher Interaktion, der Politik, ist vor allem für westliche Industrienationen ungewohnt vielschichtig geworden.
Zur Aufhebung dieser Befremdlichkeit ist es deshalb auch in laizistischen Staaten unerlässlich, wieder intensiv über das Verhältnis von Religion und Politik nachzudenken. Zu diesem Zweck mag es dienlich sein, die Auffassungen zweier bedeutender historischer Persönlichkeiten, gemeint sind Jean-Jacques Rousseau und Maximilien Robespierre, über eben dieses Verhältnis darzustellen, zumal beide großen Einfluss auf die historische Entwicklung der Demokratie in Europa besaßen. Abschließend sollen dann die beiden Vorstellungen über das Optimum dieses Verhältnisses kurz miteinander verglichen werden. Wobei der nahezu spiegelbildliche Aufbau der Arbeit auch schon während der Darstellung der Ansichten Robespierres Vergleiche mit denen Rousseaus gestattet.
Da der Umfang der vorliegenden Arbeit jedoch begrenzt ist, kann sie das Verhältnis von Politik und Religion nur asymmetrisch, wie die Überschrift bereits andeutet, mit Schwerpunkt auf dem Religionsbegriff, darstellen. Die Kenntnis der Staatstheorien der beiden Autoren wird deshalb vorausgesetzt und nicht ausdrücklich erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jean-Jacques Rousseau: Über die Religion und ihr Verhältnis zum Staate
- Das Suboptimum
- Die gedeutete historische Entwicklung
- Die zu erklärenden Begriffe
- La religion de l'homme
- La religion du citoyen
- La religion du prêtre
- Das Optimum
- Die zu instrumentalisierende Religion
- La religion civile
- Das Suboptimum
- Maximilien Robespierre: Über die Religion und ihr Verhältnis zum Staate
- Das Suboptimum
- Die erlebte historische Entwicklung
- Der zu erklärende Eingriff
- Das Optimum
- Die zu instrumentalisierende Religion
- Der Kult des Höchsten Wesens
- Das Suboptimum
- Die beiden Optima – ein Optimum . . .
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Religion und Staat, indem sie die Ansichten von Jean-Jacques Rousseau und Maximilien Robespierre auf diesem Gebiet beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Religionsbegriff und der Entwicklung des Verhältnisses von Religion und Politik im historischen Kontext. Die Arbeit strebt danach, die unterschiedlichen Konzepte der beiden Denker zu verdeutlichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in ihrem Verständnis des optimalen Verhältnisses von Religion und Staat aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung des Verhältnisses von Religion und Staat
- Definition und Bedeutung des Religionsbegriffs
- Die Rolle der Religion in der Gesellschaft und im politischen System
- Das optimale Verhältnis von Religion und Staat
- Vergleich der Ansichten von Rousseau und Robespierre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik im Kontext des globalen Umbruchs und der wachsenden Bedeutung von Religion im gesellschaftlichen Leben herausstellt. Im Anschluss werden die Ansichten von Jean-Jacques Rousseau und Maximilien Robespierre über die Religion und ihr Verhältnis zum Staat dargestellt. Dabei wird zunächst das Suboptimum, also die Situation vor dem optimalen Zustand, beleuchtet. Bei Rousseau wird die historische Entwicklung vom ursprünglichen theokratischen Staat zur Trennung von Religion und Staat beschrieben, und der Begriff der Religion wird in verschiedene Kategorien unterteilt: die natürliche Religion des Menschen, die Religion des Bürgers und die Religion des Priesters. Im Abschnitt über das Optimum wird dann die „La religion civile“ als Rousseaus idealer Weg zur Einbindung der Religion in den Staat vorgestellt. Bei Robespierre wird ähnlich vorgegangen: zunächst wird die historische Entwicklung und der zu erklärende Eingriff des Staates in die Religion behandelt, und anschließend wird das Optimum, der Kult des Höchsten Wesens, als Robespierres Modell für das Verhältnis von Religion und Staat vorgestellt. Die Arbeit endet mit einem Vergleich der beiden Optima und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Konzepten von Rousseau und Robespierre auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem komplexen Verhältnis von Religion und Staat. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind hierbei: Religion, Staat, theokratischer Staat, La religion de l'homme, La religion du citoyen, La religion du prêtre, La religion civile, Kult des Höchsten Wesens, historische Entwicklung, Rousseau, Robespierre.
- Arbeit zitieren
- Florian Jung (Autor:in), 2003, Rousseau und Robespierre: Über die Religion und ihr Verhältnis zum Staate, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42794