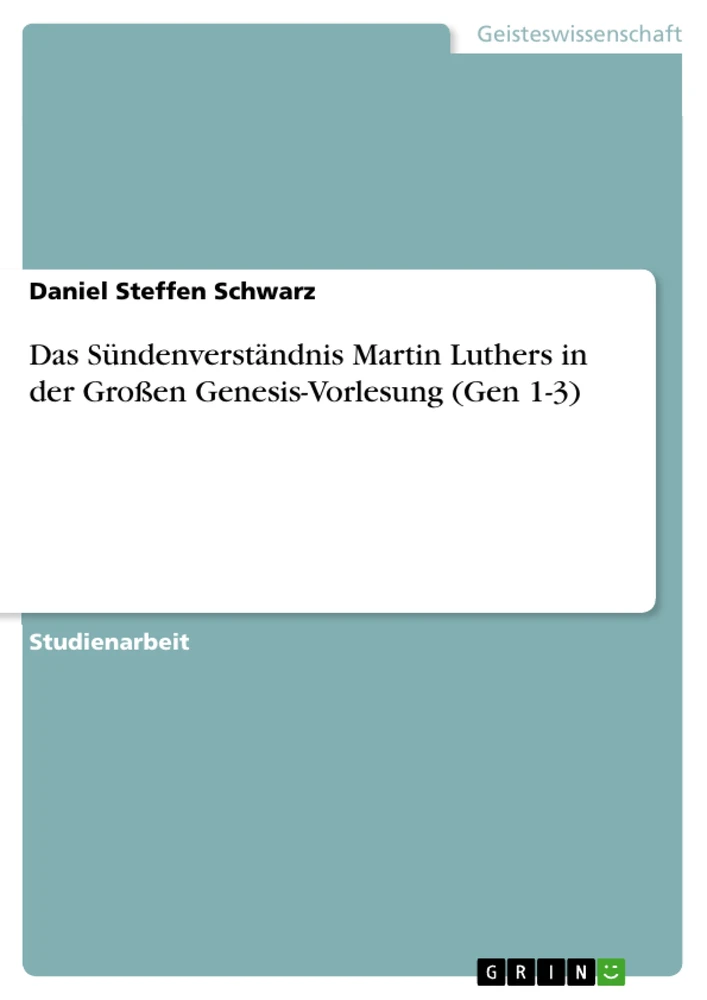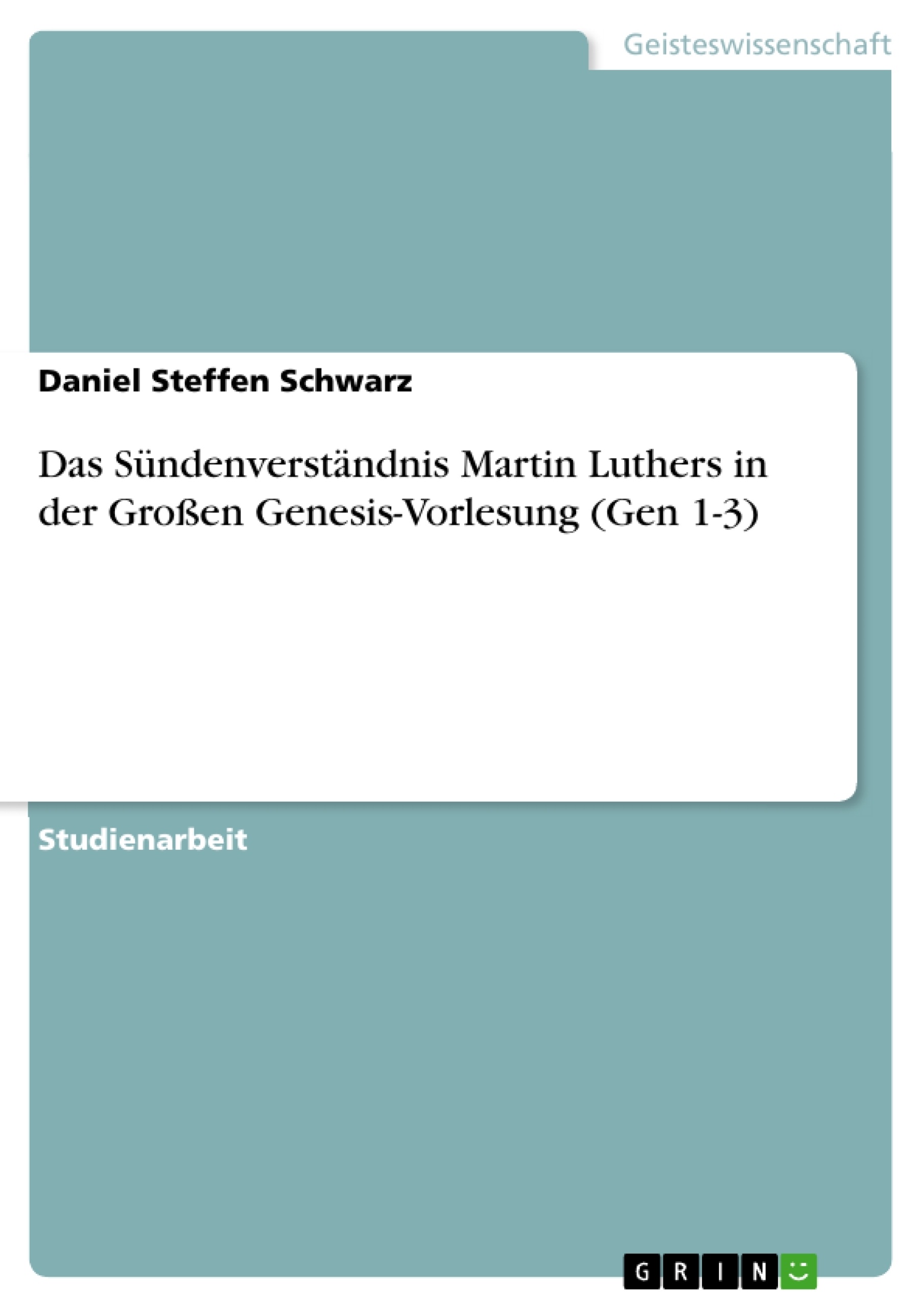In dieser Arbeit wird der Sündenbegriff bei Luther in seiner Schrift Große Genesisvorlesung Kapitel 1-3 im Überblick dargestellt. Da Luthers Schrift keine dogmatische Abhandlung des Themas, sondern exegetischer Natur ist, besteht die Herausforderung, die für ein systematisches Verständnis der Sündenlehre entscheidenden loci herauszuarbeiten. Auf zeitgeschichtliche Implikationen des Werkes Luthers wird aus Platzgründen verzichtet. Den hermeneutischen Vorrausetzungen seines Werkes wird hingegen aufgrund ihrer hohen Bedeutung für ein rezeptives Textverständnis und auch wegen der weitreichenden biblisch-theologischen Reichweite ein einführendes Kapitel gewidmet.
In einem Ertragskapitel werden zum einen die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst, zum anderen erfolgt in Ansätzen eine kritische Würdigung im Hinblick auf die Formulierung eines aktuellen evangelischen Sündenverständnisses. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein hermeneutischer Ausblick, der exemplarisch einige Ergebnisse aufgreift und sie vorbereitend praktisch-theologisch reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 0.1. Gegenstand und Ziel der Untersuchung
- 1. Luther
- 1.1. Stand der Forschung zum Sündenfall (Gen 1-3) in der Großen Genesisvorlesung
- 2. Die Schöpfung vor dem Fall
- 2.1. Methode und Hermeneutik in der großen Genesis-Vorlesung
- 2.1.1. Ablehnung der Allegorese zugunsten des historischen Textverständnisses
- 2.1.2. Die eingeschränkte postlapsarische Erkenntnis
- 2.1.3. Die christologisch-eschatologische Dimension
- 2.2. Der Mensch: coram Deo in fiduciam..
- 2.2.1. Grundlegendes zum Ebenbildsbegriff..
- 2.2.2. Imago dei als vita aeterna, securita aeterna et omnia bona ......
- 2.2.3. Imago Dei und das mandatum dei über die nichtmenschliche Kreatur zu herrschen
- 2.2.4. Der Mensch und das mandatum Dei nicht von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen
- 2.2.5. Der Mensch im status medius mit doppelter Natur
- 2.2.6. Der Mensch und die iustitia originalis und peccatum originale.....
- 2.2.7. Die Erschaffung der Frau zur Gemeinschaft und Erhaltung des Geschlechts
- 3. Der Sündenfall: Zerstörung der relatio durch unglauben.........
- 3.1. 1. Gesprächsgang (Gen 3, 1-3): Unglaube gegenüber Gottes Wort als die Quelle aller Sünden
- 3.2. Zweiter Gesprächsgang (Gen 3,4-5): Leugnung des Wortes Gottes......
- 3.3. Der Sündenfall: die neue sapientia Dei des Menschen und der daraus erwachsene tätliche Ungehorsam
- 4. Die Schöpfung nach dem Fall: Folgen des unglaubens
- 4.1. Die zerbrochene Beziehung des Menschen coram Deo ………………………
- 4.1.1. Nacktheit als Ausdruck von Scham und Schande des Menschen und von der Schändung der Kinderzeugung
- 4.1.2. Furcht und Flucht vor Gottes Strafe als Ausdruck der Tätigkeit des Gewissens (Gen 3,8)
- 14.1.3. Das Gewissen als Ankläger der Schuld des Menschen (Gen 3,9-13)
- 4.2. Die gestörte Beziehung des Menschen zum Mitmenschen
- 4.2.1. Die Bedeutung der Sexualität nach dem Fall…………………..\n
- 4.2.2. Der Mord Kains: Die Gewaltdimension der Sünde\n
- 4.2.3. Die gestörte Beziehung des Menschen zum Mitmenschen in Bezug auf die res: abusus...\n
- 4.3. Leben des Menschen zwischen Fluch und Verheißung (Gen 3,14-19).34
- 4.3.1. Hoffnung des Lebens: das Protoevangelium (Gen 3,14-15) ..........
- 4.3.2. Die Strafe der Frau: Leben mit Geburtsschmerz in Hoffnung auf das ewige Leben (Gen 3,16)
- 4.3.3. Die gestörte Beziehung des Mannes zum Acker: Verfluchung, bleibender Segen und die Hoffnung der Rückkehr zur Erde (Gen 3,17-19)
- 5. Vergleich und kritische Würdigung
- 6. Hermeneutischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Luthers Verständnis des Sündenbegriffs, wie es in seiner Großen Genesisvorlesung zum Ausdruck kommt. Im Fokus stehen die Kapitel 1-3, die sich mit dem Sündenfall befassen. Da Luthers Werk exegetischen Charakters ist, geht es darum, die relevanten Stellen für ein systematisches Verständnis der Sündenlehre herauszuarbeiten.
- Luthers Hermeneutik in der Großen Genesisvorlesung und deren Bedeutung für das Textverständnis.
- Luthers Sicht auf den Menschen vor dem Fall und das Konzept der Imago Dei.
- Die Folgen des Sündenfalls für die Beziehung des Menschen zu Gott, seinen Mitmenschen und der Schöpfung.
- Die Rolle des Unglaubens und der Selbstvermittlung in Luthers Sündenverständnis.
- Die Bedeutung der Sprachtheologie für die Erbsündenlehre bei Luther.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema und die Zielsetzung der Arbeit ein. Sie beschreibt Luthers Große Genesisvorlesung als exegetisches Werk und erläutert die Herangehensweise an die Analyse des Sündenbegriffs.
Kapitel 1 bietet einen Überblick über die Forschung zum Sündenfall in der Großen Genesisvorlesung. Es stellt die wichtigsten Arbeiten von Ulrich Asendorf und Tom Kleffmann vor, die sich mit Luthers exegetischen Methoden und seinem Verständnis der Sündenlehre befassen.
Kapitel 2 beleuchtet Luthers Sicht auf die Schöpfung vor dem Fall. Hierbei werden Aspekte wie die Schöpfung aus dem Nichts, die Imago Dei und die Rolle des Menschen als Herrscher über die nichtmenschliche Kreatur untersucht.
Kapitel 3 analysiert den Sündenfall selbst und untersucht die Rolle des Unglaubens und der Selbstvermittlung in Luthers Verständnis der Sünde.
Kapitel 4 befasst sich mit den Folgen des Sündenfalls für die Beziehung des Menschen zu Gott, seinen Mitmenschen und der Schöpfung.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: Sündenfall, Große Genesisvorlesung, Luther, Hermeneutik, Imago Dei, Unglaube, Selbstvermittlung, Sprachtheologie, Erbsünde, Schöpfung, Beziehung zu Gott, Beziehung zum Mitmenschen, Beziehung zur Schöpfung.
- Arbeit zitieren
- Daniel Steffen Schwarz (Autor:in), 2007, Das Sündenverständnis Martin Luthers in der Großen Genesis-Vorlesung (Gen 1-3), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428201