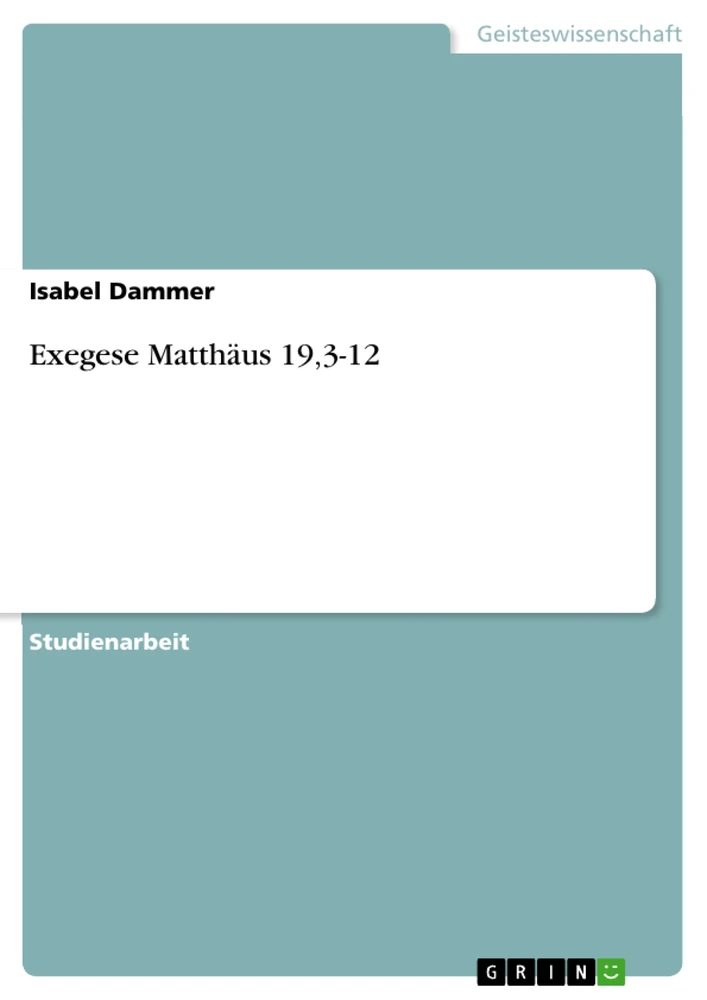Meine Motivation für die Auswahl dieser Bibelstelle ist durch einige Fragen zu beantworten. Warum hatte man damals ein so striktes Verständnis von der Ehe? Warum durften Männer ihre Frauen nur verlassen, wenn ein Fall von Unzucht vorlag? Durften auch Frauen ihre Männer aus diesem Grund verlassen? Musste man in der Ehe verharren, wenn die Liebe nicht mehr vorhanden ist?
Ich hoffe diese Fragen im Verlauf der Exegese beantworten zu können und mir ein tieferes Verständnis über diese Thematik zur Zeit Jesu aneignen zu können.
Diese Exegese schreibe ich im Rahmen des Seminars "Exegetisches Arbeiten" im zweiten Modul des Lehramtsstudiums in katholischer Religion. Für meine Exegese entschied ich mich für eine Bibelstelle im Matthäus Evangelium, in dem Jesus von den Pharisäern über die Ehe und Ehescheidung gefragt wird. Diese Bibelstelle war mir bisher nicht bekannt, jedoch fand ich in einem meiner Seminare, in dem wir das Matthäus Evangelium gelesen haben, Zugang zu ihr. Aus jetziger Sicht bin ich dankbar, dass ich die Bibelstelle vor einigen Jahren noch nicht kannte, da sich zu dieser Zeit meine Eltern getrennt haben und ich glaube, dass ich die Bibelstelle aus kindlicher Perspektive sehr ernst genommen hätte und eventuell andere Gründe, außer des von Jesu beschriebenen Fall von Unzucht, die zu einer Trennung führen können, nicht akzeptiert hätte.
Für die Exegese benutze ich die Einheitsübersetzung der Bibel, da mir diese persönlich zuspricht und ich mich mit deren Sprache und Ausdrucksweise identifizieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textsicherung
- Wirkungsgeschichtliche Reflexion
- Abgrenzung der Perikope
- Übersetzungsvergleich (Tabelle im Anhang)
- Sprachlich-sachliche Analyse des Textes
- Sozialgeschichtliche und historische Fragen und Realien
- Die Pharisäer
- Die Schöpfungsgeschichte
- Die Jünger/innen Jesu
- Soziale Rollen und soziale Situation von Frauen
- Textlinguistische Fragestellungen
- Basisoppositionen und Gegensatzpaare
- Spannungsbögen
- Tragende Begrifflichkeiten und semantische Felder
- Akteure
- Quantitäten
- Wiederholungen
- Pro-Formen
- Verknüpfungen
- Tempora
- Erzählbrüche
- Gliederung
- Kohärenz
- Die Aussageabsicht des Autors
- Form- und Gattungsanalyse
- Textpragmatische Analyse
- Kontextuelle Analyse (diachron)
- Traditionsgeschichte (die geistige Vorgeschichte des Textes)
- Synoptischer Vergleich im weiteren und im engeren Sinn
- Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkönzepts (synchron)
- Kompositionskritik
- Redaktionskritik
- Ergebnis, Fazit
- Religionspädagogischer/bibeldidaktischer Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Exegese von Matthäus 19,3-12 zielt darauf ab, die biblische Textstelle im Kontext ihrer historischen und sprachlichen Besonderheiten zu analysieren und zu interpretieren. Dabei soll die Exegese zu einem tieferen Verständnis der Aussage des Textes sowie der Themen Ehe, Ehescheidung und Enthaltsamkeit im Judentum des 1. Jahrhunderts gelangen.
- Die Rolle der Pharisäer in der Auseinandersetzung mit Jesus über die Ehe und die Ehescheidung
- Die Interpretation der Schöpfungsgeschichte im Kontext der Debatte um Ehescheidung
- Die Bedeutung von „Unzucht“ als Grund für die Ehescheidung im Matthäusevangelium
- Die verschiedenen Formen des Zölibats und ihre theologische Bedeutung
- Der Einfluss der Perikope auf die kirchengeschichtliche Diskussion um den Zölibat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Auswahl der Textstelle und die Motivation der Autorin für die Exegese. Das Kapitel „Textsicherung“ beschäftigt sich mit der Wirkungsgeschichte der Perikope, insbesondere im Kontext der Debatte um den Zölibat. Die Abgrenzung der Perikope wird im Hinblick auf den Makrokontext des Matthäusevangeliums analysiert. Im Kapitel „Sprachlich-sachliche Analyse des Textes“ werden die sozialgeschichtlichen und historischen Aspekte der Textstelle untersucht, einschließlich der sozialen Rollen von Frauen und Männern im 1. Jahrhundert. Die textlinguistischen Fragestellungen beleuchten die sprachlichen Besonderheiten des Textes, wie Basisoppositionen, Spannungsbögen und wichtige Begrifflichkeiten. Das Kapitel „Die Aussageabsicht des Autors“ untersucht die Form und Gattung des Textes sowie seine pragmatische Funktion. Im Kapitel „Kontextuelle Analyse (diachron)“ wird die Traditionsgeschichte der Textstelle sowie der synoptische Vergleich mit anderen Evangelien analysiert. Das Kapitel „Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkönzepts (synchron)“ betrachtet die Kompositions- und Redaktionskritik des Matthäusevangeliums im Hinblick auf die Perikope. Das Ergebnis und Fazit der Exegese sollen schließlich eine Interpretation des Textes und seiner zentralen Aussagen liefern.
Schlüsselwörter
Die Exegese von Matthäus 19,3-12 fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Ehe, Ehescheidung, Enthaltsamkeit, Zölibat, Unzucht, Pharisäer und Schöpfungsgeschichte. Die Untersuchung der Perikope im Kontext der damaligen Gesellschaft und der kirchengeschichtlichen Diskussionen über den Zölibat bietet wertvolle Einblicke in das Verständnis von Ehe und Ehescheidung im Judentum des 1. Jahrhunderts sowie in die Entwicklung der kirchlichen Lehre. Die exegetische Analyse dieser Bibelstelle liefert wichtige Beiträge zur Interpretation des Matthäusevangeliums und der christlichen Tradition.
- Citar trabajo
- Isabel Dammer (Autor), 2018, Exegese Matthäus 19,3-12, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428243