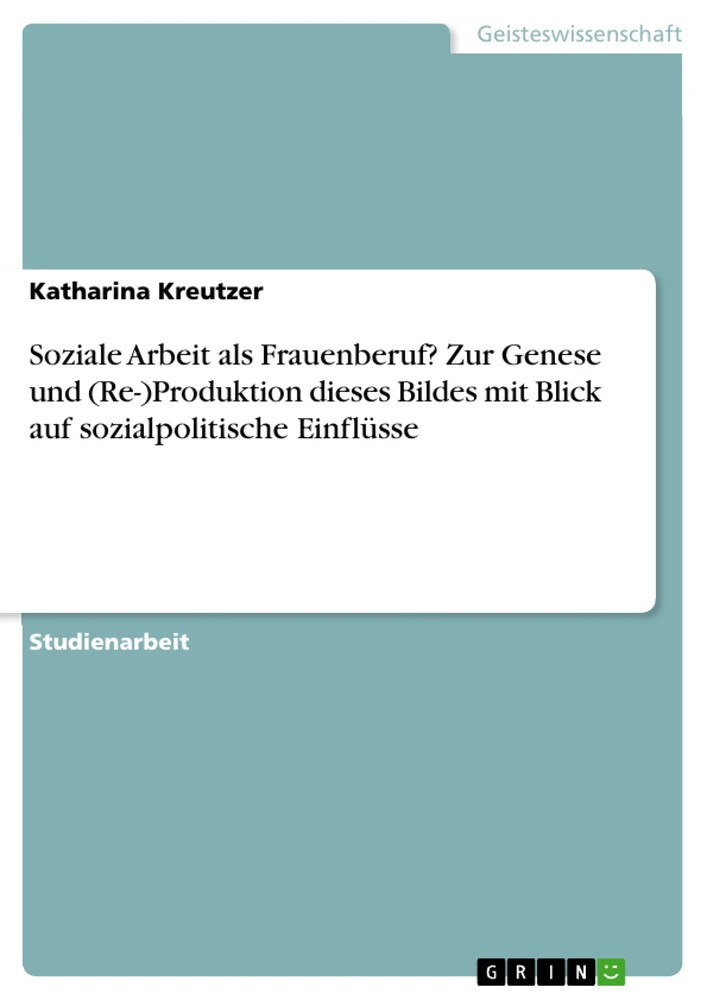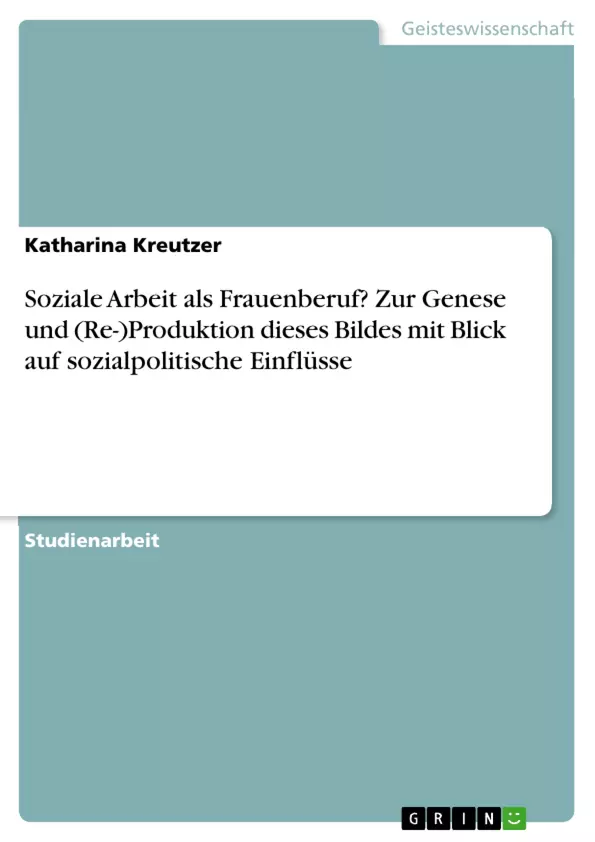Wenn der Mann wie die Frau vollkommen frei in ihrer Wahl sind, warum werden weiterhin nicht selten die Berufe gewählt, die im hegemonialen gesellschaftlichen Diskurs als „Frauen- oder Männerberufe“ gelten? Warum ist gerade die soziale Arbeit noch oft in Schrift und Sprache ein typischer „Frauenberuf“? Hat diese an Reflexion mangelnde Aussage heute noch Berechtigung?
Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll versucht werden, durch die historischen sozialpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Erklärungsansätze zu finden, warum der Sozialen Arbeit das Bild einer weiblichen Berufung anhaftet und durch welche Mechanismen dieses Bild aufrecht erhalten wird.
Zusätzlich soll ein Blick auf Männer in der Sozialen Arbeit und deren mögliche Benachteiligung geworfen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Arbeit: Von der Armenpflege zum Erwerbsberuf
- Zur Definition von Sozialpolitik
- Sozialer Umbruch als Folge der Industrialisierung
- ,,Soziale Mütterlichkeit“ – Die Frauenbewegung
- Zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Soziale Arbeit als Frauenberuf?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die historische Entwicklung und (Re-)Produktion des Bildes von Sozialer Arbeit als Frauenberuf im Kontext sozialpolitischer Einflüsse. Dabei werden die historischen Wurzeln der sozialen Arbeit und ihre Verbindung zum Sozialstaat sowie die Rolle der Frauenbewegung beleuchtet.
- Die Entstehung der Sozialen Arbeit im Kontext der Industrialisierung und der "sozialen Frage"
- Die Entwicklung von Sozialpolitik und ihre Bedeutung für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Die Rolle von "sozialer Mütterlichkeit" und die Etablierung des Bildes von Sozialer Arbeit als Frauenberuf
- Die Analyse von statistischen Daten zur Geschlechterverteilung in der Sozialen Arbeit
- Die (Re-)Produktion von Geschlechterrollen in der Sozialen Arbeit und die mögliche Benachteiligung von Männern.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die Problematik der Geschlechtersegregation in der Arbeitswelt und fragt nach den Ursachen für die anhaltende Prägung der Sozialen Arbeit als Frauenberuf.
- Kapitel 2 zeichnet die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit als Berufsbild im Kontext der Industrialisierung und der Entstehung des Sozialstaates nach. Es wird auf die Definition von Sozialpolitik und ihre Bedeutung für die Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme eingegangen.
- Kapitel 3 untersucht die Frage, inwieweit die Soziale Arbeit als Frauenberuf angesehen werden kann. Dabei werden statistische Daten zur Geschlechterverteilung analysiert und gesellschaftliche Verortung sowie die (Re-)Produktion von Geschlechterrollen in der Sozialen Arbeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Frauenberuf, Geschlechterrollen, Sozialpolitik, Industrialisierung, "soziale Frage", Sozialstaat, Mütterlichkeit, Professionalisierung, Geschlechtersegregation, Benachteiligung, Männer in der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Soziale Arbeit oft als „Frauenberuf“?
Dies liegt an historischen Wurzeln wie dem Konzept der „sozialen Mütterlichkeit“ aus der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts.
Wie entwickelte sich Soziale Arbeit zum Erwerbsberuf?
Der Wandel vollzog sich im Zuge der Industrialisierung und der Professionalisierung der Armenpflege hin zu einem staatlich regulierten Beruf.
Was bedeutet „soziale Mütterlichkeit“?
Es beschreibt das historische Rollenverständnis, nach dem Frauen aufgrund ihrer vermeintlich „natürlichen“ mütterlichen Eigenschaften besonders für soziale Aufgaben geeignet seien.
Werden Männer in der Sozialen Arbeit benachteiligt?
Die Arbeit untersucht, wie die Re-Produktion von Geschlechterrollen dazu führen kann, dass Männer in diesem Berufsfeld als untypisch wahrgenommen werden.
Welchen Einfluss hat die Sozialpolitik auf dieses Bild?
Sozialpolitische Entwicklungen und die Struktur des Sozialstaates haben die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in diesem Bereich maßgeblich geprägt.
- Quote paper
- Katharina Kreutzer (Author), 2018, Soziale Arbeit als Frauenberuf? Zur Genese und (Re-)Produktion dieses Bildes mit Blick auf sozialpolitische Einflüsse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428245