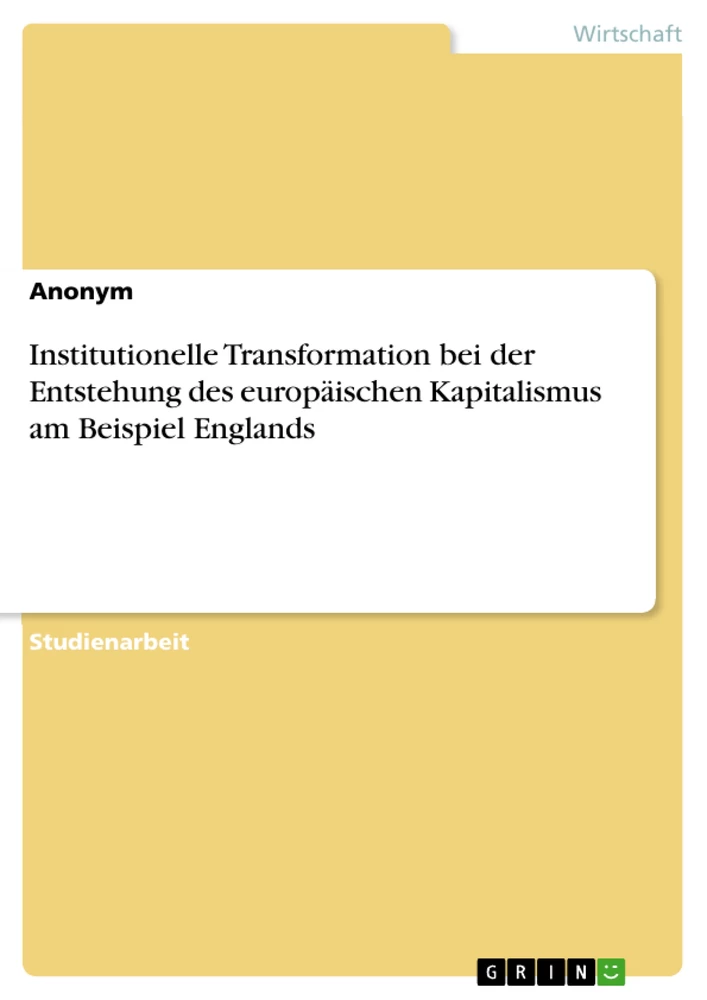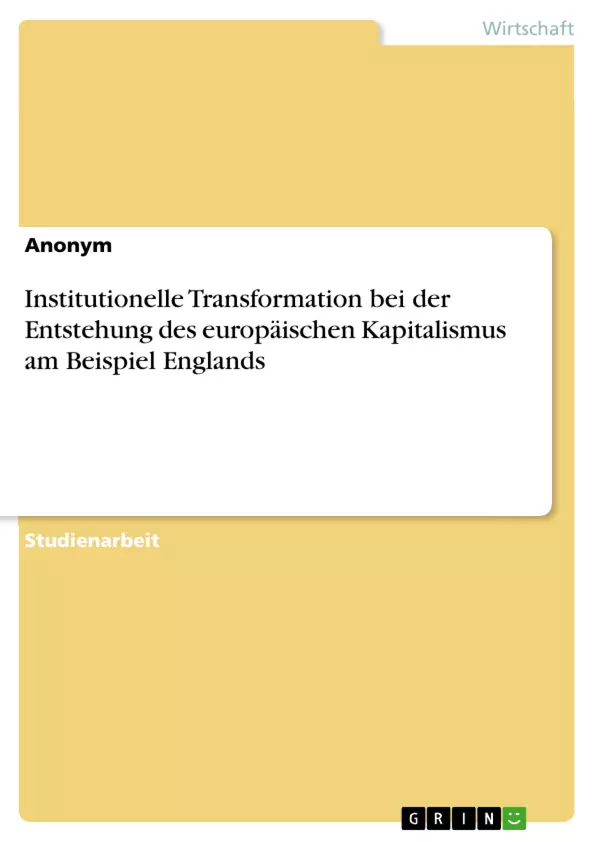In dieser Ausarbeitung werden die Thesen von North und Weingast näher betrachtet und erläutert. Zudem werden Gegenargumente miteinbezogen, gegenübergestellt, analysiert und kritisiert. Im Kontext ihrer These wird die Entwicklung Englands betrachtet. Allerdings können die historischen Ereignisse in England dabei nicht umfassend ausgearbeitet werden, da dies den Rahmen der Hausarbeit sprengen würde. Sie müssen daher als Grundwissen vorausgesetzt werden. Durch Einbeziehen der Gegenargumente von Tommaso Pavone wird die Frage der Plausibilität der Argumentation von North und Weingast (1989) beantwortet und schließlich durch Analyse möglicher Problematiken und Aufnahme, der bisher gesammelten Informationen, eine persönliche Stellungsnahme im Schlussteil geäußert. Das Fazit bietet darüber hinaus eine Zusammenfassung der genannten Argumentationen und stellt die Thesen knapp dar mit Blick auf ungelöste Probleme, die dieser Thematik zu Grunde liegen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Rolle politischer Institutionen und der Verfassung
- Institutionelle Veränderungen am Beispiel Englands im Zuge der „Glorreichen Revolution“
- Die „Glorreiche Revolution“ und ihre Auswirkungen auf garantierte Rechte
- Die fiskalische Revolution
- Institutionelle Innovationen
- Auswirkungen für private Kapitalmärkte
- Plausibilität der Argumentation von North und Weingast
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die institutionelle Transformation bei der Entstehung des europäischen Kapitalismus in England, basierend auf der Argumentation von North und Weingast. Ziel ist es, die Rolle politischer Institutionen und der Verfassung in diesem Prozess zu analysieren und die Plausibilität der These von North und Weingast zu bewerten.
- Die Rolle politischer Institutionen und der Verfassung in der Entwicklung des Kapitalismus
- Institutionelle Veränderungen in England während der Glorreichen Revolution
- Die Auswirkungen der fiskalischen Revolution auf die englischen Kapitalmärkte
- Bewertung der Argumentation von North und Weingast
- Analyse von Gegenargumenten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, die sich mit der institutionellen Transformation bei der Entstehung des europäischen Kapitalismus in England beschäftigt. Sie benennt die verwendete Literatur von North und Weingast als Grundlage der Analyse und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Thesen von North und Weingast erläutert, Gegenargumente einbezieht und schließlich eine persönliche Stellungnahme bietet. Der Fokus liegt auf der Rolle politischer Institutionen und der Verfassung sowie auf der Glorreichen Revolution als entscheidendes Ereignis. Die Arbeit berücksichtigt, dass eine umfassende historische Darstellung den Rahmen sprengen würde und setzt daher Grundwissen voraus.
Die Rolle politischer Institutionen und der Verfassung: North und Weingast betonen die Bedeutung von „Commitment“ für erfolgreiche Verhandlungen. Sie diskutieren Mechanismen zur Sicherung dieses „Commitment“, wie z.B. das Setzen von Beispielen verantwortungsvollen Verhaltens durch den Herrscher oder die Schaffung von Regeln, die Vertragsbrüche verhindern. Die politischen Institutionen und die Verfassung spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie den Staat einschränken und langfristiges Wachstum fördern oder behindern. Der Text untersucht die Rolle von Zwang, Einnahmeerhöhungen, Antizipation von Problemen und der Bedeutung von Reputation für die Einhaltung von Verträgen. Die Schaffung von Institutionen und Bestrafungsmechanismen wird als Mittel zur Stärkung der Reputation und zur Sicherung der Einhaltung von Verträgen dargestellt.
Institutionelle Veränderungen am Beispiel Englands im Zuge der „Glorreichen Revolution“: Dieser Abschnitt analysiert die institutionellen Veränderungen in England im Kontext der Glorreichen Revolution von 1688. Die Regierungsführung unter den Stuarts, mit ihren Überschreitungen der Einnahmen und den daraus resultierenden Konflikten mit dem Parlament, wird dargestellt. Die verschiedenen Methoden der Einnahmeerhöhung durch den König, wie z.B. „forced loans“ und der Verkauf von Monopolen, werden erläutert. Der Abschnitt hebt die Konflikte zwischen dem König und den Steuerzahlern hervor und zeigt, wie das Parlament versuchte, die Macht des Königs einzuschränken. Die Glorreiche Revolution wird als entscheidendes Ereignis dargestellt, welches diese Entwicklungen weiter prägte.
Schlüsselwörter
Institutionelle Transformation, Europäischer Kapitalismus, England, Glorreiche Revolution, North & Weingast, Politische Institutionen, Verfassung, Fiskalische Revolution, Commitment, Reputation, Private Kapitalmärkte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Institutionelle Transformation und Europäischer Kapitalismus in England
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die institutionelle Transformation bei der Entstehung des europäischen Kapitalismus in England, insbesondere die Rolle politischer Institutionen und der Verfassung in diesem Prozess. Sie analysiert die Argumentation von North und Weingast und bewertet deren Plausibilität.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Argumentation von North und Weingast und analysiert deren These anhand der institutionellen Veränderungen in England während der Glorreichen Revolution. Sie berücksichtigt auch Gegenargumente.
Welche Rolle spielen politische Institutionen und die Verfassung?
Politische Institutionen und die Verfassung spielen eine entscheidende Rolle, indem sie den Staat einschränken und langfristiges Wachstum fördern oder behindern. Sie beeinflussen die Möglichkeiten von „Commitment“ und die Einhaltung von Verträgen durch Mechanismen zur Sicherung dieses „Commitment“, z.B. das Setzen von Beispielen verantwortungsvollen Verhaltens oder die Schaffung von Regeln, die Vertragsbrüche verhindern.
Welche Bedeutung hat die Glorreiche Revolution?
Die Glorreiche Revolution von 1688 wird als entscheidendes Ereignis dargestellt, welches die institutionellen Veränderungen in England prägte. Sie wird im Kontext der vorherigen Regierungsführung unter den Stuarts und deren Konflikten mit dem Parlament analysiert.
Welche institutionellen Veränderungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die institutionellen Veränderungen in England, insbesondere die fiskalische Revolution, und deren Auswirkungen auf die privaten Kapitalmärkte. Methoden der Einnahmeerhöhung durch den König, wie z.B. „forced loans“ und der Verkauf von Monopolen, werden ebenso untersucht wie die Bemühungen des Parlaments, die Macht des Königs einzuschränken.
Welche Rolle spielen North und Weingast?
Die Arbeit basiert auf der Argumentation von North und Weingast, die die Bedeutung von „Commitment“ und Reputation für erfolgreiche Verhandlungen und die Entwicklung des Kapitalismus betonen. Die Arbeit bewertet die Plausibilität dieser These und berücksichtigt Gegenargumente.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind die Rolle politischer Institutionen und der Verfassung in der Entwicklung des Kapitalismus, institutionelle Veränderungen in England während der Glorreichen Revolution, die Auswirkungen der fiskalischen Revolution auf die englischen Kapitalmärkte, und eine kritische Bewertung der Argumentation von North und Weingast.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist aufgebaut mit einer Einleitung, einem Hauptteil (der die Rolle politischer Institutionen, die institutionellen Veränderungen in England, die fiskalische Revolution und deren Auswirkungen, sowie die Plausibilität der Argumentation von North und Weingast behandelt) und einem Fazit. Die einzelnen Kapitel werden in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Institutionelle Transformation, Europäischer Kapitalismus, England, Glorreiche Revolution, North & Weingast, Politische Institutionen, Verfassung, Fiskalische Revolution, Commitment, Reputation, Private Kapitalmärkte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Institutionelle Transformation bei der Entstehung des europäischen Kapitalismus am Beispiel Englands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428272