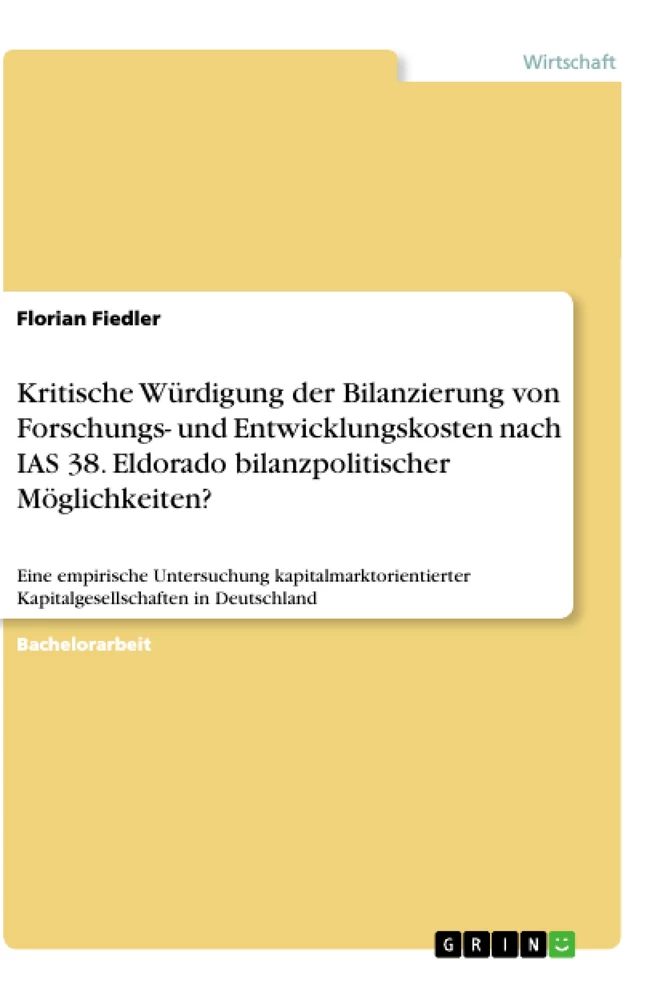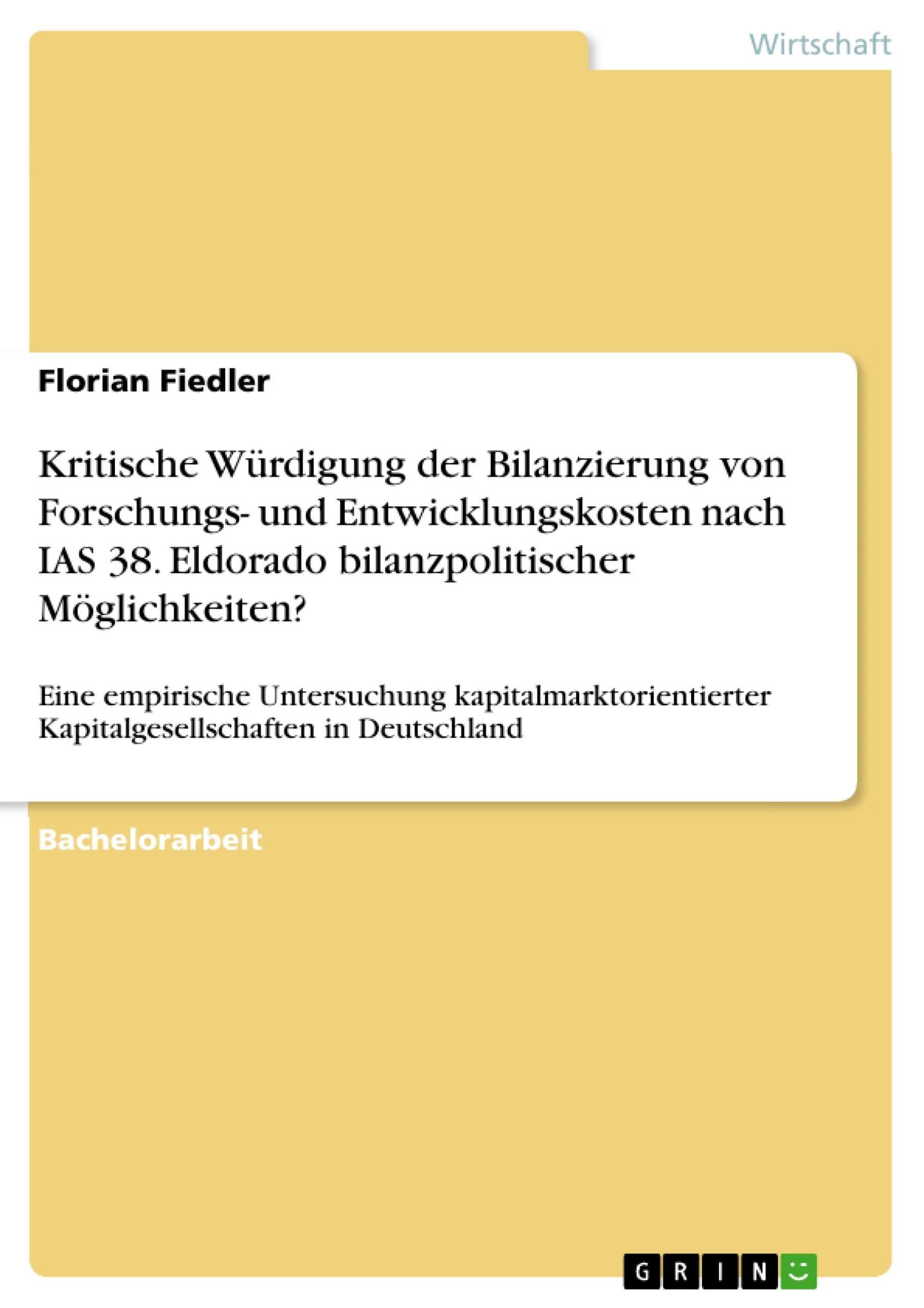Verkürzte Produktlebenszyklen, rasante technologische Fortschritte und der Einzug der Digitalisierung fordern von Unternehmen eine erhöhte Risikobereitschaft und immer neue Produktinnovationen in immer kürzerer Zeit ab. Insbesondere die Transformation der „Industrie- zur Wissensgesellschaft“ fördert dabei den Nimbus immaterieller Vermögenswerte als ökonomische Werttreiber. Der Forschung und Entwicklung kommt bei der Erstellung dieser eine herausragende Rolle zu. Im Kontext der gesamtwirtschaftlich wachsenden Bedeutung von Forschung und Entwicklung und den damit verbundenen steigenden Ausgaben auf Unternehmensebene stellt sich aus Sicht der Rechnungslegung die zentrale Frage, inwieweit die aktuellen Bilanzierungsvorschriften den Informationsbedürfnissen der Jahresabschlussadressaten bezüglich des „zentralen Erfolgsfaktor[s]“ der Zukunft nachkommen.
Tatsächlich herrscht im Rechnungswesen ein Dissens über den „richtigen“ Bilanzierungsansatz von Forschungs- und Entwicklungkosten. Während in der deutschen Rechnungslegung nach HGB Forschungsaufwendungen nicht aktiviert und Entwicklungskosten wahlweise bilanziert oder als Aufwand erfasst werden können, gilt beispielsweise nach US-GAAP grundsätzlich ein Aktivierungsverbot für Forschungs- und Entwicklungskosten. Die für die vorliegende Arbeit betrachteten IFRS hingegen schreiben eine zwingende Aktivierungspflicht für Entwicklungsaufwendungen bei Erfüllung spezifischer Kriterien vor. Tatsächlich stellen die vom IASB diktierten Vorschriften für selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte in ihrer Suche nach dem Ausgleich zwischen Relevanz und Objektivierung eine Kompromisslösung dar, die Anwendern eine Vielzahl bilanzpolitischer Gestaltungsräume gewährt. Der „heilige Gral des Rechnungswesens“ verkommt nach den Bilanzierungsvorschriften des IAS 38 somit zum „Eldorado bilanzpolitischer Möglichkeiten“ und konterkariert eines der Hauptziele der IFRS, nämlich Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen zu gewährleisten, erheblich.
Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei Zielsetzungen. Zum einen arbeitet sie im Rahmen einer theoretischen Analyse die Ursachen heraus, die bei der bilanziellen Ersterfassung von Forschungs- und Entwicklungskosten zu einem faktischen Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten führen. Zum anderen untersucht sie im Rahmen einer empirischen Untersuchung den Umgang IFRS-bilanzierender Unternehmen in Deutschland mit dem faktischen Aktivierungswahlrecht in praxi für die Geschäftsjahre 2012-2016.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Die Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten im Kontext bilanzpolitischer Gestaltungsmöglichkeiten
- 2.1 Grundlagen der Bilanzpolitik
- 2.1.1 Einordnung, Objekte und Träger der Rechnungslegungspolitik
- 2.1.2 Bilanzpolitisches Instrumentarium
- 2.2 Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38
- 2.2.1 Einordnung von Forschung und Entwicklung in den Anwendungsbereich des IAS 38
- 2.2.2 Bestimmung des Ansatzes von Forschungs- und Entwicklungskosten mithilfe der Vierstufenkonzeption
- 2.2.2.1 Erste Stufe – Allgemeine Definitionskriterien für Vermögenswerte
- 2.2.2.2 Zweite Stufe - Spezifische Definitions- und Ansatzkriterien für immaterielle Vermögenswerte
- 2.2.2.3 Dritte Stufe - Trennung von Forschungs- und Entwicklungsphase
- 2.2.2.4 Vierte Stufe - Ergänzende Ansatzkriterien für Entwicklungskosten
- 2.2.3 Zugangsbewertung
- 2.2.4 Ausweispflichten im Anhang
- 2.2.5 Einschränkung bilanzpolitischer Gestaltungsmöglichkeiten
- 2.3 Zwischenfazit
- 2.1 Grundlagen der Bilanzpolitik
- 3 Empirische Untersuchung zur aktuellen Rechnungslegungspraxis
- 3.1 Ziel der Untersuchung
- 3.2 Methodische Vorgehensweise
- 3.2.1 Bestimmung der Stichprobe
- 3.2.2 Datenerhebung
- 3.3 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- 3.3.1 Bedeutung von Forschung und Entwicklung
- 3.3.2 Aktivierungsverhalten
- 3.4 Kritische Würdigung der Untersuchung
- 4 Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38 und deren bilanzpolitische Gestaltungsmöglichkeiten. Die Arbeit analysiert die einschlägigen Vorschriften und untersucht empirisch die aktuelle Rechnungslegungspraxis kapitalmarktorientierter Unternehmen in Deutschland.
- Analyse der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38
- Bewertung der bilanzpolitischen Gestaltungsspielräume im Kontext von IAS 38
- Empirische Untersuchung der Rechnungslegungspraxis deutscher Unternehmen
- Kritische Würdigung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung
- Formulierung von Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten ein und beschreibt die Relevanz der Fragestellung im Kontext der Rechnungslegung und Bilanzpolitik. Es wird die Forschungslücke aufgezeigt und die Zielsetzung der Arbeit dargelegt. Die Problematik der potenziellen Manipulationsspielräume bei der Bilanzierung dieser Kosten wird angedeutet.
2 Die Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten im Kontext bilanzpolitischer Gestaltungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38. Es werden die einzelnen Stufen der Vierstufenkonzeption detailliert erläutert, beginnend mit allgemeinen Definitionskriterien für Vermögenswerte bis hin zu den ergänzenden Ansatzkriterien für Entwicklungskosten. Die Kapitel analysieren die Möglichkeiten und Einschränkungen bilanzpolitischer Gestaltung innerhalb des Rahmens des IAS 38. Die verschiedenen Aspekte der Zugangsbewertung und der Ausweispflichten im Anhang werden ebenso beleuchtet wie die Grenzen bilanzpolitischer Maßnahmen.
3 Empirische Untersuchung zur aktuellen Rechnungslegungspraxis: In diesem Kapitel wird die empirische Untersuchung zur aktuellen Rechnungslegungspraxis bezüglich der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten beschrieben. Es wird die Methodik der Studie detailliert dargelegt, einschließlich der Stichprobenziehung, Datenerhebung und der statistischen Auswertung der Ergebnisse. Die Ergebnisse zur Bedeutung von Forschung und Entwicklung in den untersuchten Unternehmen sowie deren Aktivierungsverhalten werden analysiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Forschungs- und Entwicklungskosten, IAS 38, Bilanzpolitik, Rechnungslegung, Immaterielle Vermögenswerte, Empirische Untersuchung, Kapitalmarkt, Deutschland, Aktivierung, Bilanzierungspraxis.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38 und die damit verbundenen bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten. Sie analysiert die relevanten Vorschriften und untersucht empirisch die aktuelle Rechnungslegungspraxis deutscher kapitalmarktorientierter Unternehmen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Analyse der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38, eine Bewertung der bilanzpolitischen Gestaltungsspielräume im Kontext von IAS 38, eine empirische Untersuchung der Rechnungslegungspraxis deutscher Unternehmen, eine kritische Würdigung der empirischen Ergebnisse und die Formulierung von Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung, Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38 (inklusive der Vierstufenkonzeption), Kapitel 3 präsentiert die empirische Untersuchung zur aktuellen Rechnungslegungspraxis und Kapitel 4 fasst die Ergebnisse thesenförmig zusammen.
Was sind die zentralen methodischen Ansätze?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analyse mit empirischer Forschung. Kapitel 2 basiert auf der Auswertung der relevanten Literatur und des IAS 38. Kapitel 3 beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Untersuchung, einschließlich Stichprobenziehung, Datenerhebung und Auswertung.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die empirische Untersuchung analysiert die Bedeutung von Forschung und Entwicklung in den untersuchten Unternehmen und deren Aktivierungsverhalten. Die konkreten Ergebnisse werden im Kapitel 3 detailliert dargestellt und interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Forschungs- und Entwicklungskosten, IAS 38, Bilanzpolitik, Rechnungslegung, Immaterielle Vermögenswerte, Empirische Untersuchung, Kapitalmarkt, Deutschland, Aktivierung, Bilanzierungspraxis.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen werden im letzten Kapitel (Kapitel 4) thesenförmig zusammengefasst. Details zu den Schlussfolgerungen sind im Text der Arbeit nachzulesen.
Welche Zielgruppe spricht die Arbeit an?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten, Bilanzpolitik und Rechnungslegung im Kontext von IAS 38 auseinandersetzen, insbesondere an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Finanzberichterstattung.
Wo finde ich die detaillierten Informationen?
Die vollständigen Details zur Methodik, den Ergebnissen und den Schlussfolgerungen der Arbeit sind im Haupttext der Bachelorarbeit enthalten, welcher die Kapitel im Detail ausführt.
- Quote paper
- Florian Fiedler (Author), 2017, Kritische Würdigung der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten nach IAS 38. Eldorado bilanzpolitischer Möglichkeiten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428426