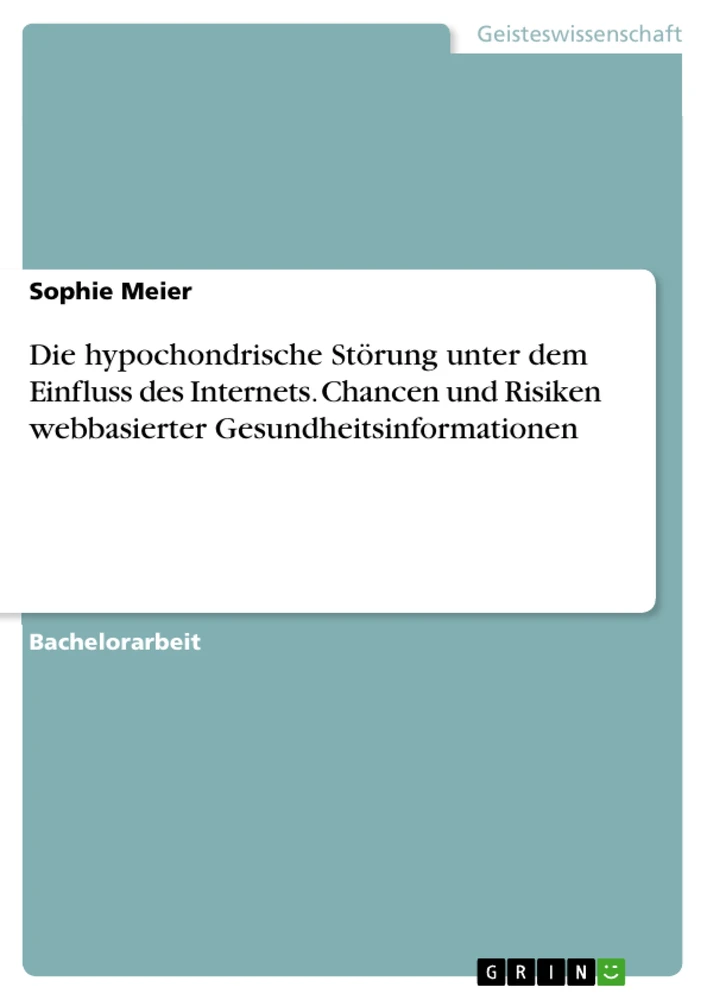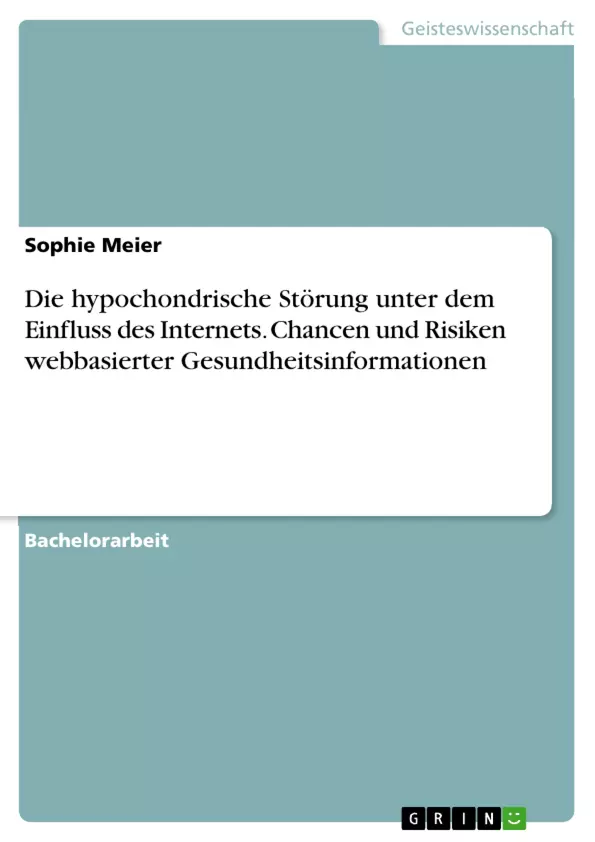Speziell im Gesundheitsbereich ist das Internet zu einer der wichtigsten Anlaufstellen geworden. Der Arzt oder Apotheker ist nicht länger grundsätzlich der erste Ansprechpartner, häufig wird zunächst "Dr. Google" bei gesundheitlichen Themen aufgesucht. Medizinische Laien erlangen auf diese Weise Zugang zu Informationen, die ihnen dabei helfen, Unsicherheiten ihres eigenen Gesundheitszustandes zu begrenzen. Außerdem fühlen sich Personen aufgrund dieser Wissenssteigerung in der Lage, in gesundheitlichen Fragen zunehmend Selbstverantwortung zu übernehmen.
Das Angebot gesundheitsbezogener Online-Informationen wächst stetig, ebenso wie ihre Nutzer: 63,5% der deutschen Internetnutzer greifen einer bevölkerungsrepräsentativen Studie zufolge bei Gesundheitsfragen auf das Medium zurück. Damit rangiert es auf einer Stufe mit Ratgebern im Fernsehen, Printmedien und Hörfunk. Die Möglichkeiten, gesundheitsrelevante Daten zu beziehen, reichen dabei von Recherchen über Suchmaschinen, Gesundheitsforen, in denen sich Personen mit anderen Betroffenen oder Experten austauschen können, bis hin zu allgemeinen und spezifischen Gesundheitsportalen.
Gleichzeitig entsteht hierdurch eine Diskussion über die potenziellen negativen Konsequenzen dieser neuen Perspektiven. Um eine Übergewichtung der gewinnbringenden Effekte zu erreichen, benötigt es einen kompetenten Umgang mit den digitalen Informationsquellen. Wissenschaftliche Publikationen stehen den Nutzern im Internet zwar in großem Maße zur Verfügung, doch diesen qualitativ hochwertigen Daten stehen zunehmend auch fragwürdige, mangelhafte oder einseitige Quellen gegenüber. Nur wenige Webseiten werden einer redaktionellen Prüfung unterzogen. Somit können Risiken entstehen, beispielsweise Überforderungen durch die Vielzahl an webbasierten Gesundheitsinformationen und negative Folgen bei Gesundheitsentscheidungen, beruhend auf Desinformation und fehlendem Fachwissen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Das Störungsbild der Hypochondrie
- Historische Entwicklung
- Klassifikation und Diagnosekriterien
- Differentialdiagnosen
- Theoretische Erklärungsmodelle
- Das Medium Internet
- E-Health
- Qualitätssicherung gesundheitsbezogener Webinformationen
- Informationsquellen im Internet
- Fragestellungen
- Methodenteil
- Vorgehensweise
- Ergebnisteil
- Ergebnis: Untersuchung von Effekten webbasierter Einfluss-faktoren auf hypochondrische Patienten
- Verarbeitung gesundheitsrelevanter Informationen
- Phänomen „Cyberchondrie“
- Studie zur Suche nach Gesundheitsinformationen im Internet: Wer sucht was, wann und wie?
- Studie zur Nutzung gesundheitsbezogener Internetdienste bei psychischen Problemen
- Längsschnittstudie zur wechselseitigen Beziehung von Gesundheitsangst und der gesundheitsbezogenen Recherche im Internet
- Studie zur Nutzung gesundheitsbezogener Internetdienste bei hypochondrischen und nicht hypochondrischen Nutzern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Hypochondrischen Störung unter dem Einfluss des Internets. Sie untersucht die Chancen und Risiken webbasierter Gesundheitsinformationen für Menschen mit Hypochondrie. Dabei werden die potenziellen Vorteile, wie z.B. der Zugang zu medizinischem Wissen und der Austausch mit anderen Betroffenen, sowie die möglichen Nachteile, wie z.B. die Gefahr der Überforderung mit Informationen und die Verbreitung von Fehlinformationen, beleuchtet.
- Das Störungsbild der Hypochondrie
- Das Medium Internet und seine Bedeutung im Gesundheitsbereich
- Die Nutzung gesundheitsbezogener Webinformationen durch Menschen mit Hypochondrie
- Die Auswirkungen von webbasierten Gesundheitsinformationen auf Hypochonder
- Die Rolle der „Cyberchondrie“ in der Hypochondrischen Störung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hypochondrischen Störung im Kontext des Internets ein und beleuchtet die wachsende Bedeutung des Internets im Gesundheitsbereich. Kapitel 1 bietet einen Überblick über das Störungsbild der Hypochondrie, einschließlich seiner historischen Entwicklung, Klassifikation und Diagnosekriterien sowie theoretischer Erklärungsmodelle. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Medium Internet und seinen spezifischen Eigenschaften im Gesundheitsbereich. Es werden die Themenbereiche E-Health, Qualitätssicherung von Webinformationen und verschiedene Informationsquellen im Internet behandelt. Kapitel 3 erläutert die Fragestellungen, die im Rahmen der Arbeit untersucht werden. Der Methodenteil (Kapitel 4) beschreibt die Vorgehensweise bei der Erhebung und Auswertung der Daten. Der Ergebnisteil (Kapitel 5) präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung von Effekten webbasierter Einflussfaktoren auf hypochondrische Patienten. Es werden verschiedene Studien und Forschungsbefunde hinsichtlich der Verarbeitung gesundheitsrelevanter Informationen, des Phänomens „Cyberchondrie“ und der Nutzung von Gesundheitsinformationen im Internet durch Menschen mit Hypochondrie diskutiert. Das Fazit (Kapitel 6) fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Hypochondrische Störung, Internet, E-Health, Gesundheitsinformationen, Cyberchondrie, Informationsverarbeitung, Qualitätssicherung, Informationsquellen, Gesundheitsangst, Online-Gesundheitsdienste, Hypochonder, Nicht-Hypochonder, webbasierte Einflussfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Cyberchondrie"?
Cyberchondrie bezeichnet die Steigerung von Gesundheitsängsten durch die exzessive Recherche von Krankheitssymptomen im Internet.
Welche Risiken birgt das Internet für Hypochonder?
Die Fülle an ungeprüften Informationen kann zu Überforderung führen. harmlose Symptome werden oft mit schweren Krankheiten assoziiert, was den psychischen Druck erhöht.
Welche Chancen bieten webbasierte Gesundheitsinformationen?
Sie ermöglichen Patienten einen schnellen Zugang zu medizinischem Wissen, fördern die Selbstverantwortung und bieten Austauschmöglichkeiten in Foren mit anderen Betroffenen.
Wie beeinflusst "Dr. Google" das Arzt-Patienten-Verhältnis?
Patienten treten Ärzten oft mit Vorwissen (oder Halbwissen) gegenüber, was zu einer partnerschaftlicheren Beziehung führen kann, aber auch zu Konflikten, wenn Online-Infos die ärztliche Diagnose infrage stellen.
Warum ist Qualitätssicherung bei Gesundheitsportalen wichtig?
Da viele Webseiten keiner redaktionellen Prüfung unterliegen, besteht die Gefahr der Desinformation. Seriöse Quellen sollten durch Transparenz und Fachkompetenz gekennzeichnet sein.
- Citar trabajo
- Sophie Meier (Autor), 2017, Die hypochondrische Störung unter dem Einfluss des Internets. Chancen und Risiken webbasierter Gesundheitsinformationen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428429