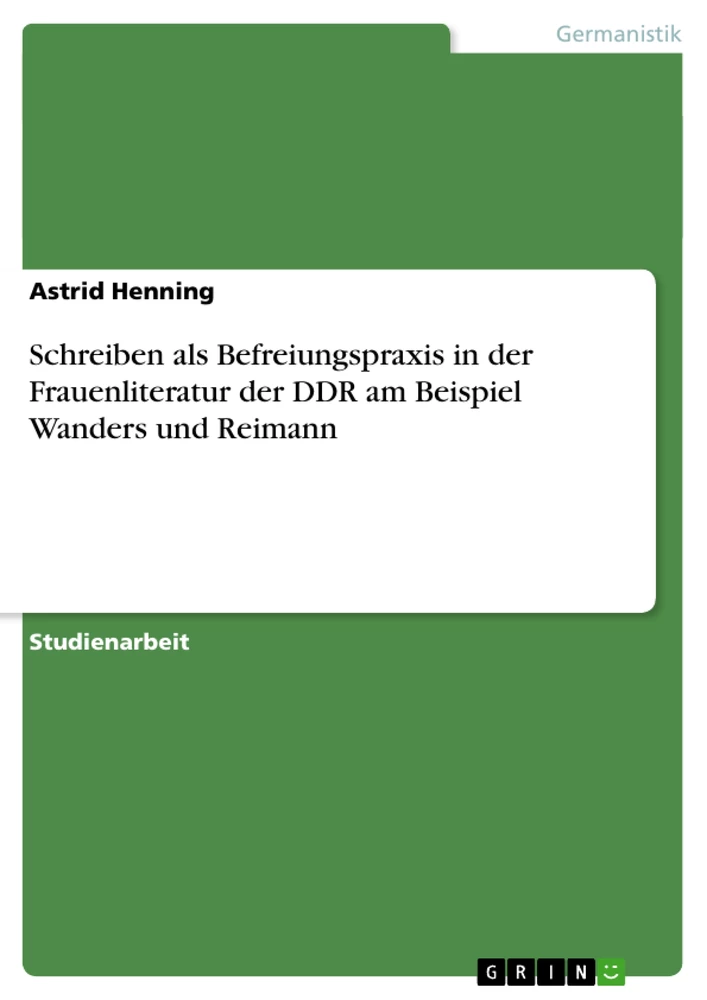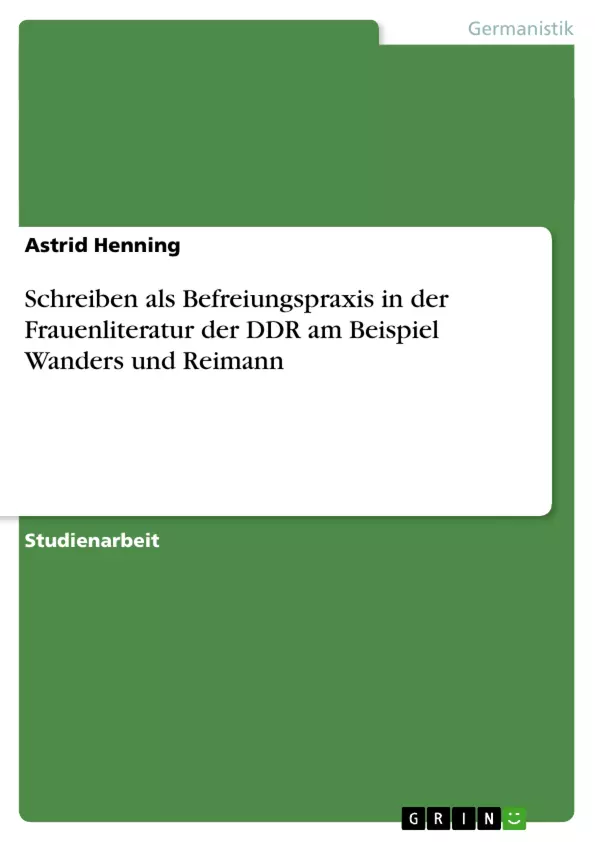Nach einer Darstellung und einer Kritik des feministischen Diskurses von der Befreiung durch und in der Literatur sollen zwei Beispiele von DDR-Frauenliteratur in Bezug auf diesen Diskurs der 70er Jahre untersucht werden. Es scheint dabei vielleicht befremdlich, daß die theoretischen Grundlage zwei Texte aus der BRD, bzw. aus den USA sind, die konkreten Rezeptionen jedoch aus der DDR. Ich bin jedoch der Meinung, daß der feministische Diskurs „Das private ist politisch“ in der Literatur in den 1970er Jahren nicht an nationalen Grenzen Halt machte.2 Obwohl es in der DDR kaum theoretische Auseinandersetzungen (oder ihre schriftliche Fixierung) über die Thematik „weibliches Schreiben“ gibt, hat doch die politische und ökonomische Veränderung innerhalb Europas und Nordamerikas diskursbildend auf die deutschsprachigen Künstlerinnen beiderseits der Elbe Einfluß gehabt. Inwieweit sich diese feministischen Ideen bei den Frauen der DDR und ihrer Literatur niederschlugen oder sich verwandelten, daß soll in dieser Arbeit aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Diskurstypische Texte weiblichen Schreibens in den 70er Jahren
- II.1. Blut, Brot und Dichtung – der Standort der Dichterin von Adrienne Rich
- II.2. Regine Othmar-Vetter: „Weibliches Schreiben“
- III. Weibliches Schreiben als Befreiung und Identitätsfindung in der Frauenliteratur der DDR (1970er Jahre)
- III.1. Maxie Wanders „Guten Morgen, Du Schöne“
- III.2. Brigitte Reimanns Erzählung „Geschwister“
- IV. Fazit: Was und wen befreite weibliches Schreiben in der DDR?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung weiblichen Schreibens als Befreiungspraxis in der Frauenliteratur der DDR der 1970er Jahre. Sie analysiert, wie ökonomische und politische Veränderungen die Selbstwahrnehmung von Frauen beeinflussten und sich in ihrer Literatur niederschlugen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen westlichen feministischen Diskursen und deren Rezeption in der DDR.
- Weibliches Schreiben als Ausdruck von Befreiung und Identitätsfindung
- Der Einfluss des feministischen Diskurses „Das Private ist politisch“ auf die DDR-Literatur
- Die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten weiblichen Schreibens im Kontext der DDR
- Vergleichende Analyse von Texten aus der DDR und dem Westen
- Die Rolle der Literatur im Prozess der weiblichen Emanzipation
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext dar: die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende ökonomische Integration von Frauen und ihre Auswirkungen auf deren Selbstverständnis und literarisches Schaffen. Sie hebt den Unterschied zwischen der westlichen und der DDR-spezifischen Erfahrung der weiblichen Emanzipation hervor, wobei die DDR-Emanzipation als Staatsziel deklariert wurde, jedoch die Mehrfachbelastung der Frauen in Familie und Beruf weiterhin bestand. Die Arbeit kündigt die Analyse von Texten von Maxie Wanders und Brigitte Reimann an, um die spezifischen Ausprägungen weiblichen Schreibens in der DDR zu beleuchten.
II. Diskurstypische Texte weiblichen Schreibens in den 70er Jahren: Dieses Kapitel analysiert zwei Texte, die den feministischen Diskurs der Zeit repräsentieren: Adrienne Richs „Blut, Brot und Dichtung“ und Regine Othmar-Vetters Aufsatz zum „Weiblichen Schreiben“. Richs Text zeigt die Entwicklung der Autorin von einer Trennung zwischen politischem und poetischem Schreiben hin zur Integration beider Aspekte, untermauert durch die Erkenntnis, dass das Private politisch ist. Othmar-Vetters Beitrag beleuchtet weitere Aspekte des weiblichen Schreibens, die für den Kontext der Arbeit relevant sind und den theoretischen Hintergrund für die folgenden Analysen von Texten der DDR-Autorinnen liefern.
III. Weibliches Schreiben als Befreiung und Identitätsfindung in der Frauenliteratur der DDR (1970er Jahre): Dieses Kapitel analysiert die Werke von Maxie Wanders („Guten Morgen, Du Schöne“) und Brigitte Reimann („Geschwister“) im Kontext des feministischen Diskurses. Es untersucht, wie diese Autorinnen die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten weiblichen Schreibens in der DDR literarisch verarbeiteten, und wie sie sich mit den Themen der Mehrfachbelastung, der Identitätsfindung und der Emanzipation auseinandersetzten. Die Analysen zeigen die unterschiedlichen Strategien und Herangehensweisen der beiden Autorinnen auf, während sie gleichzeitig die Gemeinsamkeiten und die Auseinandersetzung mit den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten der DDR aufzeigen.
Schlüsselwörter
Frauenliteratur DDR, weibliches Schreiben, Emanzipation, Feminismus, Identitätsfindung, Mehrfachbelastung, sozialistischer Realismus, „Das Private ist politisch“, Maxie Wanders, Brigitte Reimann, Adrienne Rich, Regine Othmar-Vetter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Weibliches Schreiben in der DDR der 1970er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung weiblichen Schreibens als Befreiungspraxis in der Frauenliteratur der DDR der 1970er Jahre. Sie analysiert, wie ökonomische und politische Veränderungen die Selbstwahrnehmung von Frauen beeinflussten und sich in ihrer Literatur niederschlugen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich zwischen westlichen feministischen Diskursen und deren Rezeption in der DDR.
Welche Autorinnen und Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Texte von Maxie Wanders („Guten Morgen, Du Schöne“) und Brigitte Reimann („Geschwister“) aus der DDR, sowie Adrienne Richs „Blut, Brot und Dichtung“ und Regine Othmar-Vetters Aufsatz zum „Weiblichen Schreiben“ aus dem westlichen Kontext. Diese Texte dienen als Beispiele für die unterschiedlichen Ausprägungen weiblichen Schreibens und die Auseinandersetzung mit feministischen Diskursen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie weibliches Schreiben als Ausdruck von Befreiung und Identitätsfindung, den Einfluss des feministischen Diskurses „Das Private ist politisch“ auf die DDR-Literatur, die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten weiblichen Schreibens in der DDR, die Mehrfachbelastung von Frauen, und die Rolle der Literatur im Prozess der weiblichen Emanzipation.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Die Analyse vergleicht Texte aus der DDR und dem Westen und untersucht, wie die Autorinnen die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten weiblichen Schreibens in der DDR literarisch verarbeiteten. Es werden die unterschiedlichen Strategien und Herangehensweisen der Autorinnen betrachtet, sowie die Gemeinsamkeiten und die Auseinandersetzung mit den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten der DDR.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Frauenliteratur DDR, weibliches Schreiben, Emanzipation, Feminismus, Identitätsfindung, Mehrfachbelastung, sozialistischer Realismus, „Das Private ist politisch“, Maxie Wanders, Brigitte Reimann, Adrienne Rich, Regine Othmar-Vetter.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu diskurstypischen Texten weiblichen Schreibens in den 70er Jahren (mit Analyse von Rich und Othmar-Vetter), ein Kapitel zum weiblichen Schreiben als Befreiung und Identitätsfindung in der DDR-Literatur der 70er Jahre (mit Analyse von Wanders und Reimann) und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen erleichtern die Orientierung.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzenden ökonomischen Integration von Frauen und deren Auswirkungen auf deren Selbstverständnis und literarisches Schaffen. Sie hebt den Unterschied zwischen der westlichen und der DDR-spezifischen Erfahrung der weiblichen Emanzipation hervor, wobei die DDR-Emanzipation als Staatsziel deklariert wurde, die Mehrfachbelastung der Frauen jedoch weiterhin bestand.
- Quote paper
- Astrid Henning (Author), 2003, Schreiben als Befreiungspraxis in der Frauenliteratur der DDR am Beispiel Wanders und Reimann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42850