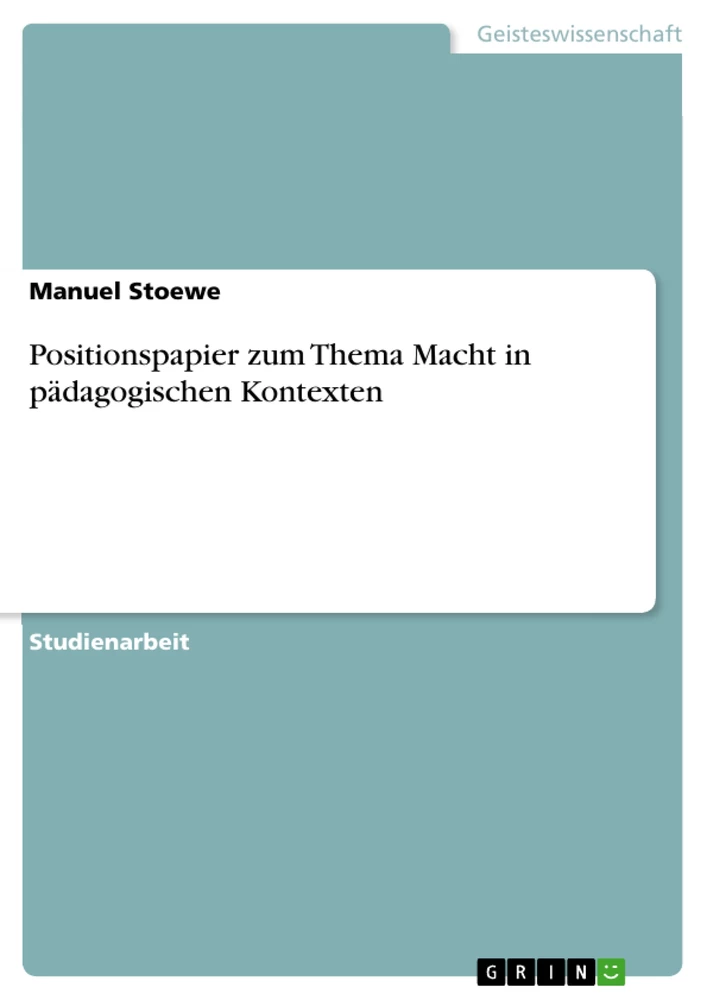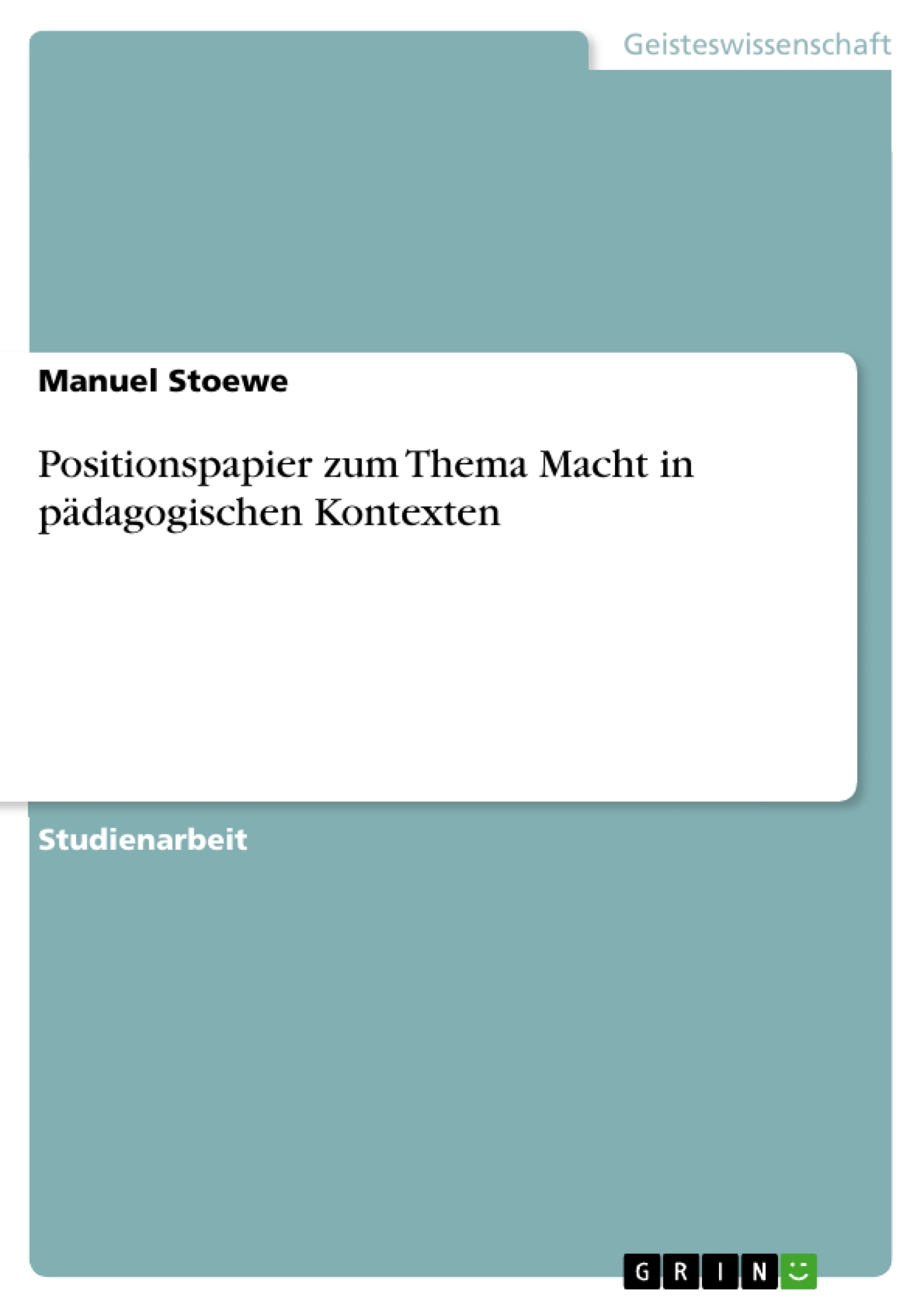In der Pädagogik ist eine der prekärsten Fragen, die Frage nach der Machtausübung. Das Thema der Macht zieht sich wie ein roter Faden durch die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen aber auch jungen Erwachsenen. Die Bereiche, in denen im Kontext der Erziehung Macht eine Rolle spielt sind sehr vielseitig. So scheint sich Erziehung oftmals als ein Machtkampf zwischen Heranwachsenden und Erziehenden darzustellen. Hierbei kann es sich mal mehr um einen demokratischen Aushandlungsprozess und mal mehr um einen Kampf alleine um der Macht Willen handeln. Aber auch im professionellen Kontext der Sozialen Arbeit scheint die Frage nach Macht in der Kinder- und Jugendhilfe von großer Bedeutung. Dies zeigt sich z.B. in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aber auch in der Arbeit mit deren Eltern. Dies ist nicht nur der Fall wenn es z.B. um alltägliche Fragen nach der Erziehung des stationär untergebrachten Kindes geht, sondern auch bei der Frage nach einer Kindeswohlgefährdung und dessen Inobhutnahme. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser tiefen Verstrickungen mit der Thematik der Macht scheint dieses Thema häufig gemieden zu werden. Da im Pädagogischen Kontext aber durchaus Machtverhältnisse zum Tragen kommen, scheint eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik essentiell für die pädagogische Arbeit.
In dieser Arbeit sollen zwei Texte bearbeitet werden, welche sich mit Macht im Kontext von Pädagogik auseinandersetzen. Der erste Text, ein Artikel aus einer Fachzeitschrift für Jugendhilfe, befasst sich mit der Legitimationsfrage für ein Machtdifferential innerhalb der Pädagogik. Der zweite Text befasst sich mit der Machtanalyse Michel Foucaults und überträgt diese Überlegungen auf die Pädagogik. Zuerst sollen die beiden Texte dargestellt und deren Standpunkte dargelegt werden. Anschließend erfolgt eine Beurteilung der beiden dargestellten Sichtweisen und deren Bedeutung für die Pädagogik. Abschließend erfolgt eine persönliche Einschätzung im Bezug auf die Frage nach den Machtverhältnissen in der Pädagogik und deren Bedeutung für die Praxis. Hierbei wird unter anderem auf den Ansatz der Lebensweltorientierung verwiesen und dessen Anwendbarkeit auf die Klärung der Machtfrage in der Praxis der Pädagogik untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Auswertung der Literatur
- 2.1 Zusammenfassung des Artikels von Klaus Wolf
- 2.2 Zusammenfassung des Beitrags von Alfred Schäfer
- 2.3 Diskussionsteil
- 3.0 These...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Macht im Kontext von Pädagogik und analysiert zwei Texte, die sich mit der Legitimationsfrage für ein Machtdifferential innerhalb der Pädagogik und der Machtanalyse von Michel Foucault in pädagogischen Kontexten auseinandersetzen. Sie untersucht die Bedeutung der Machtverhältnisse für die pädagogische Arbeit und bezieht den Ansatz der Lebensweltorientierung auf die Klärung der Machtfrage in der Praxis der Pädagogik.
- Machtausübung und ihre Legitimation in pädagogischen Kontexten
- Analyse von Machtquellen und -verhältnissen in der Erziehung
- Die Rolle der Lebensweltorientierung bei der Bewältigung von Machtkonflikten
- Bedeutung von Wissen und Orientierung für pädagogische Interventionen
- Kritik an normativen Ansätzen in der Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
2.1 Zusammenfassung des Artikels von Klaus Wolf
Der Artikel von Klaus Wolf aus der Fachzeitschrift "Evangelische Jugendhilfe 2000" befasst sich mit der Legitimation von Machtanwendung im pädagogischen Kontext. Wolf analysiert verschiedene Aspekte der Macht, der Machtbalance und der Machtquellen auf der Grundlage einer Definition von Norbert Elias. Er beschreibt die verschiedenen Aspekte und wechselseitigen Abhängigkeiten innerhalb von Machtverhältnissen in pädagogischen Kontexten und begründet eine Legitimationsverpflichtung.
Wolf untersucht zunächst die Aspekte der Macht, der Machtausübung und der Machtbalance und zitiert dabei Elias Definition von Macht: „Insofern als wir mehr von anderen abhängen als sie von uns, mehr auf andere angewiesen sind als sie auf uns, haben sie Macht über uns, ob wir nun durch nackte Gewalt von ihnen abhängig geworden sind oder durch unsere Liebe oder durch unser Bedürfnis, geliebt zu werden, durch unser Bedürfnis nach Geld, Gesundung, Status, Karriere und Abwechslung“ (Elias 1986: 97).
Im Rahmen einer Analyse von Machtquellen in Erzieherischen Kontexten, die sich auf die stationäre Heimunterbringung bezieht, hebt Wolf unter anderem die Orientierungsmittel als eine Quelle des Machtdifferentials hervor. Er argumentiert, dass Erzieherinnen aufgrund ihres Wissens, das den Kindern und Jugendlichen fehlt, ein Machtgefälle besitzen. Dieses Wissen hilft den Kindern, sich in der Welt besser zu orientieren und vor Gefahren zu schützen.
Eine weitere Ursache für das Vorhandensein eines Machtdifferentials sei die körperliche Stärke. Wolf argumentiert, dass es für Kinder unerlässlich sei, vor gewissen Gefahren unter Einsatz von körperlichem Zwang bewahrt zu werden. Ziel hierbei sei das Überleben des Kindes zu sichern und es einen Status erreichen zu lassen, in dem es nicht mehr auf körperlich ausgeübte Zwänge angewiesen ist, sondern sich selbst kontrollieren kann. Das Kind soll also lernen „auf sich selbst Zwang auszuüben“ (Wolf 2000: 5).
Wolf schlussfolgert, dass ein Machtdifferential in pädagogischen Kontexten erforderlich ist, um Kinder und Jugendliche zu schützen und erziehen zu können. Grundlage dieses Machtdifferentials seien unter anderem körperliche Überlegenheit als auch Orientierungshilfen (Wissen). Eine Legitimation sei durch die Notwendigkeit allein aber noch nicht geleistet.
Wolf beginnt seine Gedanken bezüglich einer Legitimierung mit der Andeutung, dass jegliche „pädagogische Intervention als vorenthaltenes Lebensglück,,(Wolf 2000: 7) verstanden werden könne. Auf der Grundlage dieses Gedankens betont er, dass jegliche Intervention durch die Frage nach dem Nutzen für das Kind oder den Jugendlichen zu legitimieren sei. Dabei gelte nicht, was die Pädagoginnen generell für wichtig erachten, sondern die persönlichen Probleme und Wünsche der AdressatInnen zu berücksichtigen. Kinder seien nicht alle mittels einer normativen „Schablone\" (ebd. 8) zu erziehen, sondern unter Berücksichtigung ihrer Individualität.
Schlüsselwörter
Macht, Pädagogik, Machtdifferential, Legitimation, Machtquellen, Lebensweltorientierung, Erziehungsarbeit, Kinder, Jugendliche, Heimunterbringung, Orientierungsmittel, körperlicher Zwang, Moral, Individualität.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Macht in der Pädagogik ein notwendiges Thema?
Pädagogik beinhaltet immer ein Machtgefälle zwischen Erziehenden und Heranwachsenden. Eine Auseinandersetzung damit ist essenziell, um Machtmissbrauch zu verhindern und professionelles Handeln zu legitimieren.
Wie legitimiert Klaus Wolf das Machtdifferential in der Erziehung?
Wolf argumentiert, dass Macht durch den Nutzen für das Kind legitimiert werden muss, etwa durch Schutz vor Gefahren oder die Vermittlung von Wissen zur besseren Orientierung in der Welt.
Was sind typische Machtquellen in pädagogischen Kontexten?
Zu den Machtquellen zählen unter anderem Wissensvorsprung (Orientierungsmittel), körperliche Überlegenheit sowie die Kontrolle über Ressourcen und Status innerhalb einer Institution.
Welche Rolle spielt die Lebensweltorientierung bei der Machtfrage?
Lebensweltorientierung fordert, die individuellen Probleme und Wünsche der Adressaten ernst zu nehmen, statt sie nach einer normativen "Schablone" zu erziehen, was das Machtgefälle demokratisiert.
Was trägt Michel Foucault zur Machtanalyse in der Pädagogik bei?
Foucaults Theorien helfen zu verstehen, wie Macht durch Disziplinierung, Wissen und institutionelle Strukturen wirkt und wie diese Prozesse die Identität der Heranwachsenden formen.
- Citar trabajo
- Manuel Stoewe (Autor), 2016, Positionspapier zum Thema Macht in pädagogischen Kontexten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428680