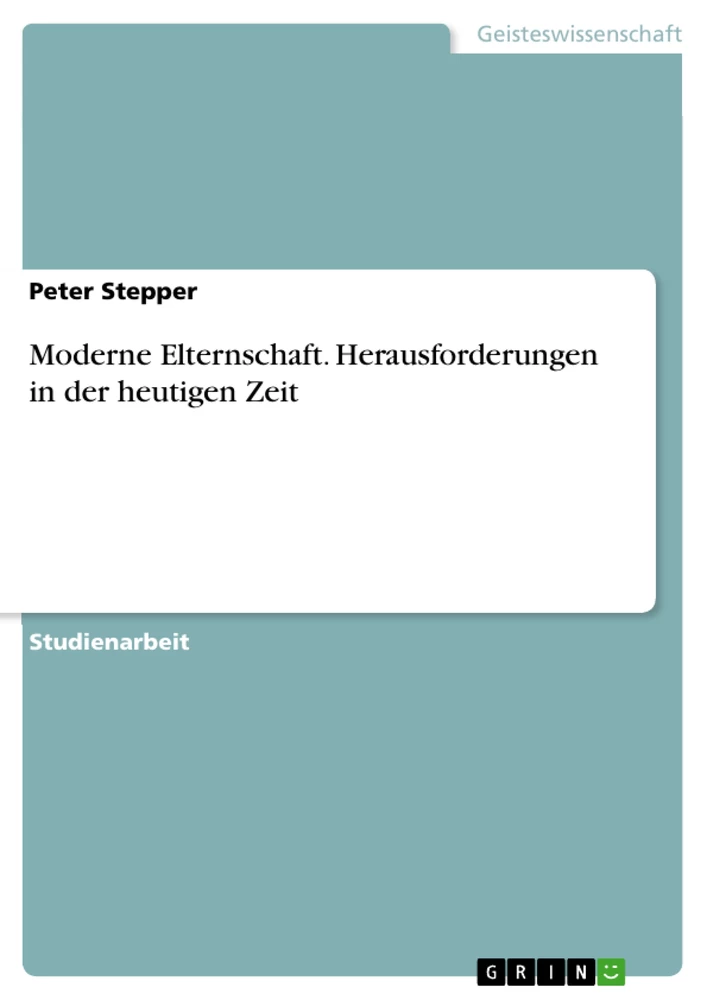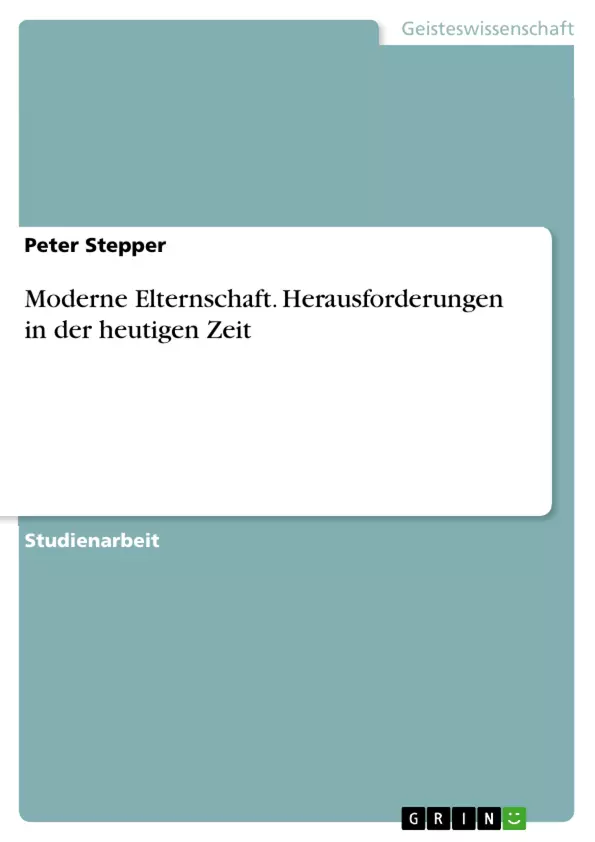Ein 3-jähriges Kind weint und möchte im Supermarkt um jeden Preis die Süßigkeit in der Quängelzone kurz vor der Kasse. Es wirft sich zu Boden und fängt an zu weinen. Strafende Blicke der anderen Kunden, ein genervter Blick der Kassiererin und richterliche Blicke der Rentner an der anderen Kasse.
Wie soll man sich als Elternteil verhalten? Eltern zu sein, kann eine der erfüllendsten und schönsten Erfahrungen eines Lebens sein, aber das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Egal welches Alter das Kind oder oftmals im Plural, die Kinder - die Erwartungen an Eltern werden nicht weniger! Um ein gutes Elternteil zu sein, gibt es gerade in Zeiten von Social Media, medialer Überpräsenz sogenannter Helikoptereltern und Erziehungssendungen, wie „Mein Kind, dein Kind“ auf dem Privatsender VOX, beinahe unerreichbare Ziele und Anforderungen an junge oder auch alte Eltern. Genügend Ratgeber teilen mit, wie sich Kinder geschätzt und geliebt fühlen lassen, wie man ihnen richtig und falsch beibringt.
Und doch ist es so, dass sich trotz dieser schwierigen Aufgabe und unter dem gesellschaftlichen Druck, viele Paare entscheiden, Kinder zu bekommen. Denn der innere Wunsch nach Familie scheint groß. Die vertraute Bindung zum Nachwuchs verleitet uns und der innere Kern einen Ort zu schaffen, an dem man sich wohl und beschützt fühlt, wird in den meisten Fällen als großes Ziel gesetzt.
Doch der immer weiter anziehende Druck auf Eltern lastet auf ihren Schultern - doch nicht nur auf diesen, sondern gar der Kinder. Der gesellschaftliche Wandel, also viele alleinerziehende Mütter, Vollzeitbeschäftigungen und die, mehr in die Erziehung eingebundene, Vaterrolle, sind nur einige wenige Punkte, die hier besprochen wurden. In dieser Arbeiten werden Erwartungen an eine moderne Elternschaft diskutiert, kritisiert und eigene Erfahrungswerte eingebracht. Die folgende Arbeit soll dazu dienen Erwartungen und Ansprüche anzusprechen und diese zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familie - eine begriffliche Annäherung
- Erwartungen und Herausforderungen an die Elternschaft
- Gute Mütter?
- Neue Väter?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Erwartungen und Herausforderungen der modernen Elternschaft. Sie analysiert den gesellschaftlichen Wandel und die steigenden Ansprüche an Eltern in der heutigen Zeit, wobei sie insbesondere auf die Themen der Familiendefinition, der Elternschaftsrolle und die Auswirkungen von Social Media und medialer Präsenz eingeht.
- Die Entwicklung des Familienbegriffs und die verschiedenen Familienformen
- Erwartungen und Anforderungen an Eltern in der modernen Gesellschaft
- Der Einfluss von Social Media und medialer Präsenz auf die Elternschaft
- Die Rolle der Vater- und Mutterrolle in der heutigen Gesellschaft
- Die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Problematik der modernen Elternschaft anhand eines Beispiels aus dem Alltag vor und beleuchtet die komplexen Erwartungen, denen Eltern heute gegenüberstehen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Eltern mit den Herausforderungen der modernen Welt umgehen und welche Faktoren einen Einfluss auf ihre Entscheidungen haben.
- Familie - eine begriffliche Annäherung: Dieses Kapitel geht auf die vielschichtigen Bedeutungen des Begriffs „Familie“ ein und beleuchtet verschiedene Familienformen in ihrer historischen Entwicklung. Es wird auf den Wandel des Familienbildes und die Veränderungen in den Rollenverteilungen eingegangen.
- Erwartungen und Herausforderungen an die Elternschaft: In diesem Kapitel werden die Erwartungen an die Elternschaft in der modernen Gesellschaft beleuchtet und die Auswirkungen von Social Media und medialer Präsenz auf die Erziehung von Kindern diskutiert.
- Gute Mütter?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Erwartungen an Mütter in der heutigen Gesellschaft und untersucht die Herausforderungen und den Druck, dem sie ausgesetzt sind.
- Neue Väter?: Dieses Kapitel untersucht die sich wandelnde Rolle des Vaters in der heutigen Gesellschaft und analysiert die veränderten Erwartungen und Herausforderungen für Väter.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Familie, Elternschaft, moderne Gesellschaft, Erwartungen, Herausforderungen, Social Media, medialer Druck, Geschlechterrollen, Vaterrolle, Mutterrolle, Familienformen, gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Herausforderungen stehen moderne Eltern gegenüber?
Eltern kämpfen mit hohen gesellschaftlichen Erwartungen, medialem Druck durch Social Media und der schwierigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wie beeinflussen Social Media das Bild der Elternschaft?
Plattformen erzeugen oft unerreichbare Ideale und Ziele, die Eltern unter Druck setzen, perfekt zu sein („Helikoptereltern“).
Was hat sich an der Rolle des Vaters verändert?
Das Konzept der „neuen Väter“ beschreibt eine stärkere Einbindung der Väter in die aktive Erziehungsarbeit und den Alltag der Kinder.
Warum entscheiden sich Paare trotz des Drucks für Kinder?
Der innere Wunsch nach Familie, Geborgenheit und einer tiefen emotionalen Bindung wird meist als hohes persönliches Ziel gewertet.
Welche Rolle spielt die Erziehungssendung „Mein Kind, dein Kind“?
Solche Formate tragen zur medialen Überpräsenz von Erziehungsstilen bei und befeuern die öffentliche Bewertung elterlichen Verhaltens.
Wie wird „Familie“ in der Arbeit definiert?
Die Arbeit nähert sich dem Begriff über den historischen Wandel und die Vielfalt moderner Familienformen (z. B. Alleinerziehende).
- Arbeit zitieren
- Peter Stepper (Autor:in), 2018, Moderne Elternschaft. Herausforderungen in der heutigen Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428776