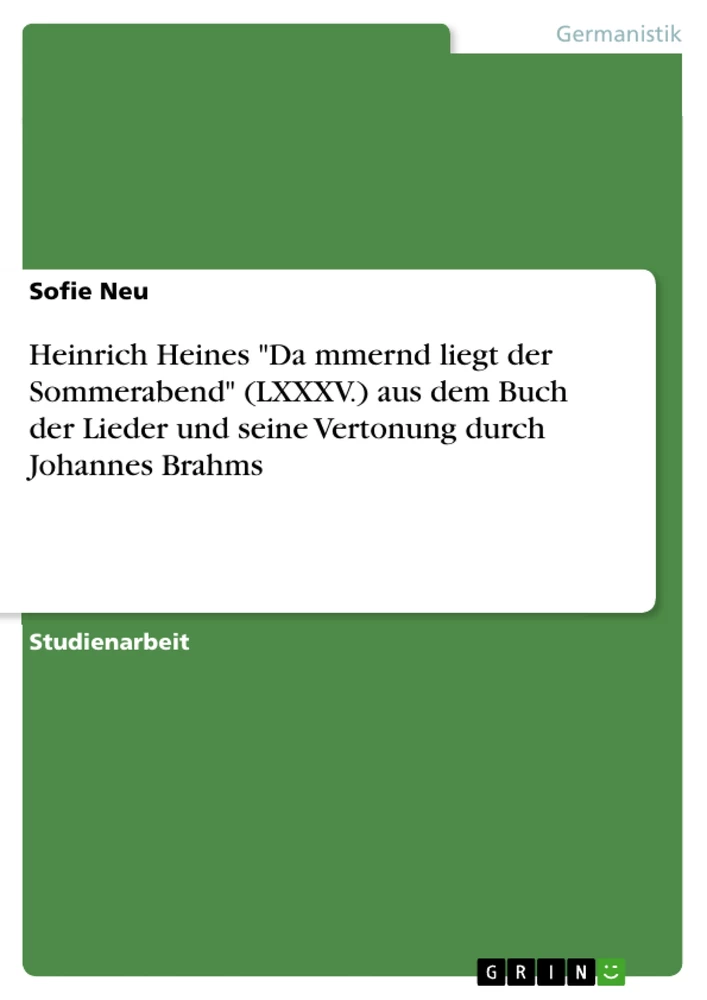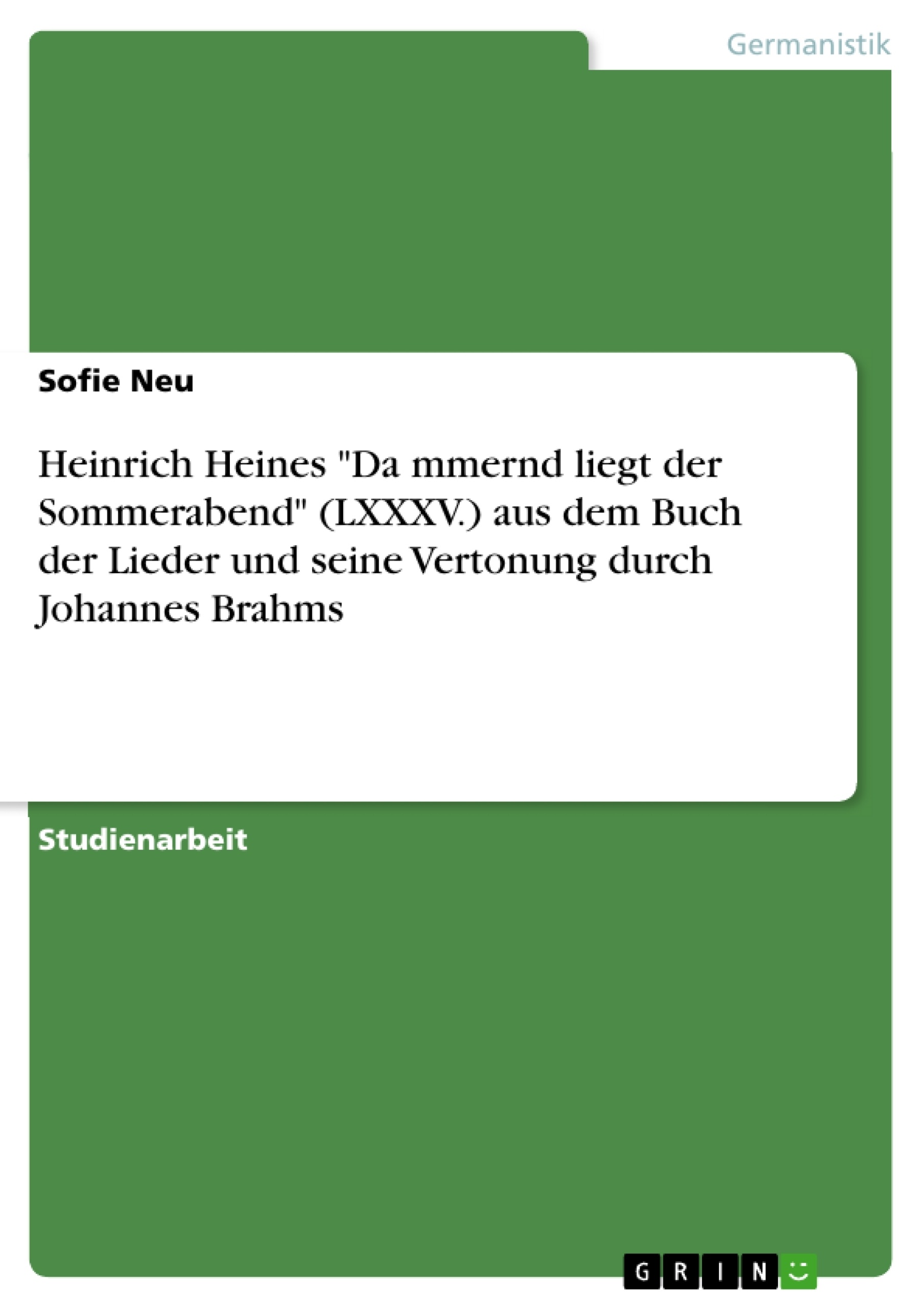Das lyrische Frühwerk des Dichters Heinrich Heine versammelt sich im Buch der Lieder, seinem berühmtesten und populärstem Gedichtband. Wichtig für die Verbreitung dieses Werkes war auch die Fülle an Vertonungen namhafter Komponisten wie beispielsweise Robert Schumann, Franz Schubert oder in diesem Falle Johannes Brahms: Das Buch der Lieder kann als der meistvertonte deutsche Gedichtband gelten. In dieser Arbeit soll es darum gehen, einen Blick auf das Gedicht LXXXV. (Dämmernd liegt der Sommerabend) aus dem Zyklus der Heimkehr zu werfen, es zu analysieren und in das Werk Heines und seine motivischen Einflüsse einzuordnen. Johannes Brahms vertonte dieses Gedicht 1878 und verband es unzertrennlich mit dem im Buch der Lieder darauf folgenden Gedicht LXXXVI. (Nacht liegt auf den fremden Wegen). Diese Verbindung soll sowohl auf musikalischer, als auch auf textlicher Ebene untersucht werden. Kann diese persönlich gezogene Verbindung Brahms’ auch im Interesse des Dichters gelegen haben?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Zyklus Die Heimkehr im Buch der Lieder
- Gedicht LXXXV. (Dämmernd liegt der Sommerabend)
- Form, Inhalt und Entstehung
- Interpretationsansätze
- Romantische Motive
- Bildhaftigkeit
- Synästhesie und Synergie
- Sensualismus und Erotik
- Die Vertonung durch Johannes Brahms
- Brahms' Heine-Vertonungen
- Op. 85,1 (Sommerabend) und seine Verbindung zu Op. 85,2 (Mondenschein)
- Rückgriff: Zyklische Komposition und Gedichtstellung im Buch der Lieder
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Gedicht LXXXV. (Dämmernd liegt der Sommerabend) aus Heinrich Heines Buch der Lieder. Das Gedicht wird analysiert und in das Werk Heines und seine motivischen Einflüsse eingeordnet. Des Weiteren wird Johannes Brahms' Vertonung dieses Gedichts betrachtet und im Kontext seiner Heine-Vertonungen und der Beziehung zwischen den Gedichten LXXXV. und LXXXVI. (Nacht liegt auf den fremden Wegen) analysiert.
- Analyse des Gedichts LXXXV. (Dämmernd liegt der Sommerabend)
- Einordnung des Gedichts in das Werk Heines
- Die Vertonung des Gedichts durch Johannes Brahms
- Die Beziehung zwischen den Gedichten LXXXV. und LXXXVI. (Nacht liegt auf den fremden Wegen)
- Die zyklische Komposition des Buches der Lieder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über das Buch der Lieder und die Bedeutung der Vertonungen für die Verbreitung dieses Werkes. Sie führt die Arbeit ein und legt die Schwerpunkte der Analyse fest.
Kapitel 2 widmet sich dem Zyklus Die Heimkehr im Buch der Lieder. Es werden Entstehung, Inhalt und Struktur des Zyklus, sowie seine literarischen Einflüsse und Vorbilder beschrieben.
Kapitel 3 analysiert das Gedicht LXXXV. (Dämmernd liegt der Sommerabend) in Bezug auf Form, Inhalt und Entstehung. Es beleuchtet die rhetorischen Figuren und Interpretationsansätze, die das Gedicht bereichern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Heinrich Heine, Buch der Lieder, Gedicht LXXXV. (Dämmernd liegt der Sommerabend), Johannes Brahms, Vertonung, Zyklische Komposition, Romantische Motive, Bildhaftigkeit, Synästhesie, Sensualismus, Erotik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Heines Gedicht "Dämmernd liegt der Sommerabend"?
Das Gedicht aus dem Zyklus "Die Heimkehr" thematisiert romantische Motive, Bildhaftigkeit und eine sinnlich-erotische Atmosphäre in einer abendlichen Landschaft.
Warum ist Heines "Buch der Lieder" so bedeutend?
Es ist der meistvertonte deutsche Gedichtband und markiert den Höhepunkt von Heines lyrischem Frühwerk, geprägt von Weltschmerz und Ironie.
Wie hat Johannes Brahms das Gedicht vertont?
Brahms vertonte es 1878 (Op. 85,1) und verband es eng mit dem folgenden Gedicht "Nacht liegt auf den fremden Wegen", um eine zyklische Einheit zu schaffen.
Was ist Synästhesie in Heines Lyrik?
Synästhesie bezeichnet die Verschmelzung verschiedener Sinneswahrnehmungen, wie etwa das "Hören" von Farben oder das "Sehen" von Klängen, was Heine zur Steigerung der Bildhaftigkeit einsetzt.
Welche Rolle spielt die Erotik in diesem Gedicht?
Das Gedicht nutzt Naturbilder (wie den Sommerabend), um eine unterschwellige erotische Spannung und Sensualismus auszudrücken.
- Quote paper
- Sofie Neu (Author), 2015, Heinrich Heines "Dämmernd liegt der Sommerabend" (LXXXV.) aus dem Buch der Lieder und seine Vertonung durch Johannes Brahms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428832