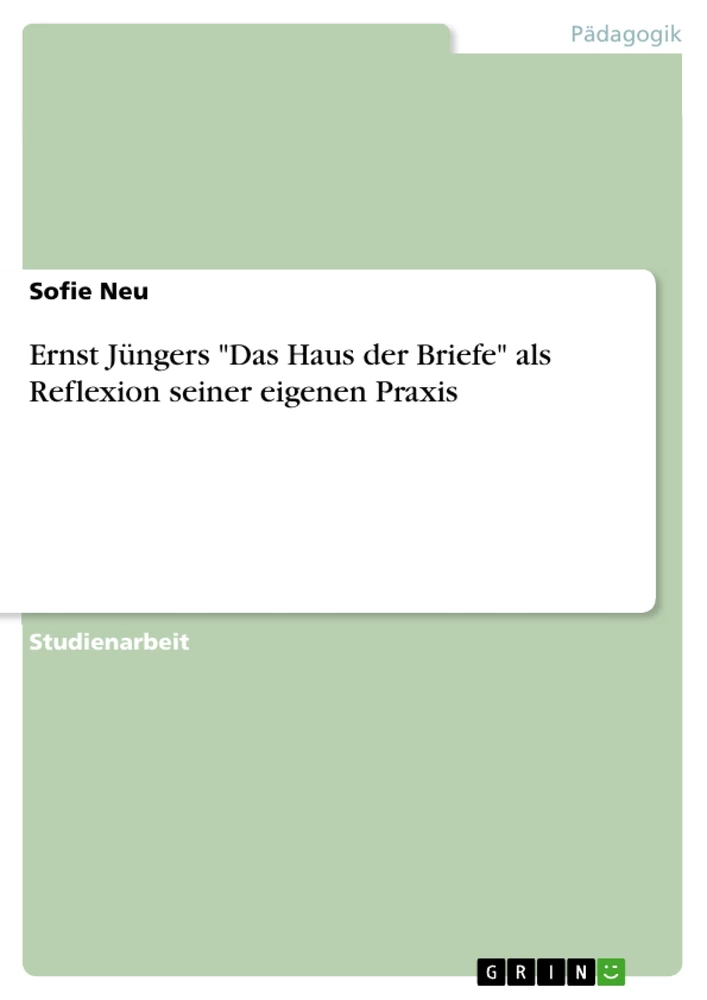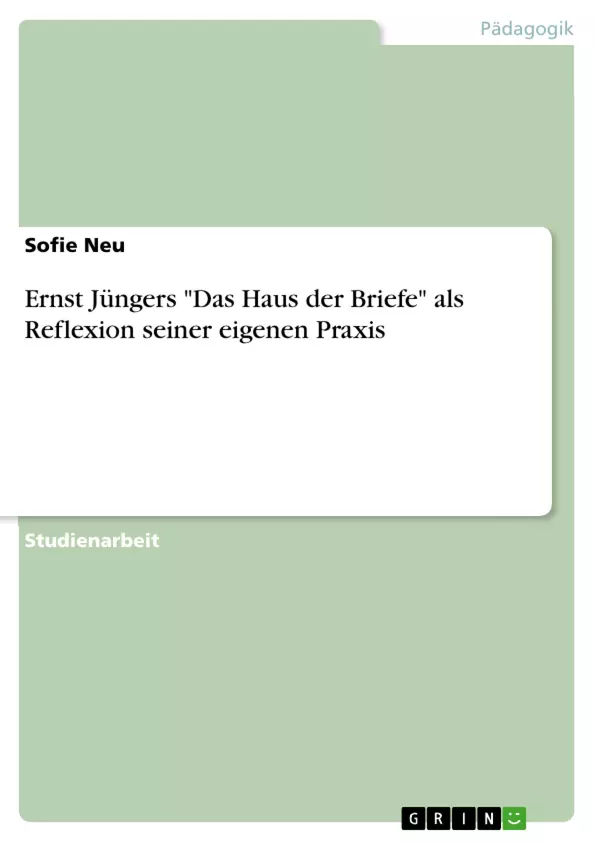Als geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus diffamiert, als Jahrhundertgestalt gefeiert – Ernst Jünger zählt zu den umstrittensten Schriftstellern Deutschlands. 1895 in Heidelberg geboren, 1998 in Riedlingen verstorben, durchlebte Jünger als Schriftsteller, Offizier, und Insektenkundler 102 Jahre deutsche Geschichte und ist vor allem durch seine Kriegserlebnisbücher, phantastischen Romane und Erzählungen sowie geschichts- und existenzphilosophische Essays bekannt. Er kann zunächst dem sogenannten heroischen, später dem magischen Realismus zugeordnet werden. Jünger erhielt verschiedene Preise und Auszeichnungen, darunter 1918 den Pour le Mérite für seinen Einsatz im ersten Weltkrieg, 1959 das Große Bundesverdienstkreuz und 1982 den Goethepreis, dessen Verleihung für einen politischen Skandal sorgte.
Jüngers Position ist gekennzeichnet von Ambivalenz, „von Affirmation und Distanzierung“: Nach dem ersten Weltkrieg tritt er aus der Armee aus und beginnt Zoologie und Philosophie zu studieren, schreibt aber auch Beiträge für nationalistische Zeitschriften und wird zum Vertreter eines „Soldatischen Nationalismus“. Einen ihm angebotenen Sitz im Reichstag lehnt er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten jedoch ab und zieht sich aus der Politik eher zurück. So wird auch sein 1928 erschienenes Buch Das abenteuerliche Herz als Literarisierung und Entpolitisierung des Autors gesehen, der sich mit seiner Familie 1934 in die Provinz zurückzieht.
Durch die Menge der Aufzeichnungen und die Eingliederung von Briefen und Tagebüchern ins Werk entsteht ein Spiegel der deutschen Kultur- und Geistesgeschichte des gesamten 20. Jahrhunderts. Spannend ist auch Jüngers ungewöhnliche Themenwahl und die Grenzüberschreitungen, die er wagt: Futuristische Romane wie Heliopolis (1949) und Gläserne Bienen (1957) beschreiben Weltraumfahrt, neue Technologien und Roboter. Wissenschaftliche Beiträgen zur Insektenkunde stehen im Werk Jüngers neben Beschreibungen von Rausch und Drogenerfahrungen wie in Besuch auf Godenholm (1952).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Jünger als
- Sammler
- Tagebuchschreiber.
- Briefschreiber
- Das Haus der Briefe
- Brief und Handschrift
- Institutionalisiertes Sammeln (Archiv, Sammlung, Bibliothek).
- Geschichtsbild
- Menschenbild
- Fazit.....
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Werk von Ernst Jünger, einem der umstrittensten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht die Rolle des Briefes in Jüngers Schaffen, insbesondere in seiner Erzählung "Das Haus der Briefe".
- Jüngers Sammeltätigkeit und die Bedeutung von Briefen in seinem Werk
- Die Rolle von Briefen in der Konstruktion von Geschichte und Identität
- Das Haus der Briefe als Spiegel des kulturellen Gedächtnisses
- Die Beziehung zwischen Briefen, Archiv und Gedächtnis
- Jüngers Selbstverständnis als Schriftsteller und Beobachter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Jünger als einen vielseitigen Autor vor, der sich in seiner Arbeit mit verschiedenen Themen auseinandersetzte, von Kriegserfahrungen bis hin zu naturwissenschaftlichen Betrachtungen. Sie beleuchtet seine Position in der deutschen Geschichte und die Ambivalenz, die ihn als Persönlichkeit und Schriftsteller prägte. Die Kapitel 2 und 3 gehen dann auf Jüngers Sammelleidenschaft ein, wobei Kapitel 2.1 sich mit seiner Sammeltätigkeit als Entomologe auseinandersetzt und den Zusammenhang zwischen Entomologie und Autobiographie beleuchtet. Kapitel 2.2 beleuchtet Jüngers Arbeit als Tagebuchschreiber und Briefeschreiber, und Kapitel 3 widmet sich dann dem "Haus der Briefe" als zentrales Thema der Arbeit.
Schlüsselwörter
Ernst Jünger, Brief, Sammlung, Archiv, Gedächtnis, Geschichte, Identität, "Das Haus der Briefe", Entomologie, Tagebuch, Briefschreiben, Kulturgeschichte, Literatur, Realismus, Nationalsozialismus, Kriegserfahrungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Ernst Jünger als umstrittener Schriftsteller?
Jünger wird einerseits als Jahrhundertgestalt gefeiert, andererseits aufgrund seiner Nähe zum soldatischen Nationalismus und seiner Rolle als geistiger Wegbereiter kritisch gesehen.
Was thematisiert Jünger in "Das Haus der Briefe"?
Die Erzählung reflektiert Jüngers eigene Praxis als Sammler und Briefschreiber sowie die Bedeutung von Archiven für das kulturelle Gedächtnis.
Welche Rolle spielt die Insektenkunde (Entomologie) in seinem Werk?
Jünger war leidenschaftlicher Insektenkundler; seine Sammeltätigkeit spiegelt sich in seiner präzisen Beobachtungsgabe und seinem literarischen Stil wider.
Hat Ernst Jünger politische Ämter im Nationalsozialismus übernommen?
Nein, er lehnte einen Sitz im Reichstag nach der Machtergreifung ab und zog sich eher in die "innere Emigration" in der Provinz zurück.
Was versteht man unter Jüngers "magischem Realismus"?
Es ist ein literarischer Stil, der reale Begebenheiten mit phantastischen oder traumartigen Elementen verwebt, wie etwa in seinen futuristischen Romanen.
- Citar trabajo
- Sofie Neu (Autor), 2017, Ernst Jüngers "Das Haus der Briefe" als Reflexion seiner eigenen Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428846