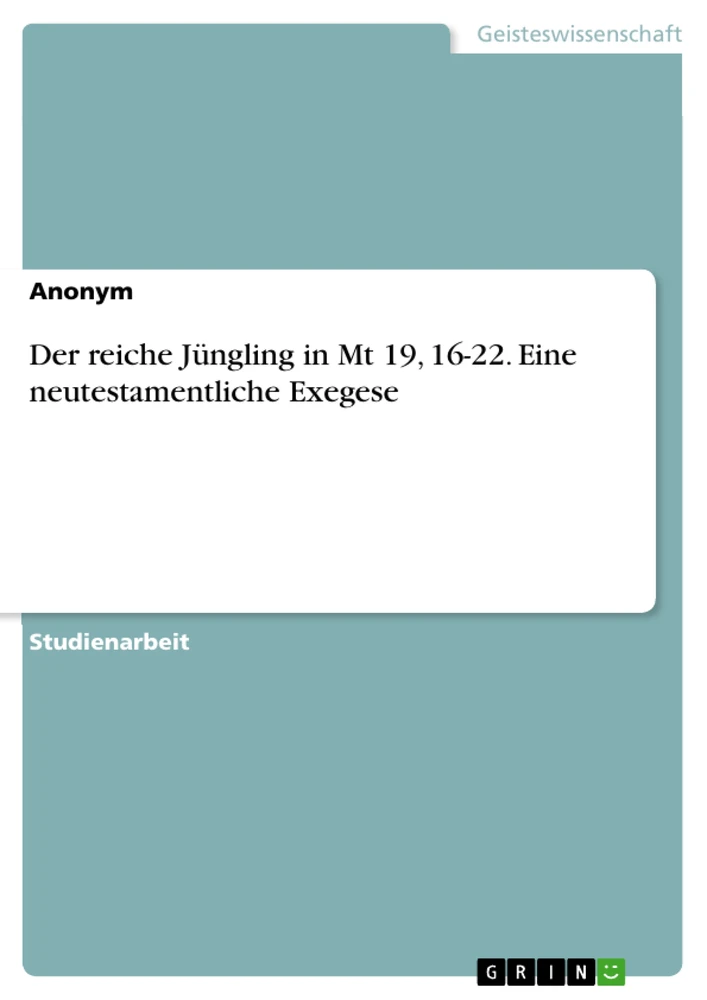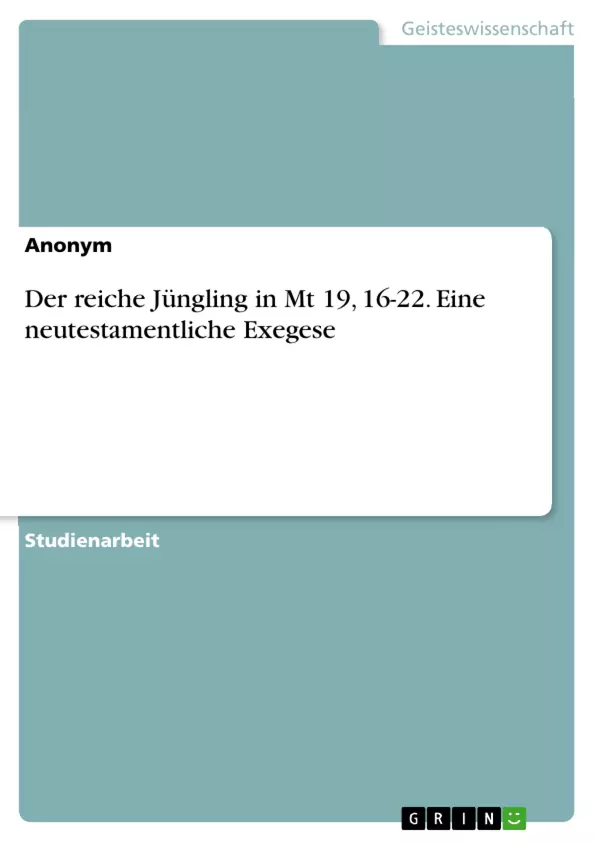Diese neutestamentliche Proseminararbeit ist eine Exegese von Mt 19,16-22. Anhand von sieben historisch-kritischen Methodenschritten synchroner und diachroner Art soll eine Untersuchung dieser Perikope dargelegt werden.
Das Ziel der Arbeit ist es zunächst den möglichst ursprünglichen Text der Perikope vom reichen Jüngling unter Zuhilfenahme des kritischen Apparats aus dem Novum Testamentum Graece zu rekonstruieren. Nach einer Übersetzung wird eine Textanalyse durchgeführt, in deren Verlauf die Perikope abgegrenzt und ihr Kontext analysiert wird. Außerdem wird der Text auf seine grammatisch-syntaktische, seine semantische, sowie auf seine pragmatische und narrative Kohärenz untersucht.
Dieser Schritt beendet die synchrone Analyse des Textes und mit Hilfe der Literarkritik, die einen synoptischen Vergleich durchführt, beginnt die diachrone Analyse des Textes. Die Formgeschichte fragt nach der Gattung der Perikope und ihrem Sitz im Leben. In der darauf folgenden religionsgeschichtlichen Analyse wird die Perikope zunächst mit außerneutestamentlicher Literatur verglichen, um Übereinstimmungen und Differenzen in der Überlieferung christlicher und nichtchristlicher Literatur aufzuzeigen. Anschließend wird eine Motivanalyse durchgeführt, die den Bedeutungswandel und den Gebrauch des Wortes avkolouqe,w darstellen soll.
In der Redaktionskritik soll die Perikope im Hinblick auf ihre Intertextualität untersucht werden und es soll der Frage nachgegangen werden inwieweit Matthäus redaktionelle Eingriffe vorgenommen hat und wie er das Material für sein Evangelium ausgewählt und zusammengestellt hat. In der abschließenden hermeneutische Reflexion wird der Text in den gegenwärtigen Kontext projizieren und dadurch der historische Abstand zwischen Text und Gegenwart überbrückt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Übersetzung
- III. Textkritik
- IV. Textanalyse
- V. Literarkritik: Der synoptische Vergleich
- VI. Formgeschichte
- VII. Religionsgeschichtliche Analyse
- VIII. Redaktionskritik
- IX. Hermeneutische Überlegung
- X. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese neutestamentliche Proseminararbeit untersucht die Perikope Mt 19,16-22 (Der reiche Jüngling) mittels sieben historisch-kritischer Methoden. Das Ziel ist die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes und dessen umfassende Analyse unter Berücksichtigung von syntaktischen, semantischen und pragmatischen Aspekten. Die diachrone Analyse beinhaltet einen synoptischen Vergleich, formgeschichtliche und religionsgeschichtliche Betrachtungen sowie eine Redaktionskritik.
- Rekonstruktion des ursprünglichen Textes von Mt 19,16-22
- Analyse der grammatisch-syntaktischen, semantischen, pragmatischen und narrativen Kohärenz
- Synoptischer Vergleich und formgeschichtliche Einordnung der Perikope
- Religionsgeschichtliche Analyse im Vergleich mit außerneutestamentlicher Literatur
- Redaktionskritische Untersuchung von Matthäus' redaktionellen Eingriffen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Proseminararbeit ein und beschreibt den Dialog zwischen Jesus und dem reichen Jüngling in Mt 19,16-22. Sie legt die Methodik der Arbeit dar, die auf sieben historisch-kritischen Schritten basiert, um den ursprünglichen Text zu rekonstruieren und anschließend synchron und diachron zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Anwendung verschiedener exegetischer Methoden zur detaillierten Untersuchung der Perikope und ihrer Bedeutung.
II. Übersetzung: Dieses Kapitel präsentiert eine Übersetzung der Perikope Mt 19,16-22. Die Übersetzung dient als Grundlage für die anschließende Textanalyse und berücksichtigt die Ergebnisse der Textkritik, um einen möglichst ursprünglichen und korrekten Text zu gewährleisten. Die gewählte Übersetzung stellt somit die Basis für die folgenden Interpretationsschritte dar und berücksichtigt dabei die sprachlichen Nuancen des griechischen Originals.
III. Textkritik: Kapitel III beschreibt die textkritische Analyse von Mt 19,16-22. Es identifiziert verschiedene Lesarten an 16 Stellen innerhalb der Perikope und wählt ausgewählte Stellen für eine detaillierte Untersuchung unter Zuhilfenahme des textkritischen Apparats des Novum Testamentum Graece. Die Analyse konzentriert sich auf die Bewertung der Lesarten anhand innerer und äußerer Kriterien, um den wahrscheinlich ursprünglichen Text zu rekonstruieren und eine fundierte Grundlage für die folgende Übersetzung zu schaffen. Konkrete Beispiele wie die Diskussion um die Anrede "διδάσκαλε" (Lehrer) und die unterschiedlichen Imperativformen werden behandelt.
IV. Textanalyse: Die Textanalyse untersucht die Perikope Mt 19,16-22 in Bezug auf ihre grammatisch-syntaktische Struktur, Semantik, Pragmatik und narrative Kohärenz. Die Abgrenzung der Perikope und die Analyse ihres Kontextes bilden den Ausgangspunkt. Durch die detaillierte Untersuchung der sprachlichen Elemente wird ein tieferes Verständnis des Textes gewonnen, bevor die diachronen Analysemethoden eingesetzt werden. Diese synchrone Betrachtung liefert die Basis für die weitere Interpretation.
V. Literarkritik: Der synoptische Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Perikope Mt 19,16-22 mit parallelen Stellen in den synoptischen Evangelien (Markus und Lukas). Der Vergleich beleuchtet die literarischen Beziehungen zwischen den Evangelien und hilft, die Entstehung und Entwicklung des Textes zu verstehen. Die Analyse der Übereinstimmungen und Unterschiede in den verschiedenen Versionen liefert wichtige Hinweise auf die Überlieferungsgeschichte und die redaktionellen Entscheidungen der jeweiligen Evangelisten.
VI. Formgeschichte: Die Formgeschichte untersucht die Gattung der Perikope Mt 19,16-22 und ihren Sitz im Leben, also ihren ursprünglichen Kontext. Es geht darum, die Form und Funktion des Textes in seiner ursprünglichen Umgebung zu rekonstruieren und seine Bedeutung im Rahmen der damaligen religiösen und gesellschaftlichen Praxis zu verstehen. Die Analyse zielt darauf ab, die Entstehung der Perikope in einem spezifischen Kontext zu erklären.
VII. Religionsgeschichtliche Analyse: Kapitel VII vergleicht die Perikope Mt 19,16-22 mit außerneutestamentlicher Literatur aus dem Judentum und der hellenistischen Welt. Ziel ist es, Parallelen und Unterschiede zu identifizieren und das Verständnis des Textes im Kontext seiner religiösen und kulturellen Umgebung zu erweitern. Diese religionsgeschichtliche Perspektive trägt zum Verständnis der spezifischen Bedeutung des Textes im historischen Kontext bei.
VIII. Redaktionskritik: Die Redaktionskritik analysiert Matthäus’ Bearbeitung des Materials und untersucht seine redaktionellen Eingriffe in die Perikope. Es geht um die Frage, wie Matthäus das Material für sein Evangelium ausgewählt und zusammengestellt hat, und welche theologischen Intentionen er dabei verfolgt hat. Die Intertextualität des Textes und Matthäus' spezifische theologische Akzente stehen im Fokus dieser Analyse.
Schlüsselwörter
Neutestamentliche Exegese, Matthäusevangelium, Mt 19,16-22, Der reiche Jüngling, historisch-kritische Methode, Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte, Religionsgeschichte, Redaktionskritik, Hermeneutik, synoptische Evangelien, Motivanalyse, Intertextualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur neutestamentlichen Proseminararbeit: Matthäus 19,16-22
Was ist der Gegenstand dieser Proseminararbeit?
Die Arbeit untersucht die Perikope Matthäus 19,16-22 ("Der reiche Jüngling") mithilfe sieben historisch-kritischer Methoden. Ziel ist die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes und dessen umfassende Analyse unter syntaktischen, semantischen und pragmatischen Aspekten sowie diachron (synoptischer Vergleich, Formgeschichte, Religionsgeschichte, Redaktionskritik).
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet folgende historisch-kritische Methoden: Übersetzung, Textkritik, Textanalyse, synoptischer Vergleich, Formgeschichte, religionsgeschichtliche Analyse und Redaktionskritik. Diese Methoden werden Schritt für Schritt angewendet, um den Text zu rekonstruieren und zu interpretieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Einleitung, Übersetzung, Textkritik, Textanalyse, Literarkritik (synoptischer Vergleich), Formgeschichte, religionsgeschichtliche Analyse, Redaktionskritik, hermeneutische Überlegung und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel befasst sich mit einem Aspekt der Textanalyse, beginnend mit der Rekonstruktion des Textes und endend mit einer umfassenden Interpretation.
Was ist das Ziel der Textkritik?
Die Textkritik zielt darauf ab, den wahrscheinlich ursprünglichen Text von Matthäus 19,16-22 zu rekonstruieren. Sie untersucht verschiedene Lesarten und bewertet diese anhand innerer und äußerer Kriterien. Konkrete Beispiele, wie die Diskussion um die Anrede "διδάσκαλε" (Lehrer) und unterschiedliche Imperativformen, werden behandelt.
Wie wird die Textanalyse durchgeführt?
Die Textanalyse untersucht die Perikope in Bezug auf ihre grammatisch-syntaktische Struktur, Semantik, Pragmatik und narrative Kohärenz. Sie liefert die synchrone Basis für die anschließende diachrone Interpretation. Die Abgrenzung der Perikope und die Analyse ihres Kontextes bilden den Ausgangspunkt.
Was beinhaltet der synoptische Vergleich?
Der synoptische Vergleich vergleicht Matthäus 19,16-22 mit parallelen Stellen in Markus und Lukas. Er beleuchtet die literarischen Beziehungen zwischen den Evangelien und hilft, die Entstehung und Entwicklung des Textes zu verstehen. Die Analyse der Übereinstimmungen und Unterschiede gibt Aufschluss über die Überlieferungsgeschichte und die redaktionellen Entscheidungen der Evangelisten.
Was ist der Gegenstand der Formgeschichte?
Die Formgeschichte untersucht die Gattung der Perikope und ihren Sitz im Leben (ursprünglichen Kontext). Sie rekonstruiert die Form und Funktion des Textes in seiner ursprünglichen Umgebung und versteht seine Bedeutung im Rahmen der damaligen religiösen und gesellschaftlichen Praxis.
Was leistet die religionsgeschichtliche Analyse?
Die religionsgeschichtliche Analyse vergleicht die Perikope mit außerneutestamentlicher Literatur aus dem Judentum und der hellenistischen Welt. Sie identifiziert Parallelen und Unterschiede und erweitert das Verständnis des Textes im Kontext seiner religiösen und kulturellen Umgebung.
Was ist der Fokus der Redaktionskritik?
Die Redaktionskritik analysiert Matthäus' Bearbeitung des Materials und seine redaktionellen Eingriffe. Sie untersucht, wie Matthäus das Material für sein Evangelium ausgewählt und zusammengestellt hat und welche theologischen Intentionen er dabei verfolgt hat. Die Intertextualität des Textes und Matthäus' spezifische theologische Akzente stehen im Fokus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neutestamentliche Exegese, Matthäusevangelium, Mt 19,16-22, Der reiche Jüngling, historisch-kritische Methode, Textkritik, Literarkritik, Formgeschichte, Religionsgeschichte, Redaktionskritik, Hermeneutik, synoptische Evangelien, Motivanalyse, Intertextualität.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2010, Der reiche Jüngling in Mt 19, 16-22. Eine neutestamentliche Exegese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428859