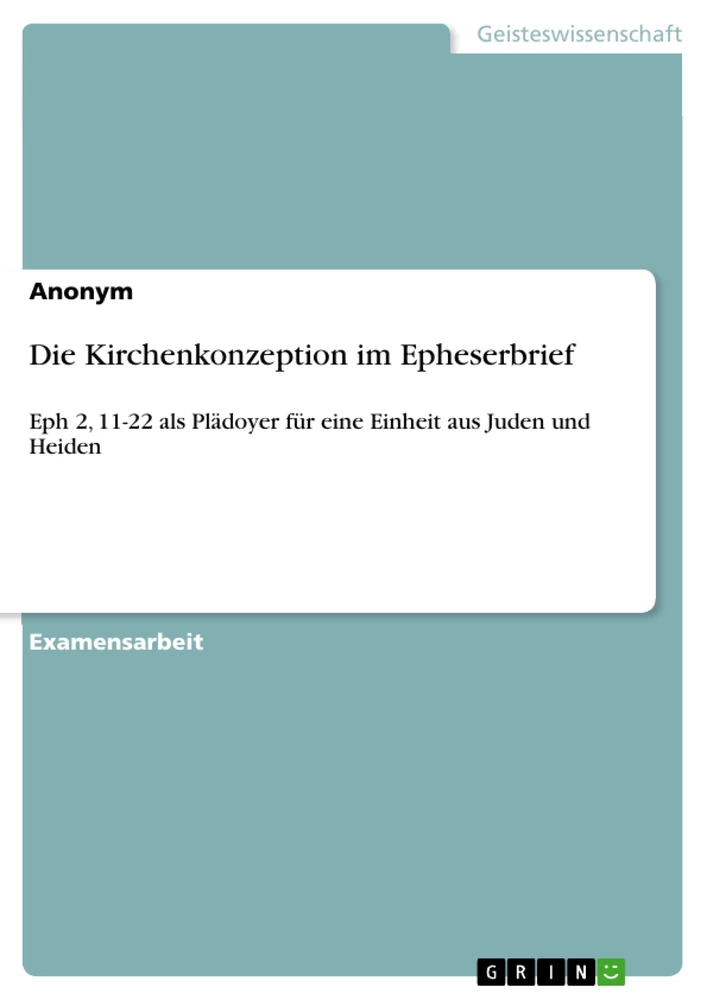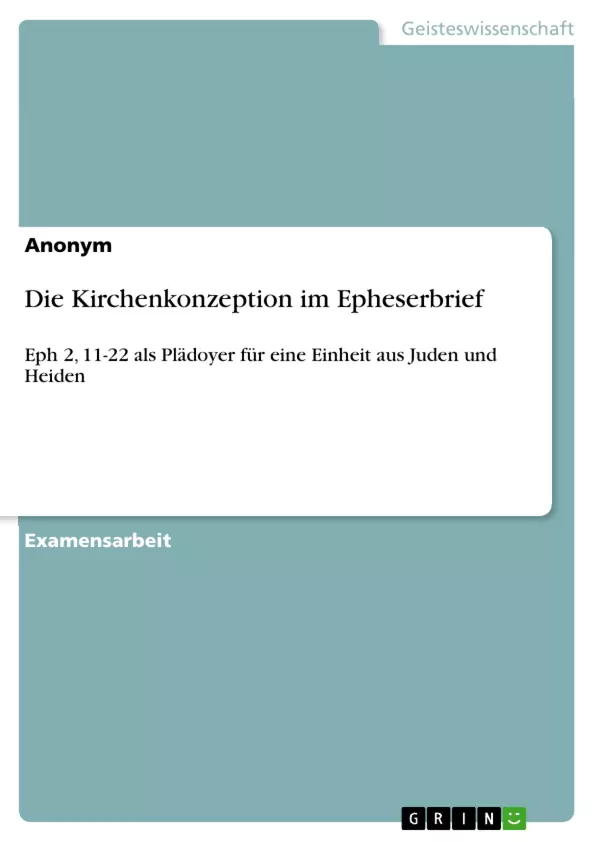Nach einer Notiz bei Eusebius flüchtete die Urgemeinde mit dem Ausbruch des jüdischen Krieges im Jahre 66 nach Pella. Auch wenn es sich dabei höchstwahrscheinlich um eine Legende handelt, hatte die jüdische Niederlage in diesem Krieg gravierende Folgen, nicht nur für die Urgemeinde, sondern auch für das Judenchristentum an sich. So traf die restriktive Judenpolitik der Flavier auch die judenchristlichen Gemeinden, was längerfristig zu einem Achtungs- und Einflussverlust der Judenchristen führte. Diesem Phänomen entgegenzuwirken, war eine zentrale Absicht des Epheserbriefes. Doch die Vertreibung der Jerusalemer Gemeinde nach der Niederschlagung des Bar-Kochba Aufstandes unter Hadrian im Jahre 135 n. Chr. deutete den endgültigen Niedergang des Judenchristentums schon an. Mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion 380 n. Chr. wurde die Trennung von Judentum und Christentum sowie das Ende judenchristlicher Einflüsse auf das Christentum besiegelt.
Hat der Epheserbrief, als Schreiben, welches die Einheit aus Juden- und Heidenchristentum propagiert, mit dem Verschwinden des Judenchristentums demnach so sehr an Aktualität eingebüßt, dass eine Beschäftigung mit ihm, insbesondere mit der zentralen Perikope Eph 2,11-22, obsolet geworden ist? Muss nicht eingestanden werden, dass die Konzeption der Kirche als Gegenentwurf zum Imperium Romanum nicht mehr zeitgemäß ist?
Ziel dieser Arbeit ist es schließlich, die Kirchenvision des Autors zu rekonstruieren und dabei aufzudecken, von welchen Leitlinien aus jüdischer Tradition, christlichem Selbstverständnis und aktuellen politischen Bezügen er sich dabei führen ließ. Diesbezüglich soll nach einer kurzen Klärung der Einleitungsfragen der Blick auf die gegenseitige Wahrnehmung von Juden und Heiden im Imperium Romanum geworfen werden. Dieser Schritt ist nötig, da nur auf diese Weise nachzuvollziehen ist, welche Sprengkraft das Kirchenverständnis des Epheserbriefes birgt. Den Hauptteil dieser Arbeit bildet eine ausführliche Exegese von Eph 2,11-22, der zentralen Stelle des Epheserbriefes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gegenüber von Juden und Heiden im Imperium Romanum
- Die Hellenisierung des Judentums
- Die ,,Unbeschnittenheit“ – jüdische Sicht auf ihre heidnische Umwelt
- Die jüdische Sonderstellung im Imperium Romanum
- Die Etablierung des Christentums – von der innerjüdischen Erneuerungsbewegung zur hellenistischen Kultbewegung
- Die Kirchenkonzeption in Eph 2,11-22
- Kontext- und Strukturanalyse
- Motivanalyse
- Τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ
- Μακράν καὶ ἐγγύς
- Καινὸν ἄνθροπον
- Εἰρήνε
- Exegese
- Vers 11 – 13: Einst und jetzt – fern und nahe
- Vers 14-18: Christus der Friedensbringer
- Vers 19-22: Miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geiste
- Parallelstellen
- Das Ende des Gesetzes
- Das Ende des Unterschieds
- Die Kirche im Epheserbrief – ein Gegenentwurf zum Imperium Romanum
- Der Leib des Imperiums
- Pax Christi und Pax Gentium
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Rekonstruktion der Kirchenvision des Autors des Epheserbriefes und die Aufdeckung der Leitlinien aus jüdischer Tradition, christlichem Selbstverständnis und aktuellen politischen Bezügen, die ihn dabei führten. Der Fokus liegt auf der zentralen Perikope Eph 2,11-22, die die hoffnungslose Situation der Heiden ohne Christus und die rettende Tat Christi thematisiert. Die Arbeit untersucht, wie die zentrale Stelle des Epheserbriefes die Entstehung der Kirche als Eckstein für den Zugang sowohl von Juden als auch von Heiden zu Gott erklärt.
- Die Einheit von Juden und Heiden in der christlichen Kirche
- Die Rolle Christi als Friedensbringer und Versöhner
- Das Kirchenverständnis des Epheserbriefes als Gegenentwurf zum Imperium Romanum
- Die politische und religiöse Situation im römischen Reich
- Die jüdische Tradition und das christliche Selbstverständnis im Epheserbrief
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Hintergrund des Epheserbriefes und die Problematik des Judenchristentums im römischen Reich. Sie stellt die Relevanz des Epheserbriefes in Bezug auf den ökumenischen und interreligiösen Dialog heraus.
Der Abschnitt „Das Gegenüber von Juden und Heiden im Imperium Romanum“ untersucht die unterschiedlichen Perspektiven und Beziehungen zwischen Juden und Heiden im römischen Reich, insbesondere die Hellenisierung des Judentums und die jüdische Sicht auf ihre heidnische Umwelt.
Der dritte Teil „Die Kirchenkonzeption in Eph 2,11-22“ befasst sich mit der zentralen Perikope des Epheserbriefes. Die Struktur und Motive der Passage werden analysiert, und die Exegese der Verse 11-22 wird in drei Abschnitten behandelt: Die Situation der Heiden ohne Christus, die rettende Tat Christi und die Gründung der Kirche als Eckstein für den Zugang von Juden und Heiden zu Gott.
Schlüsselwörter
Epheserbrief, Kirchenkonzeption, Einheit, Juden und Heiden, Imperium Romanum, Christus, Friedensbringer, Pax Christi, Corpus Rei Publica, ökumenischer Prozess, interreligiöser Dialog, jüdische Tradition, christliches Selbstverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Epheserbriefes in Bezug auf die Kirche?
Das Hauptziel ist die Darstellung der Einheit von Juden- und Heidenchristen in einer gemeinsamen Kirche durch das Werk Christi.
Welche Bedeutung hat die Perikope Eph 2,11-22?
Diese Stelle beschreibt den Übergang der Heiden von der Gottferne zur Bürgerschaft im Volk Gottes und die Überwindung der Trennmauer zwischen Juden und Heiden.
Warum wird die Kirche im Epheserbrief als Gegenentwurf zum Imperium Romanum gesehen?
Die Arbeit untersucht, wie das Konzept der "Pax Christi" (Frieden Christi) als Alternative zur "Pax Romana" (Römischer Frieden) und dem kaiserlichen Herrschaftssystem fungiert.
Welche Rolle spielt Christus als Friedensbringer?
Christus wird als derjenige dargestellt, der durch sein Opfer die Feindschaft vernichtet und einen "neuen Menschen" aus beiden Gruppen (Juden und Heiden) erschafft.
Welchen Einfluss hatte die jüdische Niederlage im Jahr 66 n. Chr. auf das Christentum?
Die Niederlage führte zu einem Einflussverlust der Judenchristen, was der Epheserbrief durch die Betonung der Gleichberechtigung aller Gläubigen zu adressieren versucht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Die Kirchenkonzeption im Epheserbrief, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428866