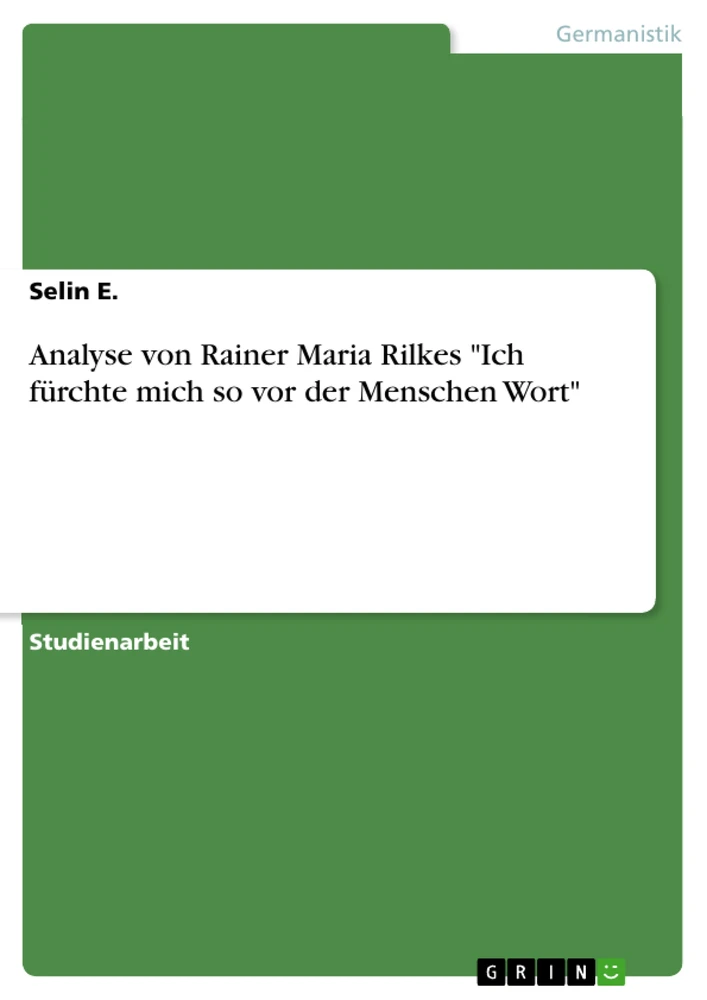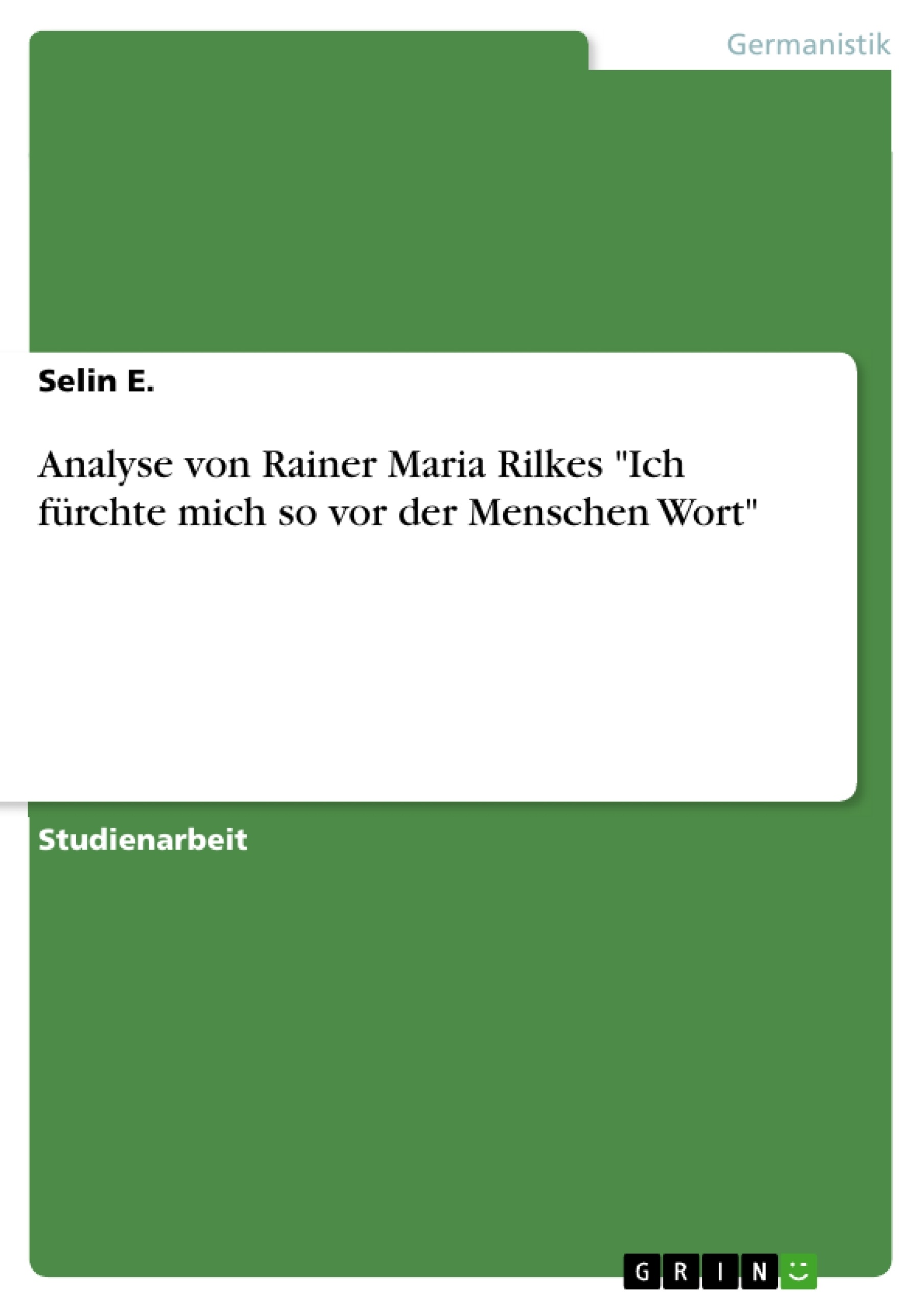Im Rahmen dieser Seminararbeit werde ich mich mit dem Gedicht ‚Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort’ von Rainer Maria Rilke auseinandersetzen, das 1899 in dem Gedichtband ‚Mir zur Feier’ erschien. Ableitend von dem Titel des Gedichts handelt es von der Angst des lyrischen Ichs vor der Sprache des Menschen, wobei die Mangelhaftigkeit der Sprache und der damalige Sprachgebrauch kritisiert werden. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Analyse und Interpretation des Gedichts im Hinblick auf den Inhalt sowie die Besonderheiten des Aufbaus und der Sprache. Diesbezüglich werde ich mich in dem ersten Teil der Arbeit mit dem Inhalt, dem Aufbau sowie der Sprache des Gedichts beschäftigen. Darauf aufbauend werde ich in dem zweiten Teil meiner Arbeit das Gedicht angesichts der sprachlichen Besonderheiten sowie der Autorenaussagen aus dem 19. und 20.Jahrhundert über die Sprache und die Wahrheit interpretieren und in gewissen Aspekten einen Vergleich zwischen der Kernaussage des Gedichts und diesen Autorenaussagen durchführen. Schließlich werde ich das Gedicht mit einem anderen Gedicht, nämlich Eichendorffs Wünschelrute, aus dem gleichen Jahrhundert beruhend auf ihre Kernaussagen vergleichen. Ganz zum Schluss wird eine Übersicht der durchgeführten Analyse dargelegt. Die leitende Fragestellung der gesamten Arbeit ist, ob die von den Menschen geschaffene Sprache in der Lage ist oder dafür geeignet ist, die Wirklichkeit beziehungsweise die Welt zu beschreiben oder eher dazu tendiert, die Welt in konkrete, abgrenzende Rahmen zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort
- Struktuelle Analyse und Interpretation des Gedichts
- Inhalt des Gedichts
- Die Gedichtform und die Epochenzuordnung
- Aufbau des Gedichts
- Interpretation des Gedichts
- Vergleich mit Joseph von Eichendorffs ‚,Wünschelrute‘‘
- Wünschelrute
- Inhaltlicher Vergleich von ‚, Wünschelrute‘‘ und ‚,Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort’’
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Rainer Maria Rilkes Gedicht ‚Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort‘, das 1899 in dem Gedichtband ‚Mir zur Feier‘ erschien. Die Arbeit beleuchtet die Angst des lyrischen Ichs vor der Sprache des Menschen und kritisiert die Mangelhaftigkeit der Sprache und den damaligen Sprachgebrauch. Der Fokus liegt auf der Analyse und Interpretation des Gedichts in Bezug auf Inhalt, Aufbau und Sprache, sowie auf einem Vergleich mit Eichendorffs ‚,Wünschelrute‘‘.
- Die Angst des lyrischen Ichs vor der Sprache des Menschen
- Die Kritik an der Mangelhaftigkeit der Sprache und dem Sprachgebrauch
- Die Interpretation des Gedichts in Bezug auf Inhalt, Aufbau und Sprache
- Ein Vergleich mit Eichendorffs ‚,Wünschelrute‘‘
- Die Relevanz des Gedichts im Kontext der Sprachkrise des 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein und stellt die Fragestellung vor, ob die menschliche Sprache die Wirklichkeit beschreiben kann oder ob sie dazu neigt, die Welt in konkrete, abgrenzende Rahmen zu setzen. Kapitel 2 beleuchtet den Titel des Gedichts und analysiert die einzelnen Strophen. Kapitel 3 befasst sich mit der strukturellen Analyse des Gedichts, indem es den Inhalt, die Gedichtform und die Epochenzuordnung, den Aufbau und die Interpretation des Gedichts untersucht. Kapitel 4 vergleicht das Gedicht mit Joseph von Eichendorffs ‚,Wünschelrute‘‘ und analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Werke. Schließlich fasst das Fazit die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die Relevanz des Gedichts in Bezug auf die Sprachkrise des 20. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Angst vor der Sprache, Mangelhaftigkeit der Sprache, Sprachkrise des 20. Jahrhunderts, Interpretation, Gedichtanalyse, Vergleich, ‚,Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort‘, Rainer Maria Rilke, ‚,Wünschelrute‘, Joseph von Eichendorff. Diese Themen werden anhand der zentralen Elemente des Gedichts wie Inhalt, Aufbau, Sprache und Epochenzuordnung untersucht.
- Quote paper
- Selin E. (Author), 2018, Analyse von Rainer Maria Rilkes "Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428897