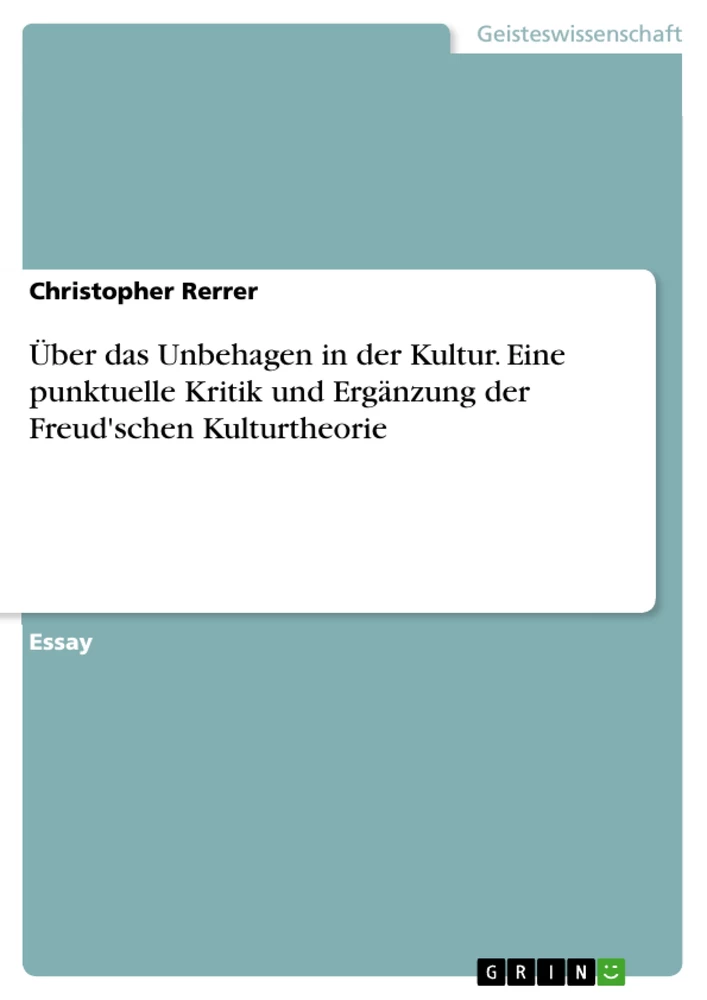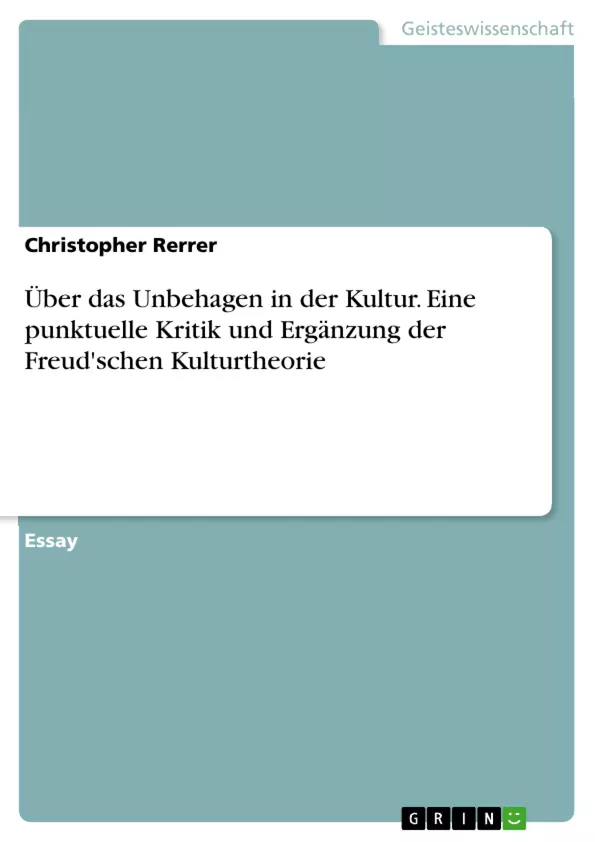Die Schrift „Das Unbehagen in der Kultur“, die 1930 von Freud verfasst wurde, stellt eine der einflussreichsten kulturtheoretischen Abhandlungen des frühen 20. Jahrhunderts dar. In dieser Schrift stellt Freud die zunächst ungeheuerlich anmutende These auf, dass die Kultur für den Menschen eine Quelle des Leidens ist, die ihn neurotisch werden lässt, "weil er das Maß an Versagung nicht ertragen kann, das ihm die Gesellschaft im Dienste ihrer kulturellen Ideale auferlegt." (Freud, 1997)
Nicht nur für die weniger versierten Leser, als auch jene, die sich seine Anhänger nennen und nannten, brachte laut Theodor Reik die Veröffentlichung dieses Werkes zumindest Verlegenheit mit sich. Nicht nur entfernte sich Freud von der Neurosenlehre, sondern steckte ein deutlich größeres, unübersichtlicheres und schwer zu durchdringendes Forschungsfeld ab, er legt auch eine – im Vergleich zu seinen früheren Schriften – größere Subjektivität an den Tag und lässt seine Einstellung in Bezug auf die großen Umwälzungen dieser Zeit erahnen.
Wie also ist Freuds Versuch der Betrachtung der abendländischen Kultur mit seiner Psychoanalyse in Einklang zu bringen? Nach Freuds Ansicht ist das Problem der Kultur unwiderruflich und von Anfang an mit dem Thema und der Aufgabenstellung seiner Psychoanalyse, dem hysterischen Unglück, verbunden. Freud arbeitet also den Kultur-Konflikt heraus, der auf dem Leidzusammenhang zwischen subjektiven Bedürfnissen und Wünschen, sowie den herrschenden kollektiven Normen und Geboten fußt.
Es scheint so, als ob diese Schrift Freuds doch in erstaunlicher Weise die logische Konsequenz vorangegangener Arbeiten ist. Schließlich wird der Patient in der Analyse nie isoliert gesehen. Der Psychoanalytiker wird erkennen, dass das durch die offene Assoziation gewonnene Wissen stets einen Leidzusammenhang darstellt, der auf dem Konflikt zwischen Bedürfnissen und Wünschen des Subjekts, sowie Geboten, Normen und Verboten des Kollektivs basiert. Die soziokulturelle Dimension ist der Psychoanalyse damit praktisch inhärent und so verwundert es, dass dieses Werk wegen seines subjektiven Zugangs und der Beschäftigung mit der abendländischen Kultur unter Freudianern eine weniger geachtete Stellung besitzt, obwohl es uns doch verrät, was der eigentliche Gegenstand der Psychoanalyse ist: die kulturelle Lebenspraxis.
Inhaltsverzeichnis
- Über das Unbehagen in der Kultur
- Die Kultur als Quelle des Leidens
- Das ozeanische Gefühl
- Die drei Möglichkeiten der Leidbewältigung
- Glück und Lustprinzip
- Die Quellen des Leidens
- Strategien der Leidvermeidung
- Der technische Fortschritt und die Krankheit der Kultur
- Die Arbeit als Lebenskunst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich kritisch mit Freuds Kulturtheorie auseinander, die in seinem Werk „Das Unbehagen in der Kultur“ dargelegt wird. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit die Kultur für den Menschen eine Quelle des Leidens ist und welche Strategien der Leidbewältigung Freud vorschlägt.
- Die Rolle der Kultur im Entstehen von psychischem Leid
- Das „ozeanische Gefühl“ und die Religion
- Die drei Möglichkeiten der Leidbewältigung: Ablenkung, Kunst und Rauschmittel
- Das Streben nach Glück und das Lustprinzip
- Die kritische Betrachtung des technischen Fortschritts und dessen Auswirkungen auf die Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer detaillierten Betrachtung des „ozeanischen Gefühls“ und seiner Bedeutung für die Religiosität. Freud stellt fest, dass dieses Gefühl für ihn nicht nachvollziehbar ist und es als einen ursprünglichen Verbundenzustand zwischen Ich und Es interpretiert.
Im Anschluss werden drei Möglichkeiten zur Bewältigung des Leids vorgestellt: Ablenkung durch wissenschaftliche Beschäftigung, Ersatzbefriedigung durch Kunst und Rauschmittel. Es wird die Frage aufgeworfen, welche Rolle die Religion in diesem Zusammenhang spielt.
Freud argumentiert, dass das Streben nach Glück der wichtigste Lebenszweck des Menschen ist. Dabei wird zwischen positiven und negativen Glückszuständen unterschieden. Das „Lustprinzip“ wird als Grundlage des menschlichen Verhaltens beschrieben, das jedoch in Konflikt mit der Realität steht.
Der Autor erläutert verschiedene Quellen des menschlichen Leids: die Hinfälligkeit des Körpers, die Übermacht der Natur und die Unzulänglichkeit der menschlichen Beziehungen. Besonders die menschlichen Beziehungen werden als Quelle von Leid hervorgehoben.
Im weiteren Verlauf werden verschiedene Strategien zur Vermeidung von Leid vorgestellt, darunter Eremitage, Intoxikation und die Sublimierung von Trieben. Freud betrachtet die wissenschaftliche Mission zur Unterwerfung der Natur als eine wirksame Strategie der Leidbewältigung.
Der Text endet mit einer kritischen Betrachtung des technischen Fortschritts und seiner ambivalenten Auswirkungen auf die Kultur. Die Arbeit wird als ein wichtiger Faktor für die Eingliederung des Einzelnen in die Gesellschaft und für die Stabilität der Libido-Ökonomie betrachtet.
Schlüsselwörter
Kultur, Leid, Psychoanalyse, „ozeanisches Gefühl“, Religion, Glück, Lustprinzip, Realitätsprinzip, Sublimierung, technischer Fortschritt, Arbeit, Lebenskunst.
Häufig gestellte Fragen zu Freuds „Das Unbehagen in der Kultur“
Warum sieht Freud die Kultur als Quelle des Leidens?
Freud argumentiert, dass die Kultur dem Menschen ein Maß an Triebversagung auferlegt, das schwer zu ertragen ist. Die Gesellschaft verlangt den Verzicht auf individuelle Bedürfnisse zugunsten kultureller Ideale, was zu Neurosen führen kann.
Was versteht Freud unter dem „ozeanischen Gefühl“?
Es beschreibt ein Gefühl der Unbegrenztheit und Verbundenheit mit dem Ganzen, das oft als Ursprung religiöser Bedürfnisse gilt. Freud selbst interpretiert es psychoanalytisch als einen frühen Zustand der Ich-Entwicklung.
Welche drei Strategien zur Leidbewältigung nennt der Text?
Freud nennt die Ablenkung (z.B. durch Arbeit oder Wissenschaft), die Ersatzbefriedigung (insbesondere durch die Kunst) und den Einsatz von Rauschmitteln.
Was ist der Unterschied zwischen dem Lustprinzip und dem Realitätsprinzip?
Das Lustprinzip strebt nach sofortiger Befriedigung aller Bedürfnisse. Das Realitätsprinzip hingegen zwingt den Menschen, Wünsche aufzuschieben oder anzupassen, um in der physischen und sozialen Welt zu überleben.
Welche Rolle spielt die Arbeit in Freuds Kulturtheorie?
Arbeit wird als „Lebenskunst“ und wichtiger Faktor für die Eingliederung des Einzelnen in die Gesellschaft gesehen. Sie hilft bei der Sublimierung von Trieben und stabilisiert die psychische Ökonomie.
Wie bewertet Freud den technischen Fortschritt?
Freud betrachtet ihn ambivalent: Einerseits dient er der Unterwerfung der Natur und Leidvermeidung, andererseits löst er das „Unbehagen“ nicht auf und kann sogar zur „Krankheit der Kultur“ beitragen.
- Citation du texte
- Christopher Rerrer (Auteur), 2018, Über das Unbehagen in der Kultur. Eine punktuelle Kritik und Ergänzung der Freud'schen Kulturtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428926