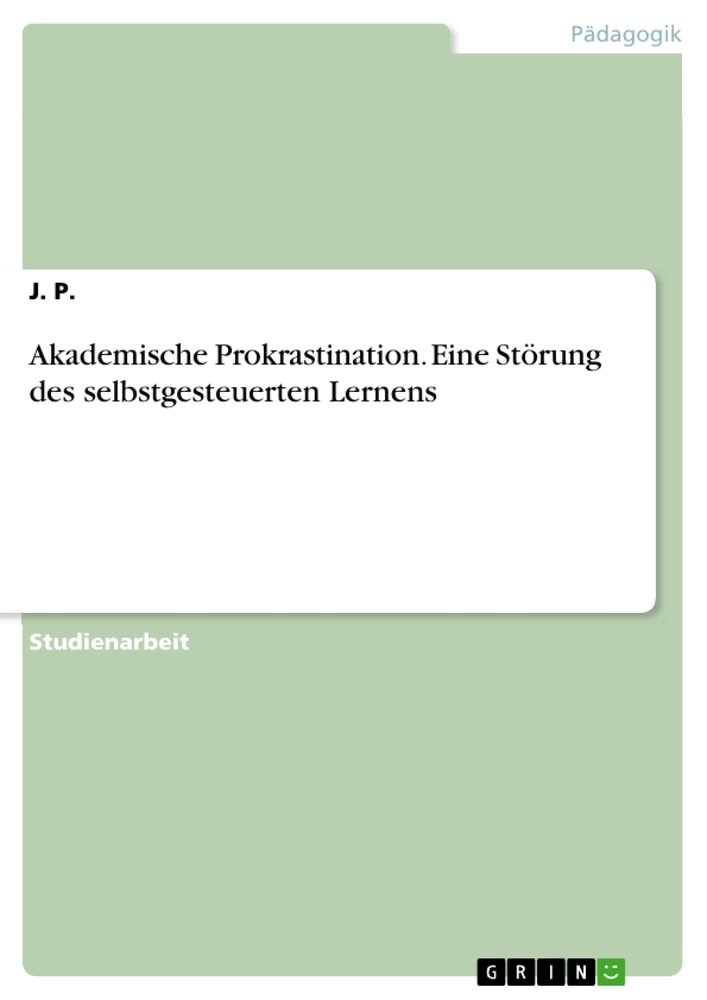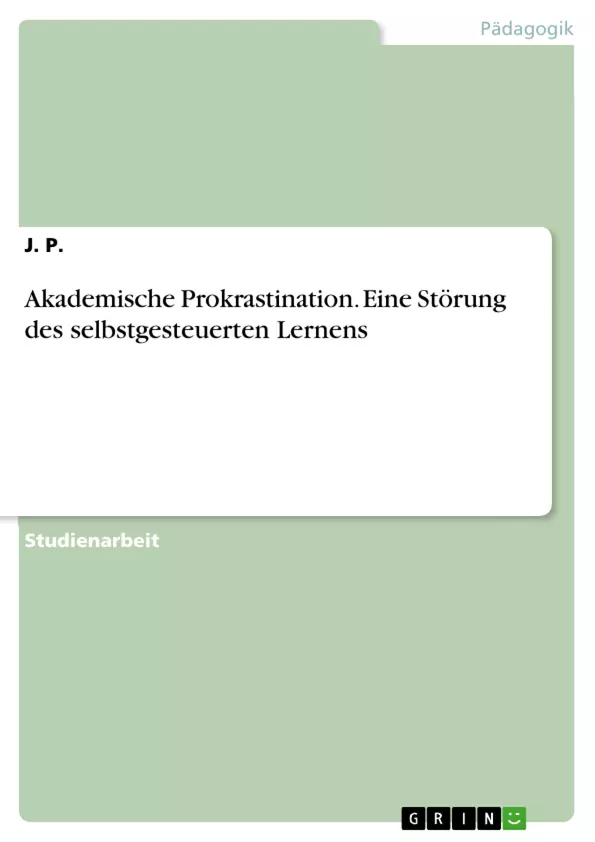Das Kernstück dieser Arbeit bildet die Beleuchtung der Problematik und der Behandlungsmöglichkeit akademischen Aufschiebeverhaltens. Anhand der Darstellung zweier ausgewählter Interventionsstudien soll geklärt werden, ob durch eine Kurzzeittherapie bereits eine Verbesserung der Symptomatik möglich ist.
Im Rahmen dessen testeten Höcker, A. et al. 2008 eine Intervention zum „Pünktlich Beginnen“ und „Realistisch Planen“. Sie konnten eine signifikante Verbesserung des Prokrastinationsverhaltens finden, aber bezüglich des „Pünktlich Beginnens“ wurde kein signifikantes Ergebnis erzielt. In der Untersuchung von Höcker et al. (2012), welche den Teilnehmern die Methode der Arbeitszeitrestriktion näherbringen sollte, konnten durchweg bedeutsame Verbesserungen ausgemacht werden. So auch für den pünktlichen Lernbeginn.
Zum Abschluss dieser Arbeit erfolgt eine kritische Diskussion der Ergebnisse, des methodischen Vorgehens und zu Implikationen für die Praxis, gefolgt von einem Ausblick auf mögliche Ansätze für zukünftige Forschung auf diesem Gebiet.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 3. Darstellung der Studie I
- 3.1. Theoretischer Hintergrund
- 3.2. Methodik
- 3.3. Statistische Mittel & Ergebnisse
- 4. Darstellung der Studie II
- 4.1. Theoretischer Hintergrund
- 4.2. Methodik
- 4.3. Statistische Mittel & Ergebnisse
- 5. Diskussion
- 5.1. Bedeutung der Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund
- 5.2. Kritik
- 5.3. Praktische Implikationen
- 6. Fazit & Ausblick
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik akademischen Aufschiebeverhaltens (Prokrastination) und die Wirksamkeit kurz verhaltenstherapeutischer Maßnahmen. Anhand zweier Interventionsstudien wird analysiert, ob kurzfristige Therapien zu einer Verbesserung der Symptomatik führen können. Der Fokus liegt auf der Evaluation der Effektivität verschiedener Interventionsansätze.
- Wirksamkeit kurz verhaltenstherapeutischer Interventionen bei akademischer Prokrastination
- Analyse der Ergebnisse zweier Interventionsstudien zum Thema "Pünktlich Beginnen" und "Realistisch Planen" sowie Arbeitszeitrestriktion.
- Bedeutung selbstregulierten Lernens im Kontext von Prokrastination
- Methodische Aspekte der Studien und deren Kritik
- Praktische Implikationen der Forschungsergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema akademische Prokrastination ein, definiert den Begriff und beschreibt seine Relevanz im universitären Kontext. Sie verweist auf die hohe Prävalenz von Prokrastination unter Studierenden und hebt die Bedeutung der Selbststeuerung im Zusammenhang mit diesem Problem hervor. Die Arbeit kündigt die Analyse zweier Interventionsstudien an, die die Wirksamkeit von Kurzinterventionen untersuchen.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund von selbstgesteuertem Handeln und Lernen im Kontext von Prokrastination. Es erläutert Konzepte des selbstregulierten Lernens und stellt das Rubikon-Modell von Heckhausen vor, um die motivationalen und volitionalen Aspekte von Handlungen zu erklären. Der Zusammenhang zwischen diesen Konzepten und dem Aufschiebeverhalten wird hergestellt.
3. Darstellung der Studie I: Dieses Kapitel präsentiert die erste Interventionsstudie, die sich auf die Interventionen "Pünktlich Beginnen" und "Realistisch Planen" konzentriert. Der theoretische Hintergrund der Studie, die Methodik und die statistischen Ergebnisse werden detailliert beschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Wirksamkeit dieser Interventionen auf das Prokrastinationsverhalten der Teilnehmer.
4. Darstellung der Studie II: Dieses Kapitel beschreibt die zweite Interventionsstudie, die die Methode der Arbeitszeitrestriktion untersucht. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel werden der theoretische Hintergrund, die Methodik und die statistischen Ergebnisse detailliert dargestellt. Die Ergebnisse werden in Bezug auf ihre Bedeutung für die Verbesserung des akademischen Aufschiebeverhaltens interpretiert.
5. Diskussion: Die Diskussion analysiert die Ergebnisse beider Studien im Kontext des theoretischen Hintergrunds. Es wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Methodik beider Studien geführt und die praktischen Implikationen der Ergebnisse für die Behandlung von Prokrastination werden erörtert. Die Diskussion legt den Fokus auf die Stärken und Schwächen der untersuchten Interventionsansätze.
Schlüsselwörter
Akademische Prokrastination, Selbstreguliertes Lernen, Kurzinterventionen, Verhaltenstherapie, Interventionsstudie, Pünktlich Beginnen, Realistisch Planen, Arbeitszeitrestriktion, Selbststeuerung, Motivation, Volition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wirksamkeit kurz verhaltenstherapeutischer Interventionen bei akademischer Prokrastination
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit kurz verhaltenstherapeutischer Maßnahmen zur Verbesserung akademischen Aufschiebeverhaltens (Prokrastination). Sie analysiert zwei Interventionsstudien, die verschiedene Interventionsansätze ("Pünktlich Beginnen", "Realistisch Planen" und Arbeitszeitrestriktion) evaluieren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wirksamkeit kurz verhaltenstherapeutischer Interventionen bei akademischer Prokrastination, die Analyse der Ergebnisse zweier Interventionsstudien, die Bedeutung selbstregulierten Lernens im Kontext von Prokrastination, methodische Aspekte der Studien und deren Kritik sowie die praktischen Implikationen der Forschungsergebnisse.
Welche Studien werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert zwei Interventionsstudien. Studie I konzentriert sich auf die Interventionen "Pünktlich Beginnen" und "Realistisch Planen". Studie II untersucht die Methode der Arbeitszeitrestriktion. Für jede Studie werden der theoretische Hintergrund, die Methodik und die statistischen Ergebnisse detailliert beschrieben.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Konzepte des selbstregulierten Lernens und das Rubikon-Modell von Heckhausen, um die motivationalen und volitionalen Aspekte von Handlungen und deren Zusammenhang mit Prokrastination zu erklären.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Darstellung der Studie I, Darstellung der Studie II, Diskussion, Fazit & Ausblick und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Akademische Prokrastination, Selbstreguliertes Lernen, Kurzinterventionen, Verhaltenstherapie, Interventionsstudie, Pünktlich Beginnen, Realistisch Planen, Arbeitszeitrestriktion, Selbststeuerung, Motivation, Volition.
Welche Ergebnisse werden diskutiert?
Die Diskussion analysiert die Ergebnisse beider Studien im Kontext des theoretischen Hintergrunds. Es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Methodik und die Erörterung der praktischen Implikationen der Ergebnisse für die Behandlung von Prokrastination. Der Fokus liegt auf den Stärken und Schwächen der untersuchten Interventionsansätze.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit und der Ausblick werden im letzten Kapitel präsentiert und fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
- Arbeit zitieren
- J. P. (Autor:in), 2016, Akademische Prokrastination. Eine Störung des selbstgesteuerten Lernens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429088