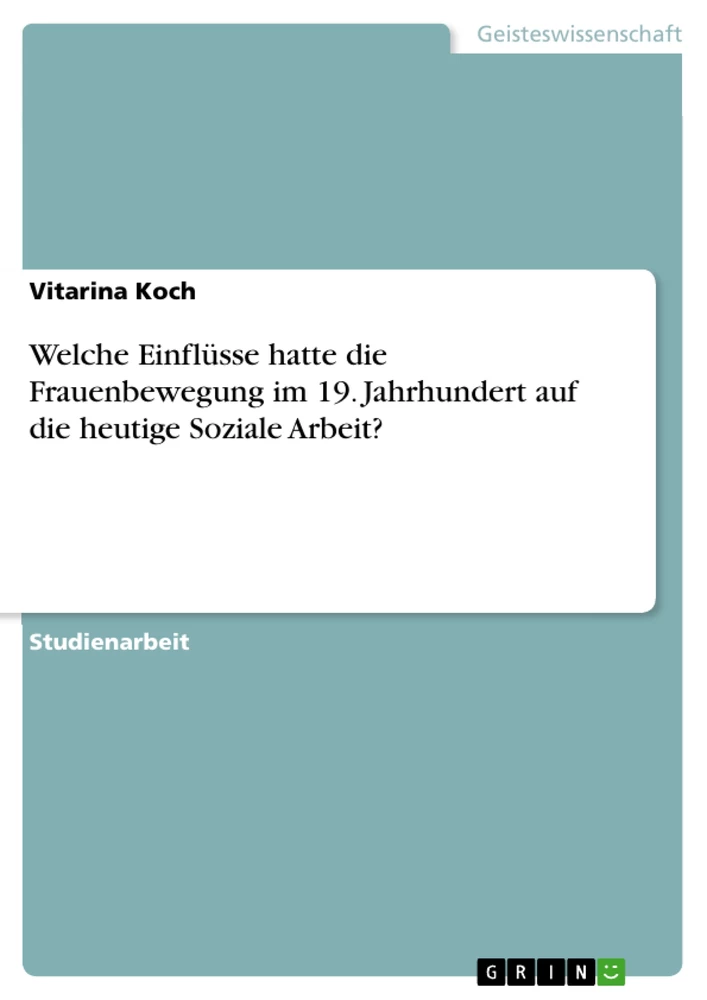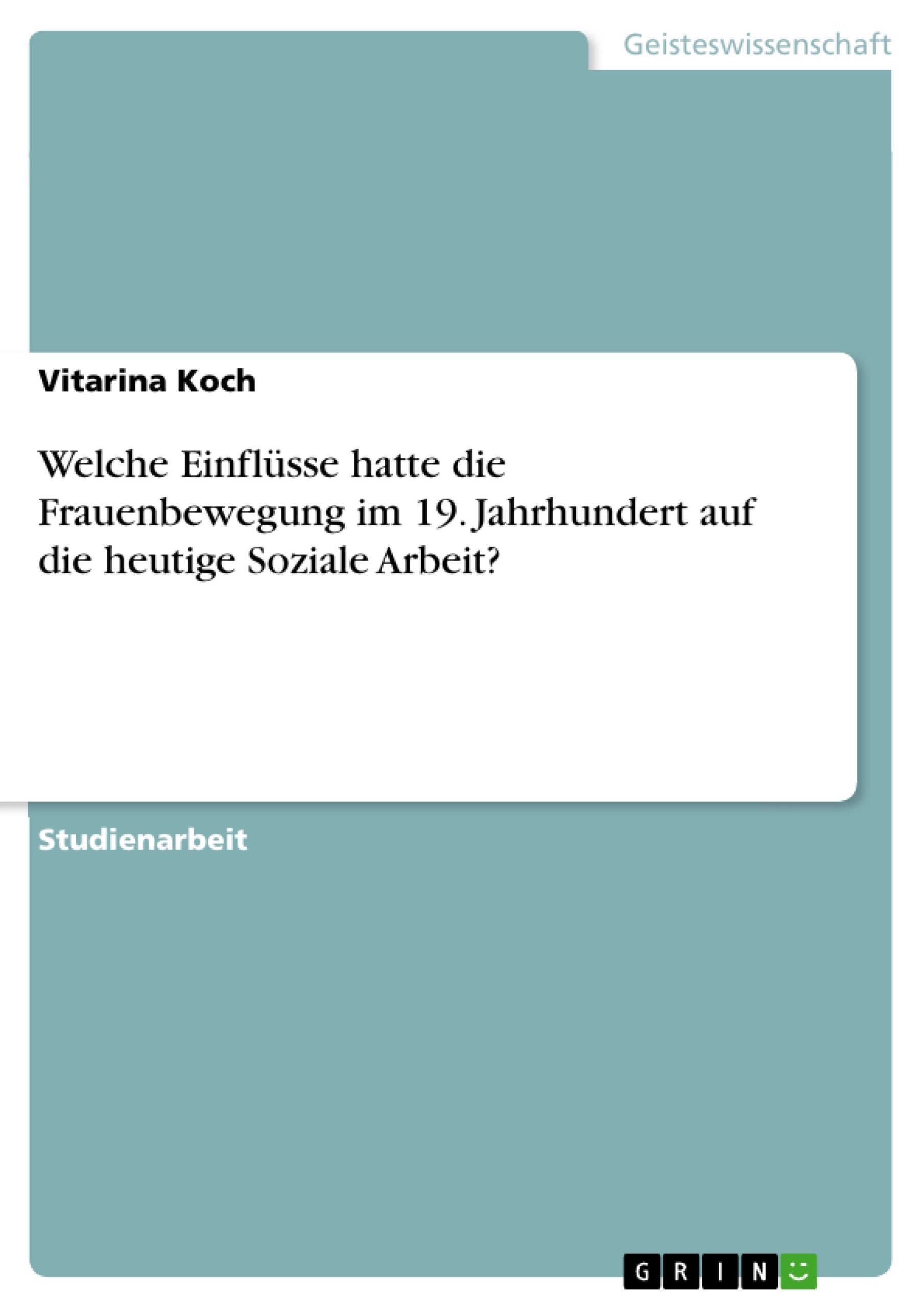Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Die konkrete Fragestellung ist, welche Aspekte aus der damaligen Frauenbewegung in der heutigen Sozialen Arbeit vorkommen. Zu allererst werden zwei Charaktere der Bewegung vorgestellt. Daraufhin werden die Lebensläufe der beiden Frauen ausgewertet und die vorkommenden Aspekte, die aus den Biographien hervorgehen, zusammengefasst.
Auch in der heutigen Zeit gibt es eine Frauenbewegung, diese wird durch in den Punkten geschlechtliche Gleichstellung und Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen kurz beleuchtet. Zum Schluss folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und eine Einschätzung darüber, warum es wichtig ist, dass es die Soziale Arbeit in dieser Form gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Frauenbewegung
- Charaktere der Frauenbewegung
- Alice Salomon
- Louise Otto-Peters
- Auswertung der Lebensläufe
- Erkenntnisse von Alice Salomon
- Erkenntnisse von Louise Otto-Peters
- Aspekte, die in der heutigen Sozialen Arbeit der Frauenbewegung vorkommen
- Frauenbewegung in der heutigen Zeit
- Geschlechtliche Gleichberechtigung
- Kampf gegen Gewalt gegen Frauen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert auf die heutige Soziale Arbeit. Sie untersucht, welche Aspekte aus der damaligen Frauenbewegung in der heutigen Praxis der Sozialen Arbeit relevant sind.
- Einfluss der Frauenbewegung auf die Entwicklung der Sozialen Arbeit
- Bedeutung von Alice Salomon für die Soziale Arbeit
- Vergleich der Lebensläufe von Alice Salomon und Louise Otto-Peters
- Relevanz der Frauenbewegung für die geschlechtliche Gleichstellung
- Kampf gegen Gewalt gegen Frauen in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung der Sozialen Arbeit als professionelles Handlungsfeld. Das zweite Kapitel definiert den Begriff "Frauenbewegung" und erläutert die historischen Wurzeln der Bewegung. Kapitel 3 stellt zwei wichtige Charaktere der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert vor: Alice Salomon und Louise Otto-Peters. Es werden ihre Lebensläufe und ihre Beiträge zur Frauenbewegung und zur Sozialen Arbeit beschrieben. Kapitel 4 analysiert die Lebensläufe der beiden Frauen und zieht Schlussfolgerungen für die heutige Soziale Arbeit. Kapitel 5 diskutiert die Auswirkungen der Frauenbewegung auf die Praxis der Sozialen Arbeit in der Gegenwart. Abschließend beleuchtet Kapitel 6 die aktuelle Situation der Frauenbewegung im Kontext von geschlechtlicher Gleichstellung und dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen.
Schlüsselwörter
Frauenbewegung, Soziale Arbeit, Alice Salomon, Louise Otto-Peters, Geschlechtliche Gleichstellung, Gewalt gegen Frauen, Geschichte, Theorie, Arbeitsfelder, Menschenrechte, soziale Gleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts auf die heutige Soziale Arbeit?
Die Frauenbewegung legte den Grundstein für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit und brachte Themen wie Bildung und Schutzrechte für Frauen voran.
Welche Rolle spielte Alice Salomon?
Alice Salomon gilt als Wegbereiterin der Sozialen Arbeit als Wissenschaft und gründete die erste soziale Frauenschule in Deutschland.
Wer war Louise Otto-Peters?
Louise Otto-Peters war eine zentrale Figur der ersten deutschen Frauenbewegung und kämpfte vor allem für das Recht auf Erwerbsarbeit und politische Teilhabe.
Welche Aspekte der historischen Bewegung sind heute noch aktuell?
Dazu gehören die geschlechtliche Gleichstellung, der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und die Forderung nach gleichen Bildungschancen.
Warum ist die Geschichte der Frauenbewegung für Sozialarbeiter wichtig?
Das Verständnis der historischen Wurzeln hilft, aktuelle Ungleichheiten besser zu analysieren und die Bedeutung von Menschenrechten in der Praxis zu stärken.
- Arbeit zitieren
- Vitarina Koch (Autor:in), 2016, Welche Einflüsse hatte die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert auf die heutige Soziale Arbeit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429218