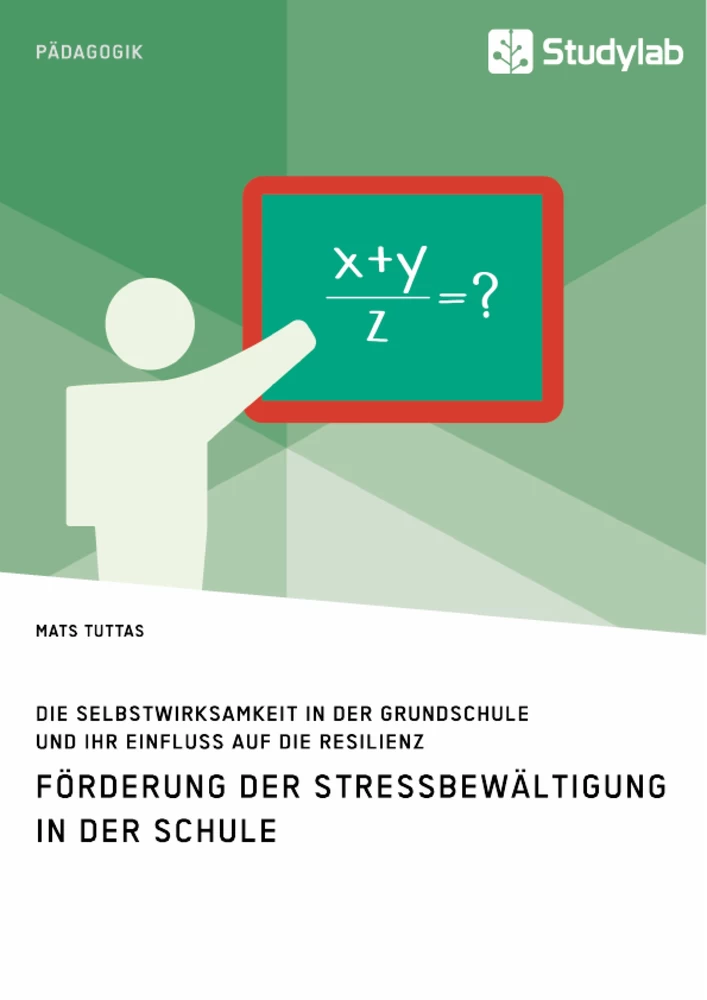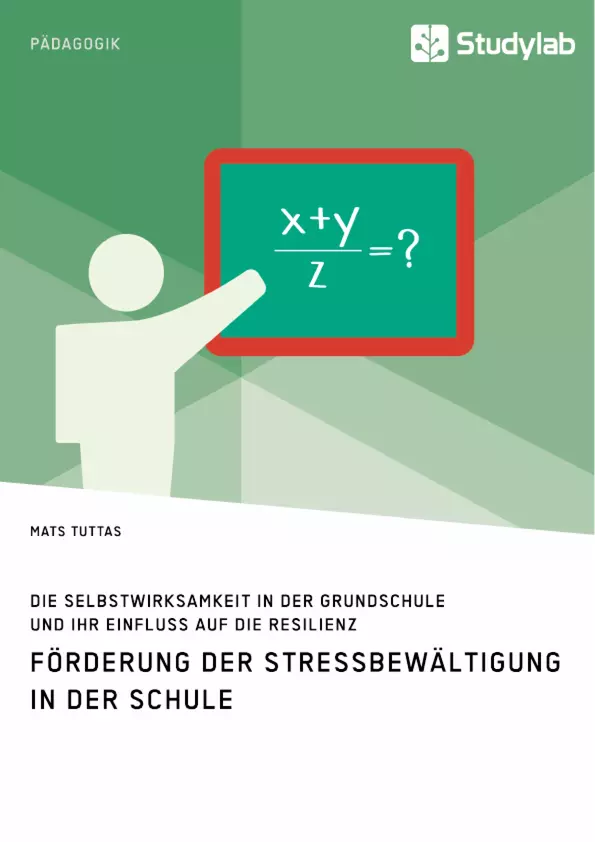Hohe Flexibilität, Leistungsvermögen und Stressresistenz. Das sind die Anforderungen, die unsere Gesellschaft sowie die Wirtschaft an die gerade heranwachsende Generation Z stellen. Nach ihrem Schulabschluss steht sie vor den Herausforderungen einer von Stress bewegten Welt.
Ausschlaggebend ist dann vor allem das Vertrauen in sich selbst. Die sogenannte Selbstwirksamkeit gibt den Absolventen die Zuversicht, stressige Situationen erfolgreich meistern zu können. In seiner Publikation erklärt Mats Tuttas, wie der Schulunterricht dieses Selbstvertrauen fördern kann.
Entscheiden die Erfahrungen in der Grundschule darüber, wie ein Kind später mit dem Druck der modernen Gesellschaft umgeht? Welche Rolle spielt das Stigma eines niedrigeren Bildungszweiges bei der Selbstwirksamkeit eines Heranwachsenden? Tuttas verdeutlicht, unter welchem Druck Schüler heute stehen und zeigt, wie man Stress erfolgreich bewältigt.
Aus dem Inhalt:
- Selbstwirksamkeit;
- Resilienz;
- Stress;
- Schule;
- Pädagogik;
- Generation Z
Inhaltsverzeichnis
- Schulpädagogische und bildungspolitische Aktualität
- Thesenformulierung und Vorgehensweise
- Zentrale Aspekte der Resilienzforschung
- Theoretische Einbettung des Resilienzkonzepts
- Die Entstehung der Resilienzforschung
- Risikoerhöhende und -mildernde Faktoren in der Entwicklung Heranwachsender
- Das Resilienzfaktorenkonzept
- Exemplarische Aufarbeitung des Resilienzfaktors Selbstwirksamkeit
- Die Selbstwirksamkeitstheorie nach Bandura
- Entwicklungskontexte der Selbstwirksamkeit
- Quellen der Selbstwirksamkeit
- Empirische Aufarbeitung des Forschungsstandes
- Ausgewählte Forschungsergebnisse mit resilienzorientierter Ausrichtung
- Ausgewählte Forschungsergebnisse mit selbstwirksamkeitsorientierter Ausrichtung
- Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 verschiedener Schulformen
- Fragestellung und Forschungshypothese
- Rahmenbedingungen
- Methode
- Evaluation der Forschungsergebnisse
- Zusammenfassung und Diskussion ausgewählter Forschungsergebnisse
- Förderung der Selbstwirksamkeit in der pädagogischen Praxis
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Selbstwirksamkeit auf die Resilienz von Grundschulkindern. Ziel ist es, den Forschungsstand zu diesem Thema darzulegen und praxisrelevante Schlussfolgerungen für die Förderung der Stressbewältigung in der Schule abzuleiten.
- Resilienz und deren Bedeutung für die Entwicklung von Kindern
- Das Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura und dessen Relevanz für die Resilienz
- Faktoren, die die Selbstwirksamkeit beeinflussen
- Empirische Befunde zum Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Resilienz
- Möglichkeiten der Förderung der Selbstwirksamkeit in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Schulpädagogische und bildungspolitische Aktualität: Dieses Kapitel legt die aktuelle Relevanz der Thematik Stressbewältigung und Resilienz im schulischen Kontext dar. Es werden aktuelle bildungspolitische Herausforderungen beleuchtet und die Notwendigkeit einer gezielten Förderung der Stressbewältigung und Resilienz bei Kindern und Jugendlichen begründet. Die These der Arbeit und die gewählte Vorgehensweise werden hier vorgestellt und erläutert, um den Rahmen der Untersuchung abzugrenzen und die methodische Herangehensweise zu definieren. Es wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben, um dem Leser die Struktur und den roten Faden der Untersuchung verständlich zu machen. Die Bedeutung der frühzeitigen Prävention von psychischen Belastungen wird hervorgehoben.
Zentrale Aspekte der Resilienzforschung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Resilienzforschung. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zur Definition und Erklärung von Resilienz vorgestellt und diskutiert, sowie die historische Entwicklung des Konzepts nachgezeichnet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Risikofaktoren und protektiven Faktoren, die die Entwicklung von Resilienz beeinflussen. Das Kapitel beschreibt detailliert das Resilienzfaktorenkonzept und die Interaktion verschiedener Faktoren, die zur Entstehung und Stärkung von Resilienz beitragen. Es wird auf die komplexe Wechselwirkung von individuellen, familiären und gesellschaftlichen Einflüssen eingegangen.
Exemplarische Aufarbeitung des Resilienzfaktors Selbstwirksamkeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeitstheorie nach Bandura wird detailliert erläutert, inklusive der Unterscheidung von Wirksamkeits- und Ergebniserwartung. Die Entwicklungskontexte der Selbstwirksamkeit werden im Kindesalter beleuchtet, und es wird erläutert, wie verschiedene Faktoren die Entstehung und Stärkung der Selbstwirksamkeit beeinflussen. Schließlich werden verschiedene Quellen der Selbstwirksamkeit vorgestellt, wie z.B. eigene Erfahrungen, stellvertretende Erfahrungen, verbale Überzeugung und emotionale und physiologische Zustände. Der Zusammenhang zwischen diesen Quellen und der Entwicklung von Resilienz wird diskutiert.
Empirische Aufarbeitung des Forschungsstandes: Dieses Kapitel präsentiert eine systematische Übersicht über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Resilienz und Selbstwirksamkeit. Es werden ausgewählte Forschungsergebnisse mit resilienzorientierter und selbstwirksamkeitsorientierter Ausrichtung vorgestellt und kritisch analysiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung und Interpretation relevanter Studien, die den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Resilienz belegen oder in Frage stellen. Das Kapitel dient dazu, den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema zusammenzufassen und die Lücken in der Forschung aufzuzeigen.
Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 verschiedener Schulformen: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Untersuchung zur Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse verschiedener Schulformen. Die Fragestellung, Hypothese, Methodik und die Ergebnisse der Studie werden detailliert dargestellt. Die Kapitel beschreibt die angewandte Methode, die Stichprobenauswahl und die verwendeten Messinstrumente. Die Auswertung der Daten und die Interpretation der Ergebnisse werden umfassend dargestellt und diskutiert, einschließlich der Limitationen der Studie. Die Ergebnisse liefern wichtige Einblicke in den Zusammenhang zwischen Schulform, Selbstwirksamkeit und schulischer Leistung.
Förderung der Selbstwirksamkeit in der pädagogischen Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Forschungsergebnisse und gibt konkrete Handlungsempfehlungen für die Förderung der Selbstwirksamkeit in der Schule. Es werden verschiedene pädagogische Strategien und Interventionen vorgestellt, die dazu beitragen können, die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern zu stärken. Die Kapitel integriert die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln und bietet konkrete, praxisorientierte Ansätze zur Umsetzung der theoretischen Konzepte. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Stressbewältigung und der Stärkung der psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern.
Schlüsselwörter
Resilienz, Selbstwirksamkeit, Stressbewältigung, Schule, Grundschule, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, pädagogische Praxis, Förderung, Empirische Forschung, Bandura.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Resilienz und Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Selbstwirksamkeit auf die Resilienz von Schülerinnen und Schülern, insbesondere im Kontext der Grundschule. Sie beleuchtet den Forschungsstand, analysiert den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Resilienz und leitet daraus praxisrelevante Schlussfolgerungen für die schulische Förderung der Stressbewältigung ab.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die aktuelle bildungspolitische Relevanz von Resilienz, die theoretischen Grundlagen der Resilienz- und Selbstwirksamkeitstheorie (inkl. Banduras Selbstwirksamkeitstheorie), eine empirische Untersuchung zur Selbstwirksamkeit von Zehntklässlern verschiedener Schulformen und konkrete Handlungsempfehlungen zur Förderung der Selbstwirksamkeit in der pädagogischen Praxis.
Welche Forschungsfragen werden bearbeitet?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Resilienz bei Schülerinnen und Schülern. Die empirische Studie fokussiert auf die Selbstwirksamkeit von Zehntklässlern verschiedener Schulformen und deren mögliche Unterschiede.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert Literaturrecherche und -analyse mit einer empirischen Studie. Die empirische Studie beschreibt die angewandte Methode (detailliert im entsprechenden Kapitel), die Stichprobenauswahl und die verwendeten Messinstrumente. Die Auswertung der Daten und die Interpretation der Ergebnisse werden umfassend dargestellt.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Studie?
Die empirische Studie untersucht die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse verschiedener Schulformen. Die detaillierten Ergebnisse, inklusive der Diskussion und Limitationen der Studie, sind im entsprechenden Kapitel dargestellt. Die Ergebnisse liefern Einblicke in den Zusammenhang zwischen Schulform, Selbstwirksamkeit und schulischer Leistung.
Welche praktischen Implikationen ergeben sich aus der Arbeit?
Die Arbeit bietet konkrete Handlungsempfehlungen für die Förderung der Selbstwirksamkeit in der Schule. Es werden verschiedene pädagogische Strategien und Interventionen vorgestellt, um die Selbstwirksamkeit und damit auch die Resilienz von Schülerinnen und Schülern zu stärken und ihre Stressbewältigung zu verbessern.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Resilienz, Selbstwirksamkeit, Stressbewältigung, Schule, Grundschule, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, pädagogische Praxis, Förderung, Empirische Forschung, Bandura.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: der aktuellen bildungspolitischen Relevanz, zentralen Aspekten der Resilienzforschung, der Selbstwirksamkeitstheorie nach Bandura, einer empirischen Untersuchung zur Selbstwirksamkeit, der Förderung der Selbstwirksamkeit in der Schule und einem Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
- Citar trabajo
- Mats Tuttas (Autor), 2018, Förderung der Stressbewältigung in der Schule. Die Selbstwirksamkeit in der Grundschule und ihr Einfluss auf die Resilienz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429240