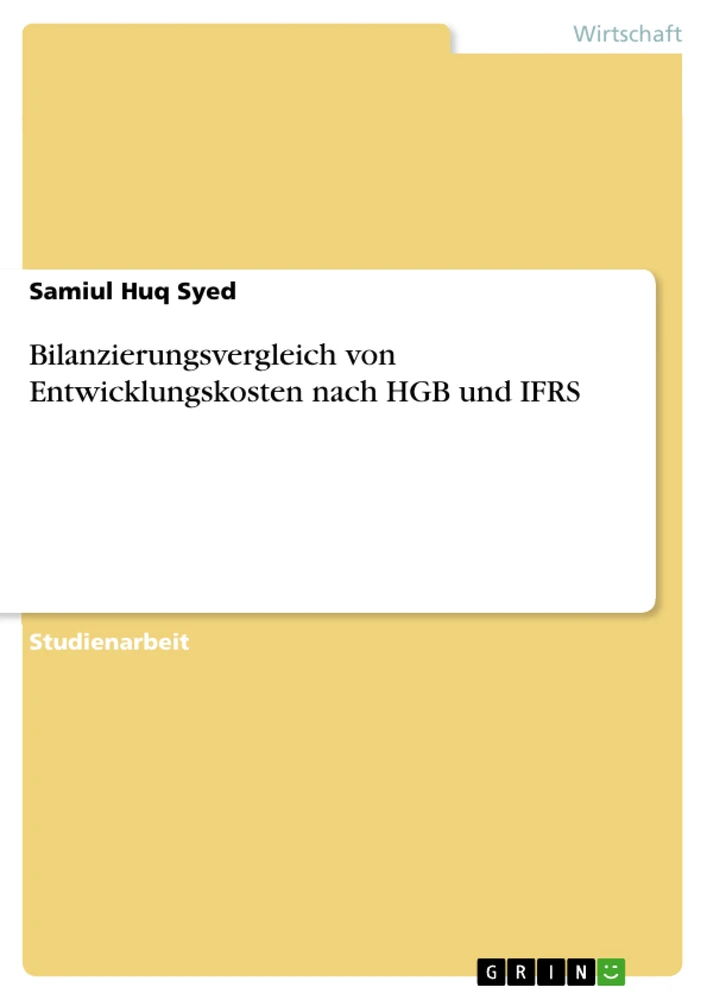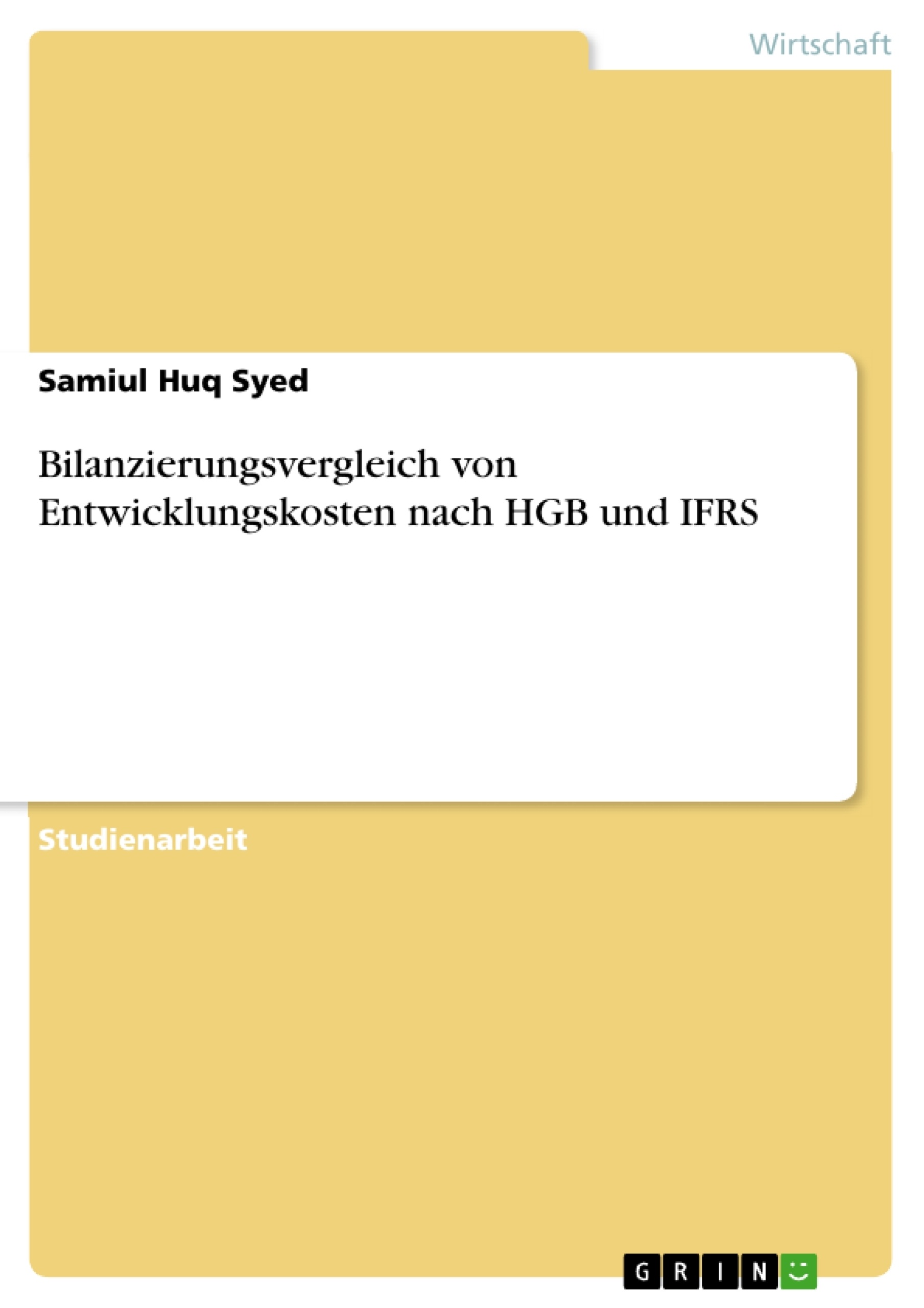Die Bedeutung von Entwicklungskosten ist im Wandel der Zeit immer mehr gewachsen. Grund hierfür ist die Problematik der Bilanzierung nicht-physischer Vermögens. Für die deutsche Bilanzpolitik war dies für eine lange Zeit ein ungeöffnetes Fass. Allerdings entwickelte sich durch die immer mehr steigende internationale Ausrichtung deutscher Unternehmen der Gedanke heraus, eine handelsrechtliche Anpassung für solche Sachverhalte vorzunehmen. Um den Gläubigerschutz aufrecht zu erhalten, und die deutsche Bilanzkultur nicht zu gefährden, wurden bis 2009 keine Veränderungen zur Gestaltung der Entwicklungskosten vorgenommen. Erst durch das Bilanzierungsmodernisierungsgesetz (BilMoG) erfolgte eine Anlehnung an die International Accounting Standards (IAS). In den International Financial Reporting Standards (IFRS) wurde eine Behandlung von nicht-physischen Vermögenswerten bereits früher berücksichtigt. Dadurch versuchte das deutsche Handelsrecht sich durch eine annähernde internationale Ausrichtung weiterzuentwickeln. Es sind demnach gewissen Handlungs- und Gestaltungsspielräume gegeben, die durch eine genauere Analyse verständlich gemacht werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel und Vorgehensweise der Seminararbeit
- 2. Definitionsabgrenzung nach HGB und IFRS
- 3. Bilanzierungsansätze von Entwicklungskosten der Regelwerke
- 3.1 Erläuterung der Bilanzierungsmethodik
- 3.2 Bilanzierung der Entwicklungskosten nach HGB und IFRS
- 3.2.1 Ansatzkriterien
- 3.2.2 Bewertungskriterien
- 3.2.2.1 Erstbewertung
- 3.2.2.2 Folgebewertung
- 3.2.3 Ausweiskriterien
- 4. Praxisbeispiel für die Bilanzierung von Entwicklungskosten
- 5. Fazit
- 5.1 Kritische Würdigung
- 5.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Bilanzierung von Entwicklungskosten im Vergleich nach HGB und IFRS. Sie analysiert die unterschiedlichen Definitionsansätze, Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiskriterien sowie die Auswirkungen auf den Jahresabschluss.
- Definitionen von Entwicklungskosten im HGB und IFRS
- Aktivierung und Bilanzierung von Entwicklungskosten nach HGB und IFRS
- Bewertung von Entwicklungskosten nach Erstbewertung und Folgebewertung
- Ausweis von Entwicklungskosten in der Bilanz, GuV und im Anhang
- Praxisbeispiele und Fallstudien zur Bilanzierung von Entwicklungskosten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Problematik der Bilanzierung nicht-physischer Vermögenswerte, insbesondere Entwicklungskosten - Zielsetzung der Seminararbeit: Vergleich der Bilanzierung von Entwicklungskosten nach HGB und IFRS - Vorgehensweise: Abgrenzung der Definitionen, strukturierte Analyse der Kriterien und ein Praxisbeispiel
- Kapitel 2: Definitionsabgrenzung nach HGB und IFRS - Unterscheidung zwischen immateriellen Vermögensgegenständen (HGB) und Vermögenswerten (IFRS) - Definition von Forschung und Entwicklung nach HGB und IFRS, insbesondere die Abgrenzung der Phasen
- Kapitel 3: Bilanzierungsansätze von Entwicklungskosten der Regelwerke - Erläuterung der Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiskriterien - Vergleich der Aktivierungspflicht und -wahlrechte nach HGB und IFRS - Bewertung der Entwicklungskosten nach Anschaffungs- und Herstellungskosten - Folgebewertung: Abschreibungspflicht und -methoden sowie Neubewertungsmodell
- Kapitel 4: Praxisbeispiel für die Bilanzierung von Entwicklungskosten - Analyse des Aktivierungsverhaltens von Unternehmen am Markt - Ausweis von Entwicklungskosten in den Geschäftsberichten von kapitalmarktorientierten Unternehmen und Kapitalgesellschaften
Schlüsselwörter
Entwicklungskosten, immaterielles Vermögen, Bilanzierung, HGB, IFRS, Ansatzkriterien, Bewertungskriterien, Ausweiskriterien, Aktivierung, Abschreibung, Neubewertung, Praxisbeispiel, Geschäftsbericht, F&E-Intensität, Aktivierungsquote, Bilanzpolitik, Gestaltungsspielraum, Innovationstätigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied bei der Bilanzierung von Entwicklungskosten nach HGB und IFRS?
Nach HGB besteht ein Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände, während IFRS bei Erfüllung bestimmter Kriterien eine Aktivierungspflicht vorsieht.
Dürfen Forschungskosten aktiviert werden?
Nein, sowohl nach HGB als auch nach IFRS müssen Forschungskosten zwingend als Aufwand verrechnet werden; nur Entwicklungskosten sind unter Bedingungen aktivierbar.
Was änderte das BilMoG für die deutsche Bilanzierung?
Das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 ermöglichte erstmals die Aktivierung von Entwicklungskosten im HGB, um eine Annäherung an internationale Standards zu erreichen.
Welche Kriterien müssen für eine Aktivierung nach IFRS erfüllt sein?
Es müssen sechs Kriterien gemäß IAS 38 erfüllt sein, darunter die technische Realisierbarkeit, die Absicht der Fertigstellung und der Nachweis eines künftigen wirtschaftlichen Nutzens.
Welche Rolle spielt der Gläubigerschutz im HGB?
Der Gläubigerschutz ist im HGB dominanter, weshalb bei einer Aktivierung von Entwicklungskosten eine Ausschüttungssperre für die entsprechenden Beträge gilt.
- Citation du texte
- Samiul Huq Syed (Auteur), 2018, Bilanzierungsvergleich von Entwicklungskosten nach HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429397