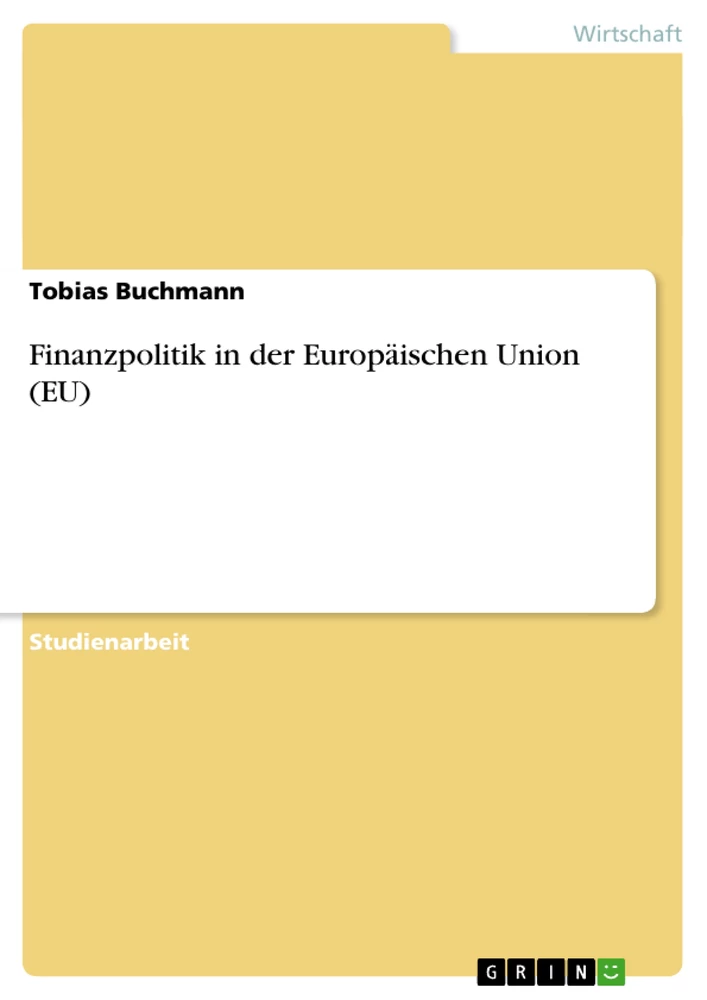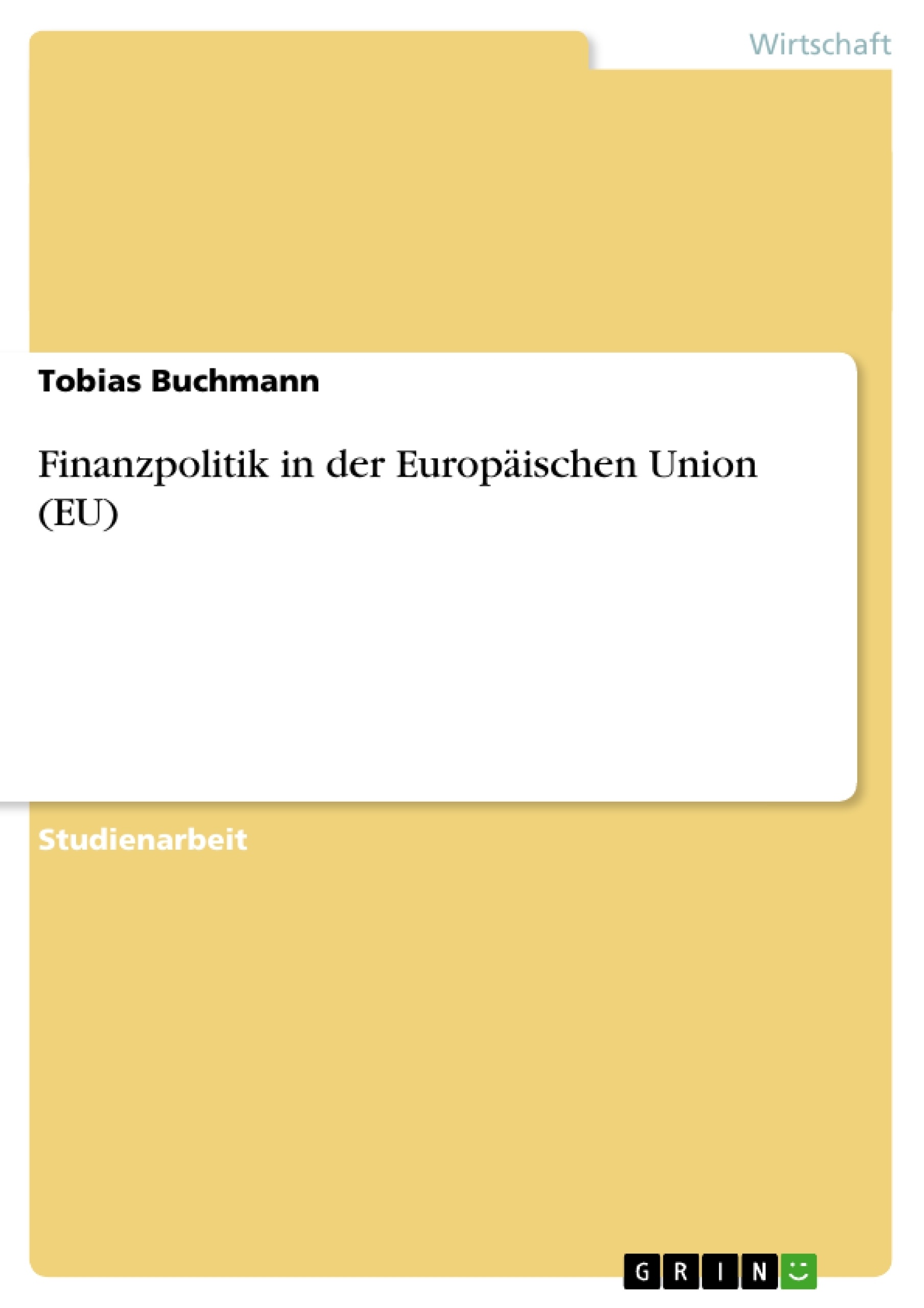Seit dem Inkrafttreten der 3. Stufe der Europäischen Währungsunion (EWU) am 1. Januar 1999 hat die Finanzpolitik in der Europäischen Union eine neue Bedeutung erhalten. Ebenso bedeutet der Übergang zu einer gemeinsamen Währung für die Europäische Zentralbank eine neue Stufe der geldpolitischen Verantwortung im EURO-Raum. Die fiskalpolitische Verantwortung bleibt dagegen im Zuständigkeitsbereich der Nationalstaaten. Der somit veränderte Rahmen der Finanz- und Geldpolitik bringt neue Aufgaben der Koordination und Zielbestimmung mit sich.
Zu untersuchen ist, in wie weit sich eine Aufteilung der geldpolitischen und fiskalpolitischen Verantwortung auf einerseits eine supranationale Institution und auf der anderen Seite auf die Nationalstaaten in der Praxis bewerkstelligen lässt.
Es stellt sich auch die Frage, ob die Europäische Währungsunion die Ziele konjunkturelle Unterstützung und Konsolidierung der Staathaushalte in den Mitgliedsländern fördert. Dabei ist ein möglicher Konflikt zwischen den beiden Zielen zu beachten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Mögliche Probleme durch Änderungen im Institutionengefüge
- 1. Einfluss der EWU auf die Geldpolitik
- 2. Lösung der Konflikte durch eine zentralisierte Fiskalpolitik?
- 3. Die nationale Fiskalpolitik als Lösungsinstrument:
- 4. Sind finanzpolitische Kooperationen sinnvoll?
- III. Auswirkungen der Europäischen Währungsunion auf den Verschuldungsstand
- 1. Ökonomische Anreize der Verschuldung
- a. Spill-Over-Effekte und Crowding-Out durch nationale Verschuldung
- b. Bailout-Effekte in der EWU
- c. Bonitätseffekt in der EWU
- d. Möglichkeit des Trittbrettfahrens
- 2. Polit-ökonomische Anreize der Verschuldung
- 3. Situation in der Union
- 1. Ökonomische Anreize der Verschuldung
- III. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt
- 1. Maßnahmen der politischen Disziplinierung
- 2. Einschränkungen der Budgetflexibilität
- IV. Fazit:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen der Europäischen Währungsunion (EWU) auf die Finanzpolitik in der Europäischen Union. Im Vordergrund steht die Frage, ob die geteilte Verantwortung für Geld- und Finanzpolitik zwischen supranationalen Institutionen und Nationalstaaten zu Konflikten führt. Die Arbeit analysiert mögliche Probleme, die aus der Einführung der EWU resultieren, und untersucht die Auswirkungen auf den Verschuldungsstand der Mitgliedsstaaten.
- Die Auswirkungen der EWU auf die Geldpolitik und die Herausforderungen asymmetrischer Schocks
- Die Rolle der nationalen Finanzpolitik im Kontext der EWU und die Frage nach möglichen Kooperationslösungen
- Die Analyse der ökonomischen und polit-ökonomischen Anreize der Verschuldung in der EWU
- Die Bedeutung des Stabilitäts- und Wachstumspakts für die Koordinierung der Finanzpolitik in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Finanzpolitik in der Europäischen Union im Kontext der EWU dar und führt in die Fragestellungen der Arbeit ein. Kapitel II beleuchtet die möglichen Probleme, die aus der Aufteilung der Geld- und Finanzpolitik auf supranationale und nationale Ebenen resultieren. Kapitel III untersucht die Auswirkungen der EWU auf den Verschuldungsstand der Mitgliedsstaaten, wobei sowohl ökonomische als auch polit-ökonomische Anreize der Verschuldung beleuchtet werden. Kapitel IV befasst sich mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und den Maßnahmen der politischen Disziplinierung, die die Einhaltung der fiskalpolitischen Regeln gewährleisten sollen.
Schlüsselwörter
Europäische Währungsunion (EWU), Finanzpolitik, Geldpolitik, Institutionengefüge, Verschuldungsstand, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Asymmetrische Schocks, Spill-Over-Effekte, Crowding-Out, Bailout-Effekte, Bonitätseffekt, Trittbrettfahren, Politische Disziplinierung.
- Citar trabajo
- Tobias Buchmann (Autor), 2005, Finanzpolitik in der Europäischen Union (EU), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42939