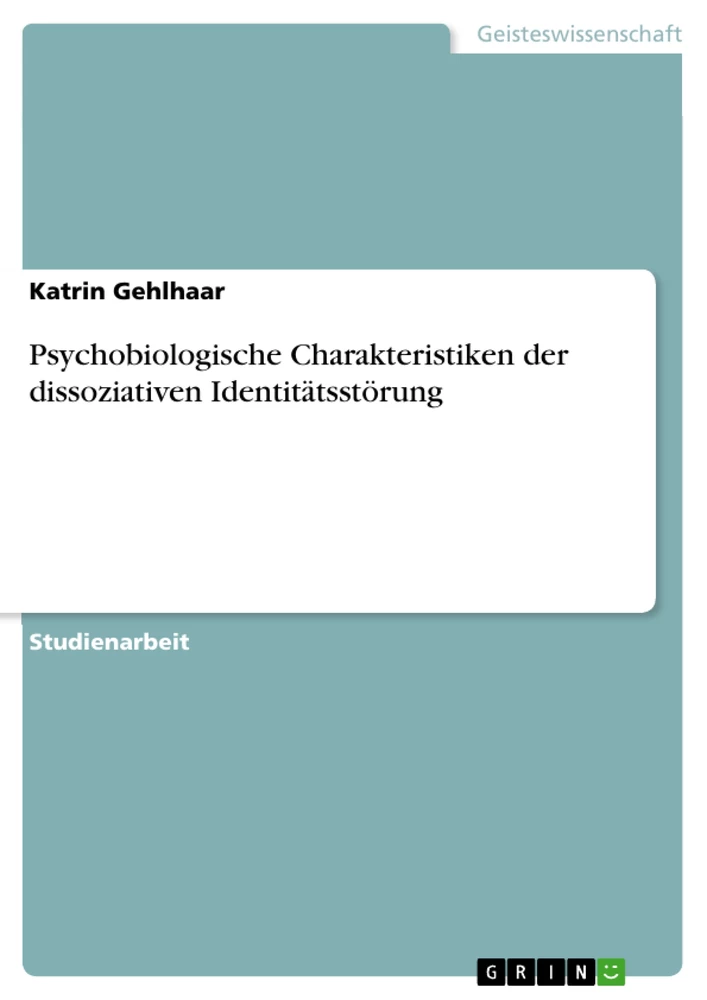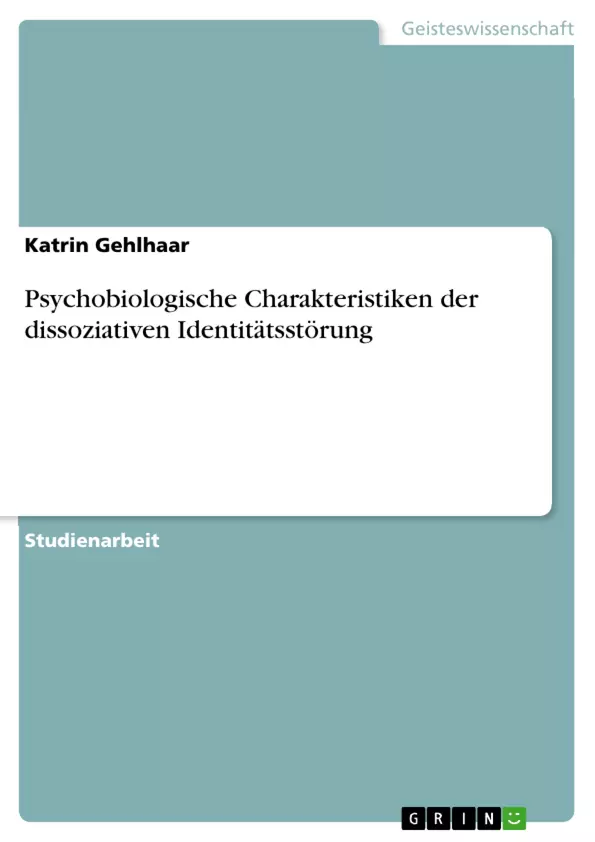Nach einer kurzen Darstellung der dissoziativen Identitätsstörung (DIS) werde ich in der folgenden Hausarbeit die Befunde zweier psychobiologischer Studien näher erläutern. Im Anschluss daran werde ich kurz weitere Einblicke in Studien zu psychobiologischen Charakteristiken der DIS geben und abschließend mit einem Ausblick und künftigen Forschungsanregungen enden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzdarstellung der dissoziativen Identitätsstörung
- Studie zu psychobiologischen Charakteristiken der dissoziativen Identitätsstörung (Reinders et al., 2006)
- Hintergrund und Hypothesen
- Methoden
- Ergebnisse
- Schlussfolgerungen
- Psychobiologische Studie zu echten und simulierten dissoziativen Identitätszuständen (Reinders et al., 2012)
- Hintergrund und Hypothesen
- Methoden
- Ergebnisse
- Schlussfolgerungen
- Weitere Studien über neuronale Prozesse bei Patienten mit dissoziativer Identitätsstörung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der dissoziativen Identitätsstörung (DIS) und beleuchtet die psychobiologischen Charakteristiken dieser komplexen Traumafolgestörung. Die Arbeit analysiert zwei Studien, die sich mit dem neuronalen Korrelat der DIS befassen und beleuchtet weitere Forschungsansätze.
- Psychobiologische Charakteristiken der DIS
- Neurobiologische Unterschiede zwischen ANPs und EPs
- Die Rolle von Traumatisierung bei der Entstehung der DIS
- Die Bedeutung von fMRT-Studien zur Untersuchung der DIS
- Zukünftige Forschungsansätze und Therapieoptionen für DIS-Patienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die historische Entwicklung des Verständnisses der dissoziativen Identitätsstörung (DIS) und stellt die Bedeutung der aktuellen psychobiologischen Forschung für die Erklärung dieser Störung heraus. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von zwei Studien, die mithilfe bildgebender Verfahren (fMRT) neuronale Unterschiede bei DIS-Patienten im Vergleich zu Kontrollgruppen untersuchen.
Das zweite Kapitel stellt die DIS als Traumafolgestörung vor und beschreibt die Entstehung unterschiedlicher Identitätszustände (Innenpersonen) als Folge schwerer Traumatisierungen. Die Unterschiede zwischen ANPs (anscheinend normale Persönlichkeitsanteile) und EPs (emotionale Persönlichkeitsanteile) werden hervorgehoben, und es wird die Rolle von Konditionierungsprozessen bei der Entstehung der DIS erläutert.
Kapitel drei fokussiert auf die Studie von Reinders et al. (2006), die sich mit den neuronalen Reaktionen von DIS-Patienten auf traumabezogene Stimuli beschäftigt. Die Studie zeigt, dass ANPs und EPs unterschiedliche Reaktionsmuster im Gehirn aufweisen, was die Annahme von unterschiedlichen neuronalen Verarbeitungsprozessen in den beiden Identitätszuständen unterstützt.
Kapitel vier analysiert die Studie von Reinders et al. (2012), die die neuronalen Unterschiede zwischen echten und simulierten dissoziativen Identitätszuständen untersucht. Diese Studie bestätigt die Ergebnisse der vorherigen Studie und liefert weitere Hinweise auf die neurobiologische Grundlage der DIS.
Kapitel fünf gibt einen kurzen Überblick über weitere Studien, die neuronale Prozesse bei Patienten mit DIS untersucht haben. Es werden unterschiedliche Forschungsansätze und die Bedeutung dieser Forschung für ein besseres Verständnis der DIS hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Hauptaugenmerke dieser Arbeit liegen auf der dissoziativen Identitätsstörung (DIS), den psychobiologischen Charakteristiken der DIS, neurobiologischen Unterschieden zwischen ANPs und EPs, Traumatisierung, fMRT-Studien, neuronalen Reaktionen auf traumabezogene Stimuli, und den zukünftigen Forschungsansätzen und Therapieoptionen für DIS-Patienten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine dissoziative Identitätsstörung (DIS)?
Die DIS ist eine komplexe Traumafolgestörung, bei der eine Person zwei oder mehr getrennte Identitätszustände entwickelt, oft als Schutzmechanismus nach schweren Kindheitstraumata.
Was unterscheidet ANPs von EPs?
ANPs (anscheinend normale Persönlichkeitsanteile) bewältigen den Alltag und verdrängen das Trauma, während EPs (emotionale Persönlichkeitsanteile) die traumatischen Erinnerungen und intensiven Gefühle tragen.
Können neuronale Unterschiede bei DIS-Patienten gemessen werden?
Ja, fMRT-Studien von Reinders et al. zeigen unterschiedliche Aktivitätsmuster im Gehirn, je nachdem, welcher Identitätszustand (ANP oder EP) gerade aktiv ist.
Lässt sich eine echte DIS von einer simulierten Störung unterscheiden?
Untersuchungen zeigen, dass die neuronalen Reaktionen bei echten Patienten spezifisch sind und sich signifikant von Personen unterscheiden, die versuchen, die Symptome zu simulieren.
Welche Rolle spielt die Konditionierung bei der DIS?
Traumabezogene Reize können als Auslöser (Trigger) fungieren, die durch Konditionierungsprozesse einen automatischen Wechsel zwischen den Identitätszuständen bewirken.
- Citar trabajo
- Katrin Gehlhaar (Autor), 2013, Psychobiologische Charakteristiken der dissoziativen Identitätsstörung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429590