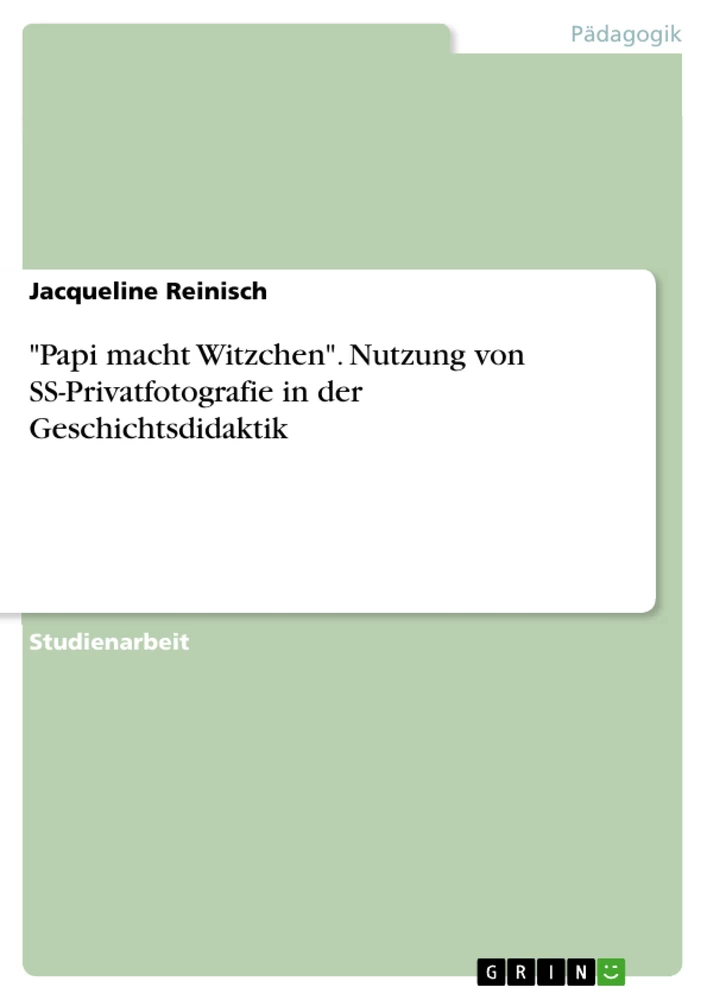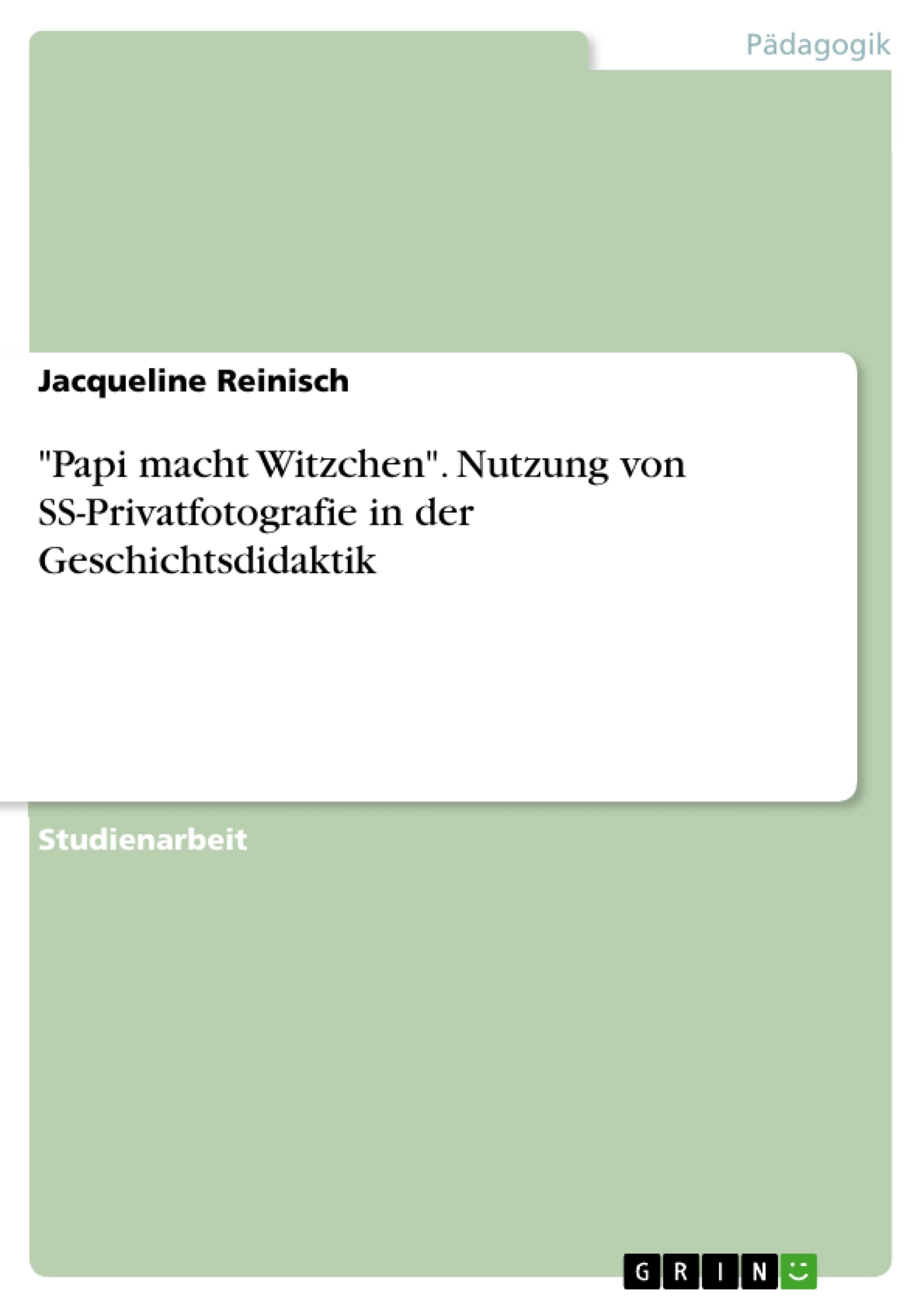„Papi macht Witzchen“. Ordnet man diesen kurzen Satz als Bildunterschrift in einem Fotoalbum ein, so entstehen in der kollektiven Bildvorstellung meist Szenen von lachenden Kindern und Eltern inmitten eines friedvollen Familienlebens. Genau solch eine Szene findet sich auch auf dem dazugehörigen Foto von Artwin Koch mit seinem Vater. Was dieses idyllische Szenario jedoch verschweigt, ist die unmittelbare Nähe der Aufnahme zum Konzentrationslager Buchenwald, in dem im Zeitraum zwischen 1937-1945 unter der anteiligen Leitung von Karl Koch über 55.000 Menschen zu Tode kamen. Wie konnte eine solche Familienidylle im Bewusstsein zu den Geschehnissen im Lager erhalten und gelebt werden?
Auch innerhalb des Lagers wurden durch SS-Angehörige sowohl private als auch dienstliche Fotografien angefertigt. Doch welchen Zweck erfüllte diese Art der Fotografie und welche Bedeutung kann sie noch in der heutigen Geschichtswissenschaft tragen? Diese Arbeit soll der Frage nachgehen, auf welche Weise private SS-Fotoalben innerhalb der Geschichtsdidaktik eingesetzt werden und welche Chancen sich daraus ergeben können.
Dafür soll zunächst das eigene Selbstbild von SS-Angehörigen sowie deren Nutzung der Fotografie innerhalb der Konzentrationslager-SS erläutert werden. Im Anschluss werden Teile des Fotoalbums für Artwin Koch, das auf dem Gelände des Konzentrationslagers Buchenwald angelegt wurde, als Hauptuntersuchungsgegenstand vorgestellt und mit Auszügen eines weiteren Albums verglichen.
Im letzten Abschnitt dieser Seminararbeit soll untersucht werden, wie diese Alben zum einen unter quellenkritischer Betrachtungsweise und zum anderen unter inhaltlichem Aspekt in der Geschichtsdidaktik dienlich sein können und welche Chancen sich daraus für das Geschichtsverständnis von Schülerinnen und Schülern (nachfolgend SuS) ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Nutzung von Fotografie der SS und die darin enthaltene Ideologie
- 3. Beispielauswahl privater Fotoalben
- 3.1. Das Fotoalbum für Artwin Koch
- 3.2. Das Fotoalbum von Karl Höcker
- 4. Didaktischer Einsatz von SS-Privatfotografie
- 4.1. Quellenkritischer Einsatz
- 4.2. Inhaltlicher Einsatz
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den didaktischen Einsatz von privaten Fotoalben der SS im Geschichtsunterricht. Die Arbeit analysiert zunächst die Funktion von Fotografie innerhalb der SS und die darin enthaltene Ideologie, um anschließend anhand ausgewählter Fotoalben (Artwin Koch und Karl Höcker) deren potentiellen Einsatz im Unterricht zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten des quellenkritischen und inhaltlichen Umgangs mit diesem Material.
- Die Rolle der Fotografie in der NS-Propaganda und Selbstinszenierung der SS
- Analyse der privaten Fotoalben der SS als Quellen historischer Ereignisse
- Der kontrastierende Vergleich zwischen inszenierter Normalität und der Realität des Konzentrationslagers
- Didaktische Möglichkeiten des Einsatzes von SS-Privatfotografie im Geschichtsunterricht
- Quellenkritische Auseinandersetzung mit der Aussagekraft der Fotos
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem didaktischen Einsatz von privaten SS-Fotoalben im Geschichtsunterricht. Sie verwendet das Beispiel eines Fotos von Artwin Koch mit seinem Vater, das eine scheinbare Familienidylle in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagers Buchenwald zeigt, um den Widerspruch zwischen inszenierter Normalität und schrecklicher Realität zu verdeutlichen. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die methodische Vorgehensweise, indem sie die Analyse des Selbstbildes der SS-Angehörigen und die Untersuchung ausgewählter Fotoalben ankündigt. Die Schlussfolgerungen hinsichtlich der didaktischen Anwendung dieser Quellen werden ebenfalls in Aussicht gestellt.
2. Die Nutzung von Fotografie der SS und die darin enthaltene Ideologie: Dieses Kapitel beleuchtet die Funktion von Fotografie im NS-Staat, besonders innerhalb der SS. Es wird dargelegt, wie Fotografie als Werkzeug der Propaganda diente, um Verantwortung zu verschleiern und ein gewünschtes Bild der SS zu konstruieren. Der Text beschreibt unterschiedliche Arten der Fotografie: inszenierte Aufnahmen zur Außenwirkung des Lagers (Baumaßnahmen, Ordnung, Häftlingsarbeit), Aufnahmen mit konkreten Verwertungsinteressen (Unfälle, Selbstmorde), und die Darstellung von SS-Feierlichkeiten und -Lebenskultur, um Normalität zu suggerieren. Der Fokus liegt auf der bewussten Gestaltung der Bilder, um die eigene Legitimation zu stärken und die Realität im Konzentrationslager zu verschleiern. Der Betrachtungspunkt der Bilder wird klar als der der herrschenden Macht definiert, im Gegensatz zur Perspektive der Häftlinge.
3. Beispielauswahl privater Fotoalben: Dieses Kapitel präsentiert ausgewählte Beispiele aus privaten Fotoalben von SS-Angehörigen, insbesondere das Album von Artwin Koch aus Buchenwald, welches im Detail untersucht wird. Der Vergleich mit anderen Alben, wie beispielsweise dem von Karl Höcker, dient der Veranschaulichung verschiedener Aspekte der privaten Fotografie der SS. Die Analyse dieser Alben liefert weitere Einblicke in die Strategien der Selbstinszenierung und die selektive Wahrnehmung der eigenen Rolle. Es zeigt, wie private Bilder die Realität des Konzentrationslagers zu verdrängen versuchten, und eine scheinbare Normalität suggerierten.
4. Didaktischer Einsatz von SS-Privatfotografie: Dieser Abschnitt erörtert die Möglichkeiten des didaktischen Einsatzes der analysierten Fotoalben im Geschichtsunterricht. Er unterscheidet dabei zwischen einem quellenkritischen und einem inhaltlichen Ansatz. Der quellenkritische Ansatz fokussiert die Untersuchung der Bilder hinsichtlich ihrer Entstehung, ihrer Intention und ihrer Aussagekraft. Der inhaltliche Ansatz nutzt die Bilder, um die Lebenswelt der SS-Angehörigen, ihre Ideologie und die damit verbundenen Widersprüche zu beleuchten und mit dem Grauen des Konzentrationslagers zu konfrontieren. Der Abschnitt unterstreicht die Bedeutung der kritischen Auseinandersetzung mit den Quellen und betont deren Wert für ein vertieftes Geschichtsverständnis der Schülerinnen und Schüler.
Schlüsselwörter
SS-Privatfotografie, NS-Propaganda, Geschichtsdidaktik, Konzentrationslager Buchenwald, Quellenkritik, Selbstinszenierung, Ideologie, Erinnerungskultur, Bildanalyse, Geschichtsverständnis.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Didaktischer Einsatz von SS-Privatfotografie
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den didaktischen Einsatz von privaten Fotoalben der SS im Geschichtsunterricht. Sie analysiert die Funktion von Fotografie innerhalb der SS und die darin enthaltene Ideologie, um anhand ausgewählter Fotoalben (Artwin Koch und Karl Höcker) deren potentiellen Einsatz im Unterricht zu beleuchten. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten des quellenkritischen und inhaltlichen Umgangs mit diesem Material.
Welche Fotoalben werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere das private Fotoalbum von Artwin Koch aus Buchenwald und vergleicht dieses mit dem Album von Karl Höcker. Die Analyse dieser Alben soll Einblicke in die Strategien der Selbstinszenierung und die selektive Wahrnehmung der eigenen Rolle geben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Fotografie in der NS-Propaganda und Selbstinszenierung der SS, die Analyse der privaten Fotoalben als Quellen historischer Ereignisse, den Vergleich zwischen inszenierter Normalität und der Realität des Konzentrationslagers, didaktische Möglichkeiten des Einsatzes von SS-Privatfotografie im Geschichtsunterricht und die quellenkritische Auseinandersetzung mit der Aussagekraft der Fotos.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Nutzung von Fotografie der SS und der darin enthaltenen Ideologie, ein Kapitel zur Beispielauswahl privater Fotoalben (Artwin Koch und Karl Höcker), ein Kapitel zum didaktischen Einsatz von SS-Privatfotografie (quellenkritischer und inhaltlicher Ansatz) und eine Schlussbemerkung. Die Einleitung verdeutlicht den Widerspruch zwischen inszenierter Normalität und schrecklicher Realität anhand eines Beispielfotos.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen bezüglich der didaktischen Anwendung der analysierten Quellen werden in der Schlussbemerkung der Arbeit zusammengefasst. Die Arbeit betont die Bedeutung der kritischen Auseinandersetzung mit den Quellen und deren Wert für ein vertieftes Geschichtsverständnis der Schülerinnen und Schüler.
Welchen didaktischen Ansatz verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit unterscheidet zwischen einem quellenkritischen und einem inhaltlichen Ansatz für den Einsatz der Fotos im Geschichtsunterricht. Der quellenkritische Ansatz konzentriert sich auf die Untersuchung der Entstehung, Intention und Aussagekraft der Bilder. Der inhaltliche Ansatz nutzt die Bilder, um die Lebenswelt der SS-Angehörigen, ihre Ideologie und die damit verbundenen Widersprüche zu beleuchten und mit dem Grauen des Konzentrationslagers zu konfrontieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: SS-Privatfotografie, NS-Propaganda, Geschichtsdidaktik, Konzentrationslager Buchenwald, Quellenkritik, Selbstinszenierung, Ideologie, Erinnerungskultur, Bildanalyse, Geschichtsverständnis.
Wie wird die Funktion der Fotografie innerhalb der SS dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Fotografie als Werkzeug der NS-Propaganda, das dazu diente, Verantwortung zu verschleiern und ein gewünschtes Bild der SS zu konstruieren. Es werden verschiedene Arten der Fotografie unterschieden: inszenierte Aufnahmen zur Außenwirkung, Aufnahmen mit konkreten Verwertungsinteressen und die Darstellung von SS-Feierlichkeiten und -Lebenskultur zur Suggestion von Normalität. Der Fokus liegt auf der bewussten Gestaltung der Bilder zur Stärkung der eigenen Legitimation und Verschleierung der Realität im Konzentrationslager.
- Citar trabajo
- Jacqueline Reinisch (Autor), 2015, "Papi macht Witzchen". Nutzung von SS-Privatfotografie in der Geschichtsdidaktik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429870