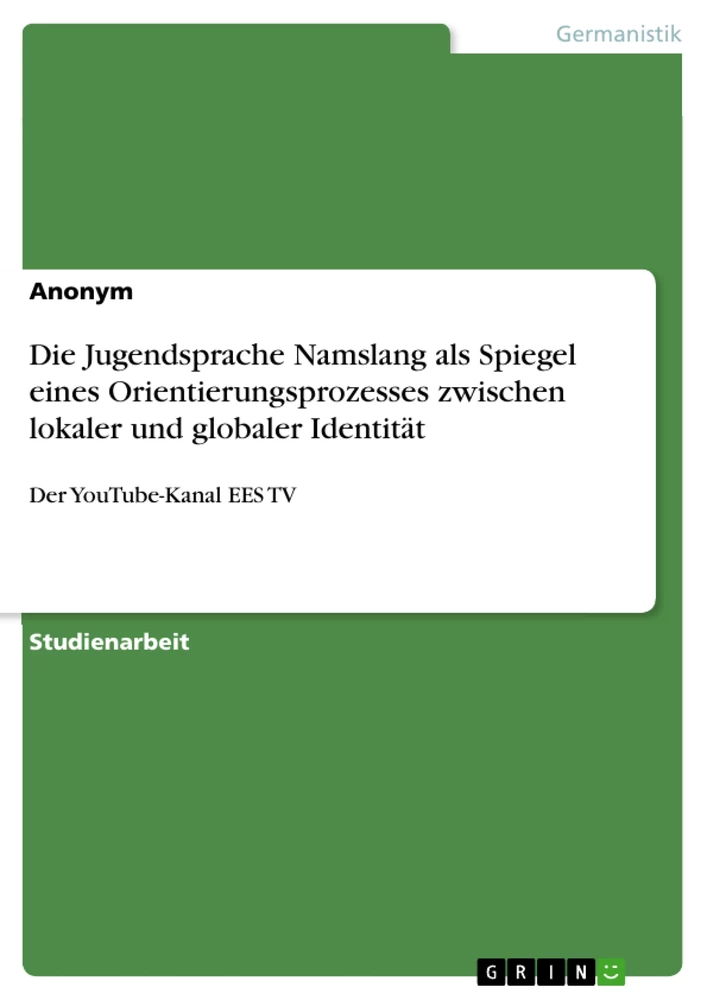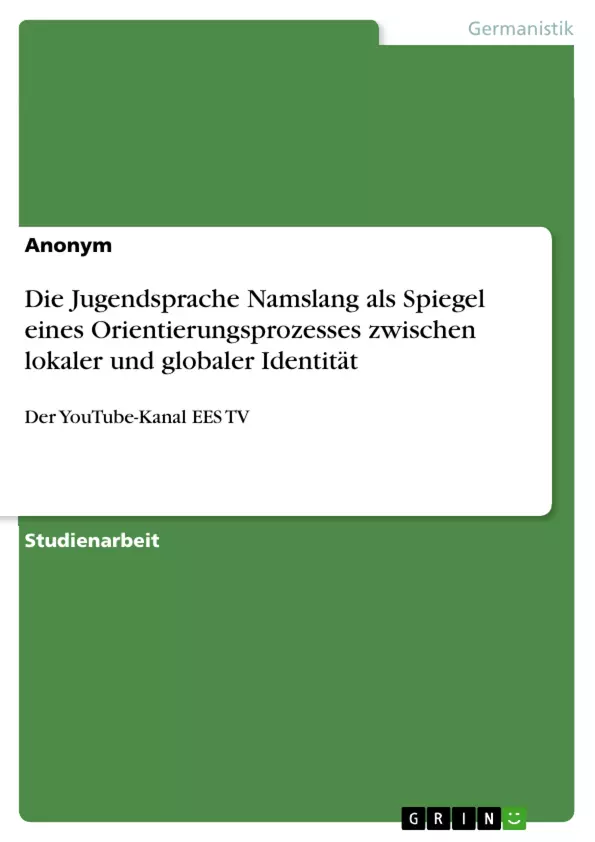In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der Frage, inwieweit sich die Lebenswirklichkeit einer neuen deutschstämmigen namibischen Generation in der Umgangsvarietät Namslang widerspiegelt. Anhand der Analyse des YouTube-Kanals EES TV untermauere ich die These, dass Namslang zwei Aspekte besonders reflektiert. Zum einen zeigt die Nutzung dieser Umgangsvarietät durch den deutsch-namibischen Rapper und Betreiber des Kanals EES (mit bürgerlichem Namen Eric Sell) die Überwindung alter, unter anderem sprachlich manifestierter Strukturen, zum anderen auch die Suche nach einer Orientierung zwischen regionaler Verwurzelung und globaler Aufgeschlossenheit.
Hierzu erfolgt zunächst eine Nachvollziehung der Entwicklung von dem durch Sprachkontakt mit deutschen Siedlern entstandenen „Südwesterdeutsch“ hin zu einer postkolonial kontextualisierten und durch einen multilingualen Alltag geprägten Umgangsvarietät Namslang. Anschließend wird besonderes Augenmerk auf den durch lexikalische Transferenzen geprägten Sprachgebrauch des Musikers gelegt, um anschließend eine soziolinguistische Verortung dieser sprachlichen Phänomene vornehmen zu können.
Dabei ist die Frage genauso von Interesse, inwieweit Namslang Kriterien einer Jugendsprache erfüllt, wie die, weshalb Entlehnungen aus den Bantu- und Khoisan-Sprachen neben denen aus dem Afrikaans und dem Englischen sehr viel seltener vorkommen. Schließlich werde ich auch das Präsentationsmedium des YouTube-Kanals in die Überlegungen miteinbeziehen.
Mit Hilfe ausgewählter Strophen des Stücks „Diese NAM BOYS“ von EES feat. Manni$ wird nachgewiesen, dass sich auch hier die internationale Ausrichtung einer neuen, durch das Internet weltweit vernetzten Generation zeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Von ,,Südwesterdeutsch“ zu Namlsang im postkolonialen Namibia
- 2.2 Lexikalische Transferenzen am Beispiel von EES TV
- 2.3 Soziolinguistische Einordnung von EES Sprachgebrauch
- Schlussbetrachtung
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Umgangsvarietät Namslang im Kontext des YouTube-Kanals EES TV, um die Lebenswirklichkeit einer neuen deutschstämmigen namibischen Generation zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie Namslang die Überwindung alter sprachlicher Strukturen sowie die Suche nach einer Orientierung zwischen regionaler Verwurzelung und globaler Aufgeschlossenheit widerspiegelt.
- Die Entwicklung von "Südwesterdeutsch" zu Namslang im postkolonialen Namibia
- Lexikalische Transferenzen und deren Auswirkungen auf den Sprachgebrauch von EES TV
- Soziolinguistische Einordnung von Namslang und seine Merkmale als Jugendsprache
- Der Einfluss des YouTube-Kanals auf die Präsentation von Namslang und die internationale Vernetzung
- Die Rolle von Namslang als Spiegel der Identität einer neuen Generation deutschstämmiger Namibier
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die These der Arbeit vor: Inwiefern spiegelt die Umgangsvarietät Namslang die Lebenswirklichkeit einer neuen deutschstämmigen namibischen Generation wider? Die Analyse des YouTube-Kanals EES TV soll diese These untermauern.
Der Hauptteil beginnt mit einer Nachvollziehung der Entwicklung von "Südwesterdeutsch" zu Namslang im postkolonialen Namibia. Dabei werden die historischen Hintergründe der deutschen Einwanderung und die Sprachkontaktsituation in Namibia beleuchtet. Anschließend wird der lexikalische Transfer in Namslang am Beispiel von EES TV analysiert, um die sprachlichen Besonderheiten dieser Umgangsvarietät zu beleuchten. Abschließend wird eine soziolinguistische Einordnung von Namslang vorgenommen, wobei die Frage untersucht wird, inwiefern Namslang Kriterien einer Jugendsprache erfüllt.
Schlüsselwörter
Namslang, YouTube-Kanal, EES TV, deutsch-namibische Identität, Sprachkontakt, Lexikalische Transferenzen, Jugendsprache, postkolonialer Kontext, Namibia, Südwesterdeutsch, Sprache, Kultur, Medien.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Die Jugendsprache Namslang als Spiegel eines Orientierungsprozesses zwischen lokaler und globaler Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430034