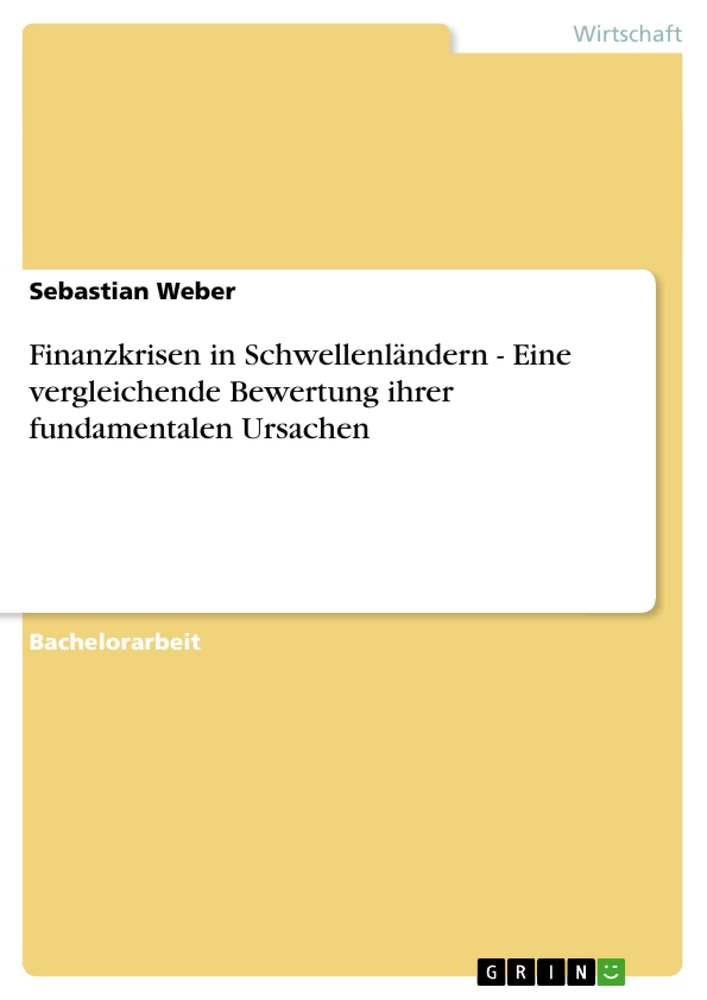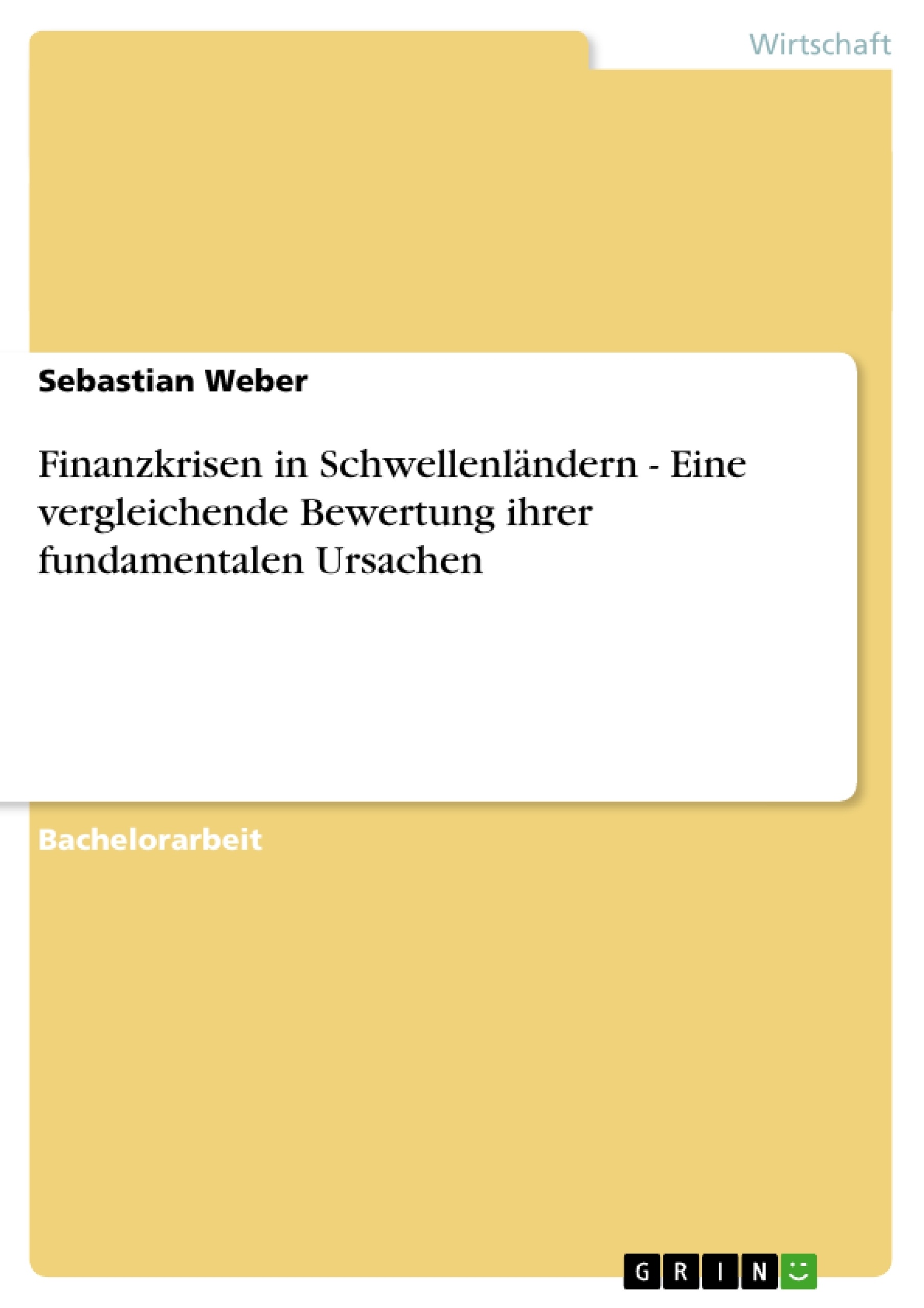Finanzkrisen haben in den 90er Jahren und den Anfängen des 21. Jahrhunderts in besonderem Maße sogenannte Schwellenländer heimgesucht und zu einer erneuten wissenschaftlichen Diskussion über ihre Ursachen geführt. Für das Ausbrechen der Krisen waren in der Regel hohe Kapitalabzüge ausländischer Investoren und Spekulanten, die eine fallende Währung erwarteten, verantwortlich. Durch das massenhafte Auftreten solcher Spekulanten kam es zu einer „self-fullfilling prophecy“ und die jeweiligen Währungen werteten stark ab mit den bekannten, häufig schwerwiegenden Folgen für das Bankensystem und die Volkswirtschaft. Die Frage die jedoch sowohl für zukünftige Präventionen als auch für die Politiksteuerung von Bedeutung ist, bleibt, ob nationale Politik und fundamentale realwirtschaftliche Entwicklungen für das Verhalten an den Devisenmärkten verantwortlich sind oder ob der Grund allein in dem Profit gesteuerten Verhalten des internationalen Kapitals zu suchen ist, wie von vielen Globalisierungskritikern und auch einigen Wissenschaftlern argumentiert wird (Vgl. BMF 2002, S.47).
Gibt es die Abkopplung des Kapitalmarktes von realwirtschaftlichen Fundamentaldaten oder ist das Verhalten der Investoren lediglich eine Reaktion auf makroökonomische Ungleichgewichte?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Wirkungszusammenhänge
- 2.1 Theorien der Finanzkrisen
- 2.1.1 First Generation Modell
- 2.1.2 Second Generation Modell
- 2.1.3 Alternative Theorien
- 2.2 Wechselkurssysteme
- 2.3 Makroökonomische Entwicklungen in einer offenen Volkswirtschaft
- 2.4 Mögliche Indikatoren der Krise
- 3. Die Länder vor der Krise
- 3.1 Argentinien
- 3.2 Russland
- 3.3 Thailand
- 3.4 Türkei
- 4. Ursachen der Krisen in den einzelnen Ländern
- 4.1 Argentinien
- 4.2 Russland
- 4.3 Thailand
- 4.4 Türkei
- 5. Vergleichende Betrachtung der Ursachen
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Ursachen von Finanzkrisen in Schwellenländern. Das Ziel ist es, die fundamentalen Ursachen dieser Krisen anhand von vier Fallbeispielen (Argentinien, Russland, Thailand und die Türkei) zu analysieren und zu vergleichen.
- Theorien der Finanzkrisen
- Wechselkurssysteme und ihre Bedeutung für wirtschaftliche Entwicklungen
- Makroökonomische Entwicklungen in offenen Volkswirtschaften
- Ursachenanalyse der Krisen in den einzelnen Ländern
- Vergleichende Betrachtung der Ursachen und die Rolle spekulativen Verhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt die wichtigsten Theorien zu Finanzkrisen vor, darunter das First Generation und das Second Generation Modell sowie alternative Ansätze. Außerdem wird die Rolle von Wechselkurssystemen und makroökonomischen Variablen in offenen Volkswirtschaften beleuchtet. Kapitel 3 betrachtet die Entwicklung von Indikatoren und fundamentalen Daten in den vier ausgewählten Ländern vor dem Ausbruch der jeweiligen Krisen. Kapitel 4 analysiert die Ursachen der Krisen in jedem der Länder und bietet eine detaillierte Diskussion der jeweiligen Faktoren.
Schlüsselwörter
Schwellenländer, Finanzkrisen, Theorien der Finanzkrisen, Wechselkurssysteme, Makroökonomische Entwicklungen, Indikatoren, Argentinien, Russland, Thailand, Türkei, Ursachenanalyse, Vergleichende Betrachtung, Spekulation, Internationale Kapitalbewegungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für Finanzkrisen in Schwellenländern?
Ursachen sind oft makroökonomische Ungleichgewichte, gekoppelt mit massiven Kapitalabzügen internationaler Investoren und spekulativen Angriffen auf Währungen.
Was unterscheidet das „First Generation Modell“ vom „Second Generation Modell“?
Das First Generation Modell fokussiert auf fundamentale Fehler (z. B. Defizite); das Second Generation Modell betont die Rolle von Erwartungen und „selbsterfüllenden Prophezeiungen“.
Welche Länder wurden in dieser Arbeit als Fallbeispiele analysiert?
Die Arbeit untersucht die Krisen in Argentinien, Russland, Thailand und der Türkei.
Spielt das Wechselkurssystem eine Rolle beim Ausbruch einer Krise?
Ja, starre Wechselkurssysteme können zu Überbewertungen führen, die Spekulanten anlocken und bei plötzlichen Abwertungen das Bankensystem kollabieren lassen.
Sind Investoren allein für die Krisen verantwortlich?
Die Arbeit diskutiert, ob das Verhalten der Investoren lediglich eine Reaktion auf reale wirtschaftliche Fehlentwicklungen (Fundamentaldaten) ist oder eine reine Profitgier darstellt.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Weber (Autor:in), 2004, Finanzkrisen in Schwellenländern - Eine vergleichende Bewertung ihrer fundamentalen Ursachen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43054