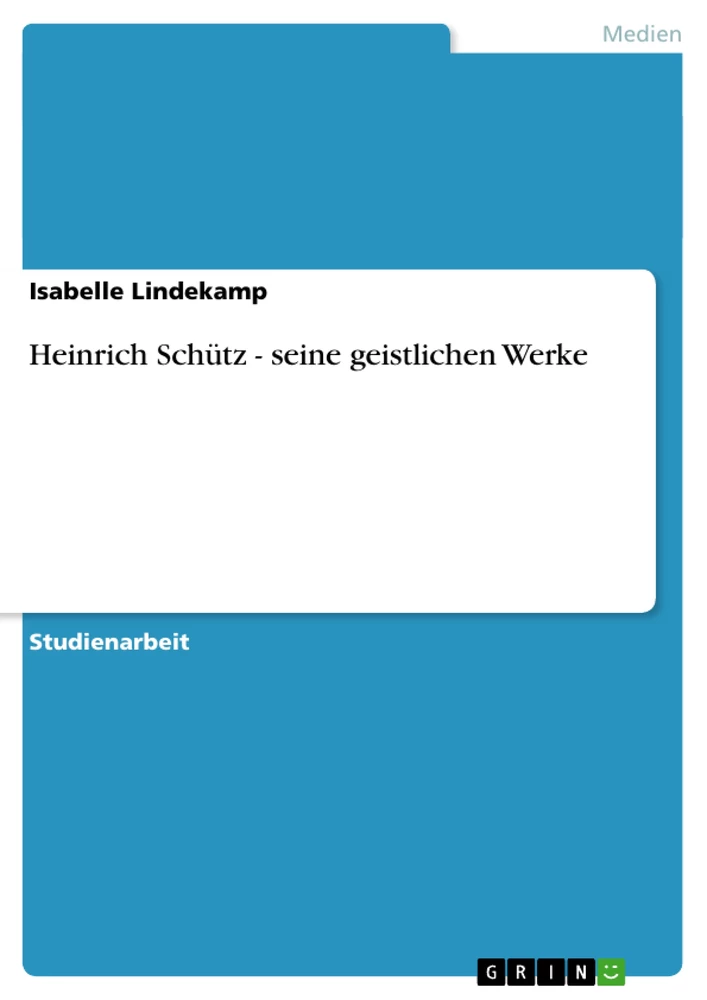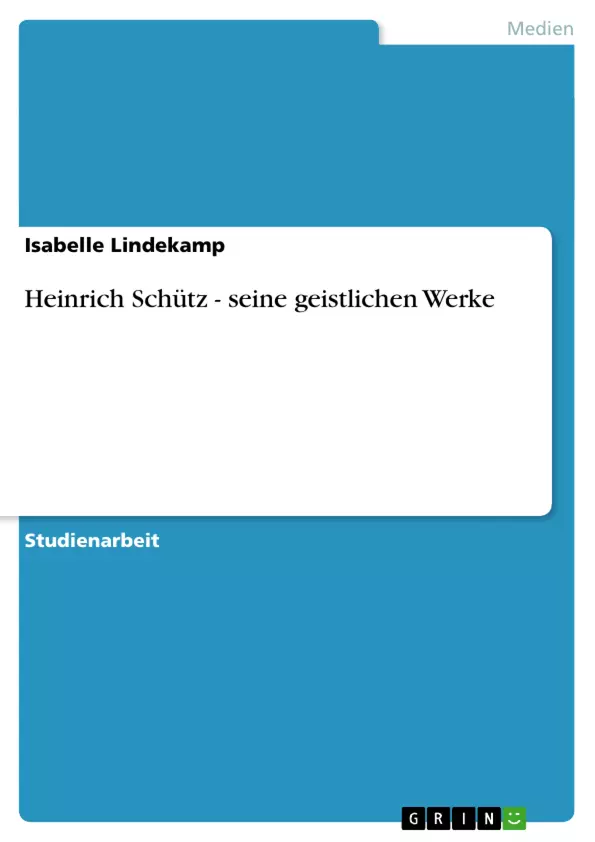In dieser Arbeit wird das geistliche Werk von Heinrich Schütz (1585-1672) thematisiert. Dazu werden zunächst wichtige biographische Aspekte in einem (musik-)geschichtlichen Kontext beschrieben.
Schütz hat verschiedene Werke komponiert, diese näher zu beschreiben ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Daher wird eine Gruppe, in der die schütz´sche Handschrift deutlich zu erkennen ist, exemplarisch näher beschrieben und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Heinrich Schütz - sein Leben
- Biographische Aspekte
- Studien in Italien
- Heinrich Schütz der Hofkapellmeister
- Musikgeschichtliche Einordnung
- Musiker im 17. Jahrhundert
- Musik im 17. Jahrhundert
- Heinrich Schütz der Komponist
- Die kleinen geistlichen Konzerte
- Figurenlehre
- Der „schütz´sche“ Stil
- Analyse „Eile mich Gott zu erretten“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem geistlichen Werk Heinrich Schütz' (1585-1672), indem sie wichtige biographische Aspekte im musikgeschichtlichen Kontext beschreibt und exemplarisch eine Gruppe seiner Werke analysiert, in denen seine Handschrift deutlich erkennbar ist. Der Fokus liegt auf der Darstellung seines Schaffens und dessen Einordnung in die Musik des 17. Jahrhunderts.
- Schütz' Leben und Wirken als Hofkapellmeister
- Die musikgeschichtliche Einordnung seines Werkes im 17. Jahrhundert
- Analyse des "schütz'schen" Stils
- Die Bedeutung der "kleinen geistlichen Konzerte"
- Der Einfluss des 30-jährigen Krieges auf Schütz' Leben und Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert kurz die Thematik der Arbeit: die Auseinandersetzung mit dem geistlichen Werk Heinrich Schütz'. Aufgrund der Vielzahl seiner Kompositionen konzentriert sich die Arbeit exemplarisch auf eine Gruppe von Werken, in denen Schütz' Stil besonders deutlich wird.
Heinrich Schütz - sein Leben: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Leben Heinrich Schütz', beginnend mit seiner Geburt in Köstritz und seiner frühen musikalischen Förderung durch seinen Onkel und den Weißenfelser Stadtkantor. Es beschreibt seine Ausbildung in Kassel, sein Jurastudium, seinen Studienaufenthalt in Italien bei Giovanni Gabrieli, der seine kompositorischen Fähigkeiten stark beeinflusste, und seine Ernennung zum kursächsischen Hofkapellmeister in Dresden. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, denen Schütz während des Dreißigjährigen Krieges begegnete, und die Auswirkungen dieser schwierigen Lebensumstände auf sein Schaffen. Es endet mit seinem Tod 1672 in Dresden.
Musikgeschichtliche Einordnung: Dieses Kapitel ordnet Schütz' Werk in den musikgeschichtlichen Kontext des 17. Jahrhunderts ein. Es beschreibt die Situation freischaffender Komponisten zu dieser Zeit und die Rolle von Kapellmeistern, Kantoren und Organisten. Es erläutert Schütz' gesellschaftliche Stellung und den Einfluss der ständischen Ordnung auf seine Karriere. Weiterhin wird der für den Barock typische Geschmack für konzertierende Musik, beeinflusst von Italien und Frankreich, behandelt, sowie die Entwicklung der Generalbassmonodie und des Concerto als epochal neue Elemente der Barockmusik.
Heinrich Schütz der Komponist: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse von Schütz' Kompositionen. Es betrachtet seine „kleinen geistlichen Konzerte“, seine Figurenlehre, und seinen unverwechselbaren Stil. Die Analyse von „Eile mich Gott zu erretten“ dient als Beispiel für die Anwendung seiner kompositorischen Prinzipien. Der Kapitel behandelt die Aspekte, die den individuellen Stil von Schütz ausmachen und diese in einen größeren musikalischen Kontext einordnen.
Schlüsselwörter
Heinrich Schütz, geistliche Musik, Barockmusik, Hofkapellmeister, Giovanni Gabrieli, Dreißigjähriger Krieg, „kleinen geistlichen Konzerte“, kontrapunktische Satztechnik, Generalbass, Figurenlehre, Musik des 17. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Heinrich Schütz - Sein Leben und Werk"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Leben und dem geistlichen Werk des Komponisten Heinrich Schütz (1585-1672). Sie analysiert seine wichtigsten Kompositionen im Kontext der Musik des 17. Jahrhunderts und beleuchtet seinen einzigartigen Stil. Der Fokus liegt auf den "kleinen geistlichen Konzerten" und der Einordnung seines Werkes in die musikgeschichtliche Entwicklung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Schütz' Biographie (Kindheit, Ausbildung, Italienreise, Wirken als Hofkapellmeister); die musikgeschichtliche Einordnung seines Werkes im 17. Jahrhundert; die Analyse seines Kompositionsstils, insbesondere der "kleinen geistlichen Konzerte"; der Einfluss des Dreißigjährigen Krieges; und eine detaillierte Analyse des Werkes "Eile mich Gott zu erretten".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Vorwort, Heinrich Schütz - sein Leben (Biographische Aspekte, Studien in Italien, Heinrich Schütz der Hofkapellmeister), Musikgeschichtliche Einordnung (Musiker im 17. Jahrhundert, Musik im 17. Jahrhundert), Heinrich Schütz der Komponist (Die kleinen geistlichen Konzerte, Figurenlehre, Der „schütz´sche“ Stil, Analyse „Eile mich Gott zu erretten“), und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Schütz' geistliches Werk zu beschreiben und zu analysieren, seine biographischen Aspekte im musikgeschichtlichen Kontext darzustellen und exemplarisch seine Kompositionen, insbesondere seinen unverwechselbaren Stil, zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Darstellung seines Schaffens und dessen Einordnung in die Musik des 17. Jahrhunderts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heinrich Schütz, geistliche Musik, Barockmusik, Hofkapellmeister, Giovanni Gabrieli, Dreißigjähriger Krieg, „kleine geistliche Konzerte“, kontrapunktische Satztechnik, Generalbass, Figurenlehre, Musik des 17. Jahrhunderts.
Wer war Heinrich Schütz?
Heinrich Schütz war ein bedeutender deutscher Komponist des Barock. Er wirkte als Hofkapellmeister in Dresden und war stark von seinem Lehrer Giovanni Gabrieli beeinflusst. Sein Werk umfasst sowohl geistliche als auch weltliche Musik und ist geprägt von einer meisterhaften kontrapunktischen Technik.
Welche Bedeutung haben die „kleinen geistlichen Konzerte“?
Die „kleinen geistlichen Konzerte“ bilden einen wichtigen Teil von Schütz' Werk und sind ein Beispiel für seinen einzigartigen Stil. Sie werden in der Arbeit detailliert analysiert, um seinen kompositorischen Ansatz zu verdeutlichen.
Wie wird der „schütz´sche“ Stil beschrieben?
Der „schütz´sche“ Stil wird in der Arbeit durch Analyse seiner Kompositionen, insbesondere der „kleinen geistlichen Konzerte“, und im Vergleich zu anderen Komponisten des 17. Jahrhunderts beschrieben. Es werden Merkmale wie die kontrapunktische Satztechnik und der Gebrauch des Generalbasses hervorgehoben.
Welchen Einfluss hatte der Dreißigjährige Krieg auf Schütz?
Der Dreißigjährige Krieg hatte einen erheblichen Einfluss auf Schütz' Leben und Werk. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, denen er begegnete, und die Auswirkungen dieser schwierigen Lebensumstände auf sein Schaffen.
- Quote paper
- Isabelle Lindekamp (Author), 2004, Heinrich Schütz - seine geistlichen Werke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43059