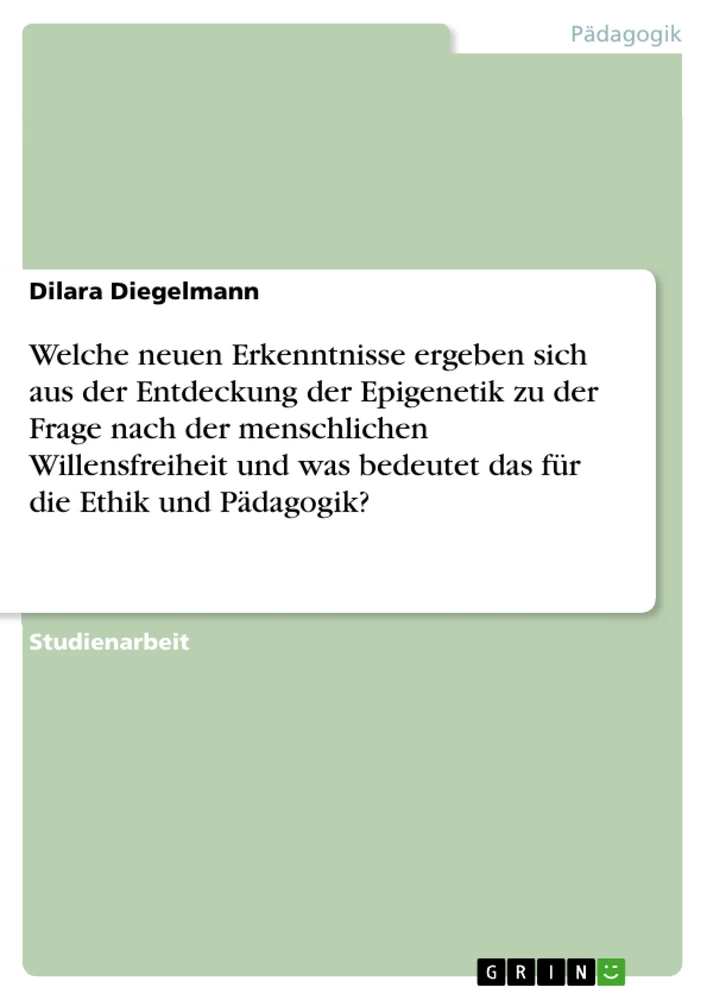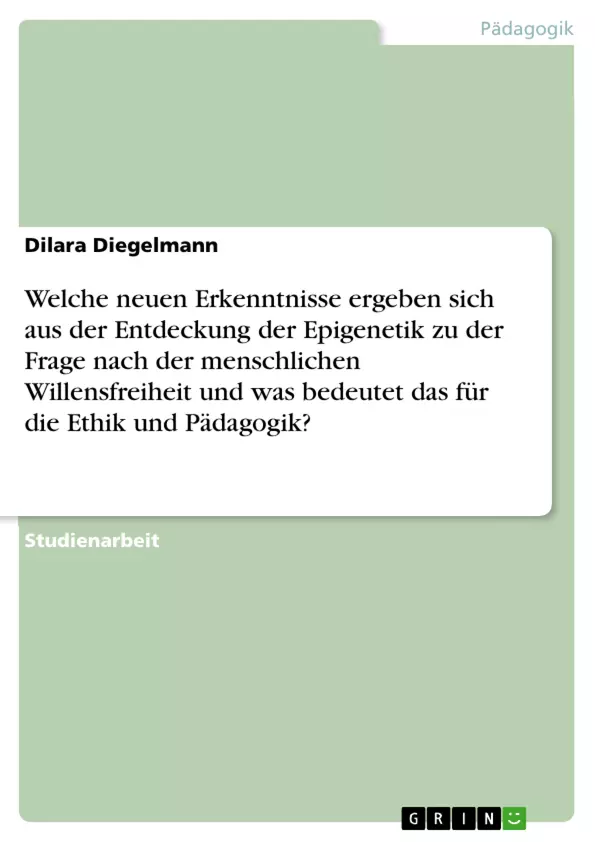In dieser Hausarbeit soll ein Überblick darüber geschaffen werden, wie die Epigenetik auf moderne naturwissenschaftliche Weise zeigt, dass der Mensch mehr ist als eine biologische Maschine und welche Folgen das für die Ethik, Anthropologie und Pädagogik hat. Wissen aus der Philosophie, Biologie und Pädagogik wird zusammengestellt und aufeinander bezogen.
Zunächst sollen einige zentrale Begriffe definiert und Antwortmöglichkeiten auf die Frage nach der Willensfreiheit analysiert werden. Daraufhin werden grob der Aufbau der DNA, die Genexpression sowie die Vererbung der im Erbgut enthaltenen Informationen erörtert. Der biologische Teil ist auf die Kernaussagen reduziert, sodass er auch für Nicht-Biologen verständlich bleibt. Schließlich widmet sich die Arbeit der Epigenetik und der Bedeutung ihrer Erkenntnisse für die Ethik, Anthropologie und Pädagogik.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Was ist Willensfreiheit?
- 2.1.1 Ist Willensfreiheit mit Zufall vereinbar?
- 2.1.2 Ist Willensfreiheit mit Determinismus vereinbar?
- 2.2 Wie die DNA unsere Fähigkeiten und unser Handeln beeinflusst.
- 2.2.1 Proteinbiosynthese
- 2.2.2 Modifikation
- 2.2.3 Nervensystem
- 2.3 Was ist Epigenetik?
- 2.3.1 Arten der Genregulation
- 2.3.2 Spleißen
- 2.3.3 Gezielte Beeinflussungen der Epigenetik
- 2.3.4 Bedeutung für die Evolutionstheorie – von Lamarck über Darwin zurück zu Lamarck
- 2.3.5 Zwischenfazit
- 2.1 Was ist Willensfreiheit?
- 3 Fazit
- 3.1 Bedeutung für die Pädagogik
- 3.2 Zur Notwendigkeit des freien Willens
- 4 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss epigenetischer Erkenntnisse auf das Verständnis von Willensfreiheit und deren Bedeutung für Ethik und Pädagogik. Sie beleuchtet den aktuellen naturwissenschaftlichen Standpunkt, verbindet diesen mit philosophischen Überlegungen und diskutiert die Implikationen für das pädagogische Handeln.
- Definition und Analyse verschiedener Konzepte von Willensfreiheit
- Einfluss der DNA und der Genexpression auf menschliches Handeln
- Einführung in die Epigenetik und deren Mechanismen
- Die Bedeutung epigenetischer Erkenntnisse für die Evolutionstheorie
- Implikationen der Epigenetik für Ethik, Anthropologie und Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Problematik der Willensfreiheit ein, die als Aporie zwischen intuitiver Erfahrung und naturwissenschaftlichen Determinismusmodellen beschrieben wird. Sie skizziert den historischen Kontext der Diskussion, beginnend mit der Darwinschen Evolutionstheorie und der Entschlüsselung des menschlichen Genoms, und führt zur Bedeutung der Epigenetik als neues Forschungsfeld, welches neue Perspektiven auf die Frage der Willensfreiheit bietet. Die Arbeit formuliert ihre Zielsetzung: einen Überblick über den Einfluss epigenetischer Erkenntnisse auf das Verständnis des Menschen und deren Konsequenzen für Ethik, Anthropologie und Pädagogik zu schaffen.
2 Hauptteil: Dieser Abschnitt beginnt mit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff der Willensfreiheit, differenziert zwischen relativer und absoluter Freiheit nach Kant und analysiert die verschiedenen Facetten dieses Begriffs. Anschließend werden die grundlegenden Mechanismen der Proteinbiosynthese und der Genexpression erläutert, um den Einfluss der DNA auf Fähigkeiten und Handeln zu beleuchten. Im Kern des Hauptteils wird die Epigenetik als Forschungsgebiet vorgestellt, welches die Modifikation der Genexpression und deren Bedeutung für die Evolution und die Frage nach der Willensfreiheit behandelt. Die gezielte Beeinflussbarkeit der epigenetischen Prozesse wird dabei hervorgehoben. Zusammenfassend wird das Verständnis der Epigenetik und ihrer weitreichenden Implikationen dargestellt.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Epigenetik, Genexpression, Determinismus, DNA, Genregulation, Ethik, Pädagogik, Anthropologie, Evolutionstheorie, Autonomie, Heteronomie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Epigenetik und Willensfreiheit
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss epigenetischer Erkenntnisse auf das Verständnis von Willensfreiheit und deren Bedeutung für Ethik und Pädagogik. Sie verbindet naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit philosophischen Überlegungen und diskutiert die Implikationen für das pädagogische Handeln.
Welche Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil beginnt mit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff der Willensfreiheit, differenziert zwischen verschiedenen Freiheitskonzepten und analysiert deren Facetten. Anschließend werden die Mechanismen der Proteinbiosynthese und Genexpression erläutert, um den Einfluss der DNA auf unser Handeln zu beleuchten. Der Kern des Hauptteils behandelt die Epigenetik, ihre Mechanismen, die Modifikation der Genexpression, ihre Bedeutung für die Evolution und die Frage nach der Willensfreiheit. Die gezielte Beeinflussbarkeit epigenetischer Prozesse wird hervorgehoben.
Welche konkreten Aspekte der Epigenetik werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt Arten der Genregulation, Spleißen und die gezielte Beeinflussung der Epigenetik. Besonders wird die Bedeutung epigenetischer Erkenntnisse für die Evolutionstheorie – von Lamarck über Darwin zurück zu Lamarck – diskutiert.
Wie wird die Willensfreiheit in der Arbeit definiert und analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Konzepte von Willensfreiheit, indem sie zwischen relativer und absoluter Freiheit differenziert und die verschiedenen Facetten dieses Begriffs beleuchtet. Sie untersucht die Vereinbarkeit von Willensfreiheit mit Zufall und Determinismus.
Welche Bedeutung hat die Epigenetik für die Evolutionstheorie?
Die Hausarbeit diskutiert die Bedeutung epigenetischer Erkenntnisse für die Evolutionstheorie, indem sie den historischen Kontext von Lamarck und Darwin beleuchtet und neue Perspektiven auf die Evolution im Lichte epigenetischer Prozesse darstellt.
Welche Schlussfolgerungen werden in Bezug auf Ethik, Anthropologie und Pädagogik gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen für Ethik, Anthropologie und Pädagogik, indem sie die Implikationen der epigenetischen Erkenntnisse für diese Bereiche diskutiert. Die Bedeutung für die Pädagogik und die Notwendigkeit des freien Willens werden im Fazit besonders hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Willensfreiheit, Epigenetik, Genexpression, Determinismus, DNA, Genregulation, Ethik, Pädagogik, Anthropologie, Evolutionstheorie, Autonomie und Heteronomie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Unterkapiteln zu Willensfreiheit, DNA-Einfluss, Epigenetik und deren Bedeutung für die Evolutionstheorie, ein Fazit mit Bezug auf Pädagogik und die Notwendigkeit des freien Willens sowie ein Quellenverzeichnis.
- Quote paper
- Dilara Diegelmann (Author), 2017, Welche neuen Erkenntnisse ergeben sich aus der Entdeckung der Epigenetik zu der Frage nach der menschlichen Willensfreiheit und was bedeutet das für die Ethik und Pädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430764