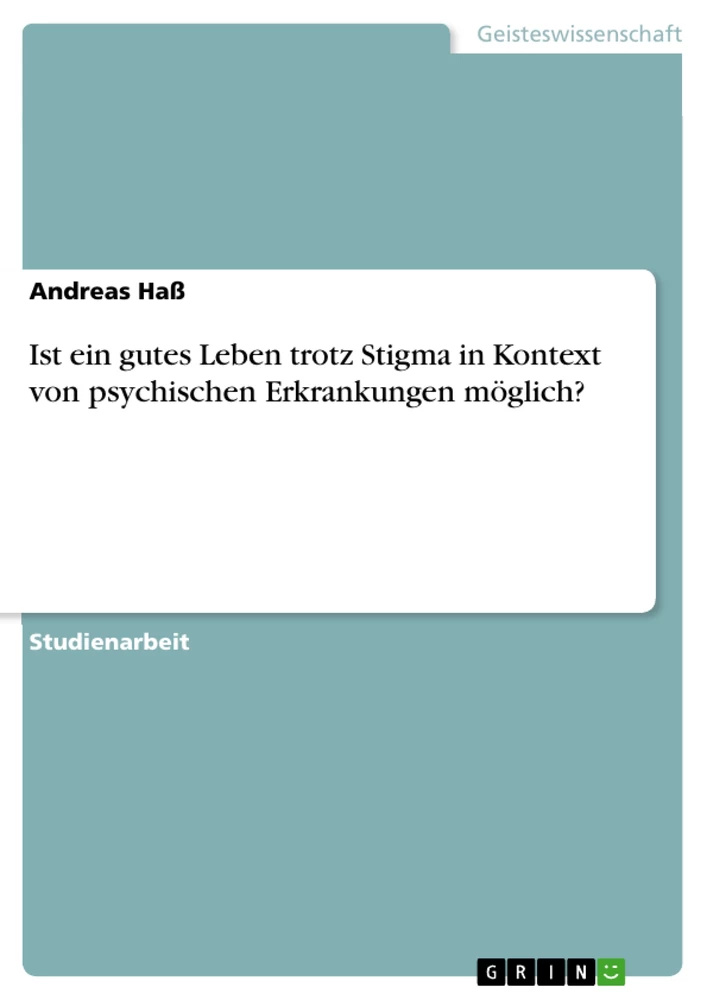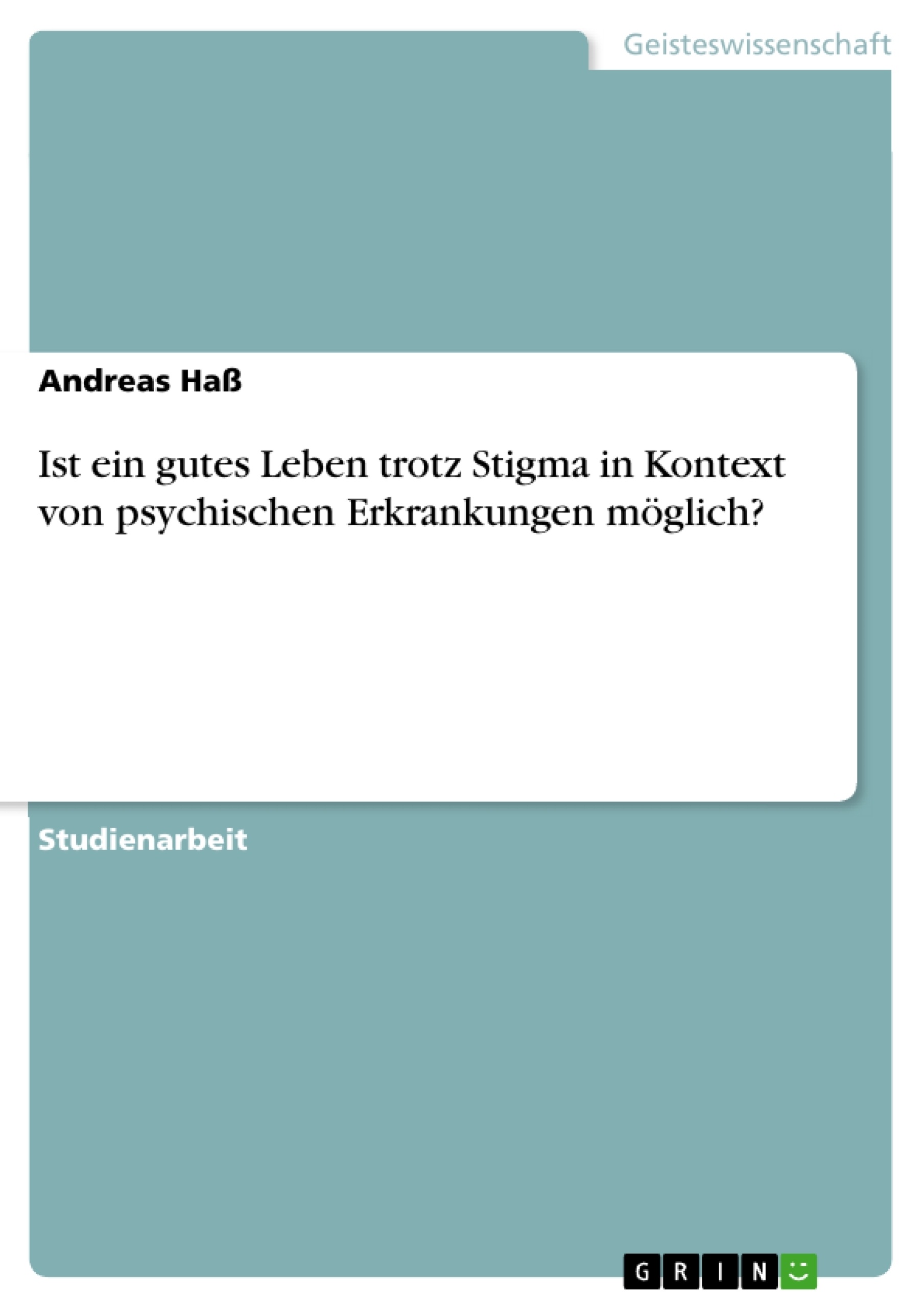Ein gutes Leben zu führen - dies ist zu allen Zeiten Wunsch und Ziel des Menschen gewesen. Schon die Formulierung „führen“ gibt allerdings einen Hinweis darauf, dass sich ein gutes Leben nicht einfach, also sozusagen von selbst, als solches einstellt. Es bedarf offenbar einer Art steuerndem Einwirken.
Was ist ein gutes Leben? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein gutes Leben führen zu können, was oder wen brauche ich dafür? Wie soll ich mich, wie sollen wir uns verhalten, um ein gutes Leben zu leben?
Ebenso deutlich zeigt ein Blick auf die menschliche Entwicklung, dass zu allen Zeiten und in allen Kulturkreisen unserer Welt sehr unterschiedliche Vorstellungen von einem guten Leben existier(t)en. Und auch darüber, wer einen Anspruch auf ein gutes Leben für sich geltend machen konnte bzw. kann.
Nicht jedem Menschen innerhalb unserer Gesellschaft – so scheint es – ist ein Zugang hierzu in gleichem Maße möglich. Unterschiede begründen sich z.B. durch Religionszugehörigkeit, Geschlechtszugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, körperliche oder geistige Behinderungen, persönliche Ansichten oder auch der Zugehörigkeit zu einer Gruppe (wie z.B. Sinti und Roma).
In der folgenden Ausarbeitung soll die Frage aufgeworfen und wenn möglich beantwortet werden, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um ein gutes Leben zu führen und ob bzw. inwieweit ein solches Leben im Kontext von psychischen Erkrankungen – und hier konkret am Beispiel der Schizophrenie – möglich ist.
Dafür ist es zunächst erforderlich, die Begriffe und deren Bedeutung, mit der in der weiteren Ausarbeitung gearbeitet wird, zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsannäherung
- Begriffsannäherung „gutes Leben“
- Begriffsannäherung „Stigma“
- Begriffsannäherung „Schizophrenie/ schizophrene Psychose“
- Fallbeispiel
- Anamnese Herr A.
- Die Stigmatisierung am Fallbeispiel
- Umgang mit der Erkrankung und dem Stigma am Fallbeispiel
- Ist ein gutes Leben trotz Stigma im Kontext von psychischen Erkrankungen möglich?
- Gesellschaftliche Dimension / Konsequenzen
- Resümee/Fazit
- Ergebnisse zusammenstellen
- Schlussfolgerung ziehen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob ein gutes Leben trotz Stigma im Kontext von psychischen Erkrankungen, insbesondere Schizophrenie, möglich ist. Sie analysiert den Begriff „gutes Leben“ und „Stigma“ und untersucht am Fallbeispiel eines Schizophrenie-Patienten die Auswirkungen der Stigmatisierung auf das Leben des Betroffenen. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftlichen Dimensionen und Konsequenzen der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen.
- Definition und Analyse des Begriffs „gutes Leben“
- Die Auswirkungen von Stigmatisierung auf Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Die Rolle der Gesellschaft im Umgang mit psychischen Erkrankungen und Stigma
- Möglichkeiten, ein gutes Leben trotz Stigma zu ermöglichen
- Die Bedeutung von Inklusion und Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und beleuchtet den Wunsch des Menschen nach einem guten Leben. Sie verdeutlicht die Komplexität des Begriffs „gutes Leben“ und die Herausforderungen, die Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bezug auf ein gutes Leben erleben.
- Begriffsannäherung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, „gutes Leben“, „Stigma“ und „Schizophrenie“. Es analysiert die Konzepte und diskutiert die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext der Fragestellung.
- Fallbeispiel: Dieses Kapitel stellt den Fall eines Mannes mit Schizophrenie vor und analysiert die Stigmatisierung, die er erlebt. Es beschreibt den Umgang des Betroffenen mit seiner Erkrankung und dem Stigma.
- Ist ein gutes Leben trotz Stigma im Kontext von psychischen Erkrankungen möglich?: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Fragestellung der Arbeit und diskutiert die Möglichkeiten und Herausforderungen, die Menschen mit psychischen Erkrankungen im Hinblick auf ein gutes Leben erleben.
- Gesellschaftliche Dimension / Konsequenzen: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftlichen Dimensionen und Konsequenzen der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Es diskutiert die Auswirkungen auf das Leben von Menschen mit psychischen Erkrankungen und die Rolle der Gesellschaft im Umgang mit Stigma.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen „gutes Leben“, „Stigma“, „psychische Erkrankungen“, „Schizophrenie“, „Inklusion“, „gesellschaftliche Dimensionen“ und „Unterstützung“. Sie untersucht die Auswirkungen von Stigmatisierung auf das Leben von Menschen mit psychischen Erkrankungen und diskutiert Möglichkeiten, ein gutes Leben trotz Stigma zu ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem "guten Leben"?
Ein gutes Leben ist ein subjektives Ziel, das steuerndes Einwirken erfordert. Die Vorstellungen davon variieren stark nach Kultur, Religion und persönlichen Lebensumständen.
Wie wirkt sich ein Stigma auf psychisch Kranke aus?
Stigmatisierung führt oft zu sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und einem erschwerten Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, was ein "gutes Leben" massiv behindern kann.
Ist ein gutes Leben trotz Schizophrenie möglich?
Die Arbeit untersucht diese Frage und kommt zu dem Schluss, dass es unter bestimmten Voraussetzungen (Inklusion, Unterstützung, Akzeptanz) möglich ist, ein erfülltes Leben zu führen.
Welche Rolle spielt die Gesellschaft beim Thema Stigmatisierung?
Die Gesellschaft definiert oft, wer "normal" ist. Vorurteile gegenüber Krankheiten wie Schizophrenie sind tief verwurzelt und müssen durch Aufklärung abgebaut werden.
Was zeigt das Fallbeispiel von Herrn A.?
Das Fallbeispiel verdeutlicht die konkrete Anamnese, die erlebte Stigmatisierung im Alltag und die Strategien des Betroffenen, mit der Erkrankung umzugehen.
Was sind die Voraussetzungen für Inklusion?
Voraussetzungen sind der Abbau von Barrieren (baulich und mental), soziale Unterstützungssysteme und eine wertfreie Haltung der Mitmenschen.
- Quote paper
- Andreas Haß (Author), 2017, Ist ein gutes Leben trotz Stigma in Kontext von psychischen Erkrankungen möglich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430812