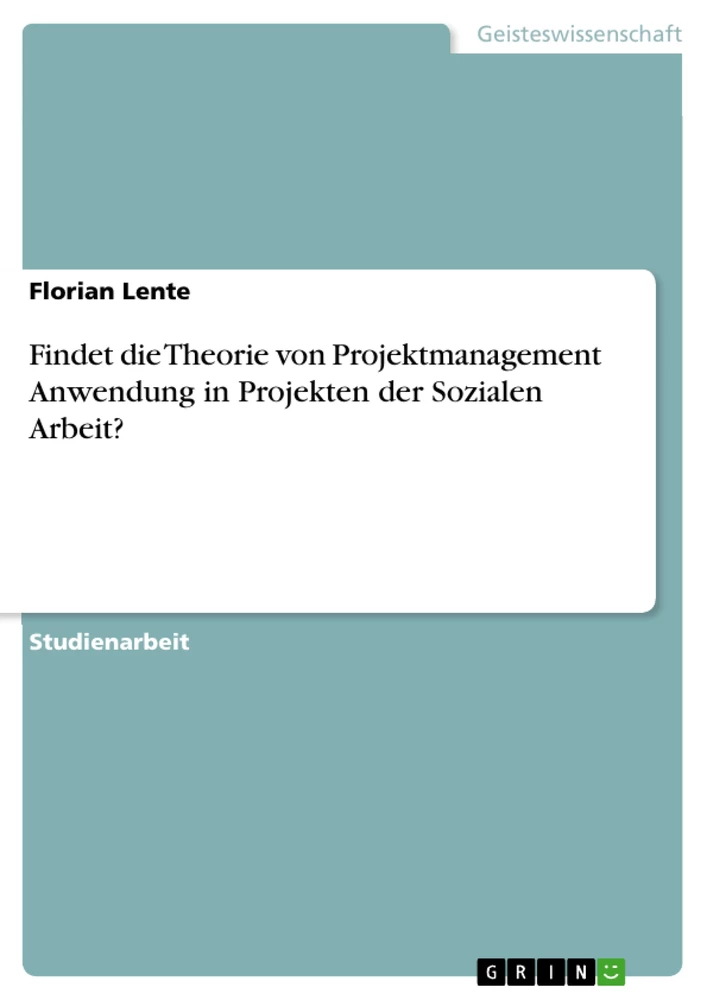Projektmanagement und Organisationsmanagement sind Begriffe, die in der Sozialen Arbeit vor allem die den letzten zwanzig Jahren an Gewichtung zugenommen haben. Durch den wachsenden Konkurrenzdruck zwischen Sozialen Dienstleistern und gewandelte Interessen und Ansprüche von Kunden Bedarf es spätestens seit dem Einzug des New Public Management in die Soziale Arbeit einer raschen und vor allem effizienten Arbeit. Um Arbeitsprozesse zu optimieren wurden folglich auch Modelle, welche vorab primär in der Wirtschaft um Einsatz kamen, in der Sozialen Arbeit angewandt. Projektmanagement gewinnt also an Bedeutung.
In dieser Hausarbeit wird nach dem Aufarbeiten der theoretischen Fundierung von Projektmanagements ein aktuelles Projekt der Sozialen Arbeit vorgestellt und anschließend auf die Schnittmenge mit der theoretischen Fundierung von Projektmanagement abgeglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlage: Begriffsdefinitionen
- Organisationsmanagement
- Projektmanagement
- Akteure des Projektmanagements
- Theoretische Fundierung des Projektmanagements
- Linienorganisation
- Stablinien-Organisation
- Matrixorganisation
- Autonome Projektorganisation
- Projektauswertung
- Beispielprojekt aus der Sozialen Arbeit - Alkoholprävention Komma klar!
- Grundidee
- Konzeption
- Schnittmenge Theorie und Praxis des Projektmanagements in der Sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht, inwiefern die Theorie des Projektmanagements in Projekten der Sozialen Arbeit Anwendung findet. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des Projektmanagements und stellt ein aktuelles Projekt der Alkoholprävention vor, um anschließend die Schnittmenge zwischen Theorie und Praxis zu untersuchen.
- Definition und theoretische Fundierung des Projektmanagements
- Verschiedene Formen der Projektorganisation
- Anwendungsbeispiel aus der Sozialen Arbeit: Alkoholpräventionsprojekt
- Schnittstellen zwischen Theorie und Praxis des Projektmanagements in der Sozialen Arbeit
- Relevanz und Bedeutung des Projektmanagements in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Projektmanagements in der Sozialen Arbeit ein und skizziert die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund des New Public Management. Sie stellt die Zielsetzung der Hausarbeit und die zu behandelnden Themenbereiche vor.
- Grundlage: Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Organisationsmanagement und Projektmanagement und stellt die verschiedenen Akteure im Projektmanagement vor.
- Theoretische Fundierung des Projektmanagements: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen der Projektorganisation, wie Linienorganisation, Stablinien-Organisation, Matrixorganisation und Autonome Projektorganisation, sowie die Bedeutung der Projektauswertung.
- Beispielprojekt aus der Sozialen Arbeit - Alkoholprävention Komma klar!: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Projekt der Sozialen Arbeit, die Alkoholpräventionskampagne "Komma klar!", und erläutert die Grundidee und Konzeption des Projekts.
- Schnittmenge Theorie und Praxis des Projektmanagements in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel analysiert die Schnittmenge zwischen den theoretischen Grundlagen des Projektmanagements und der Praxis des "Komma klar!"-Projekts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Projektmanagement, Organisationsmanagement, Soziale Arbeit, New Public Management, Projektorganisation, Alkoholprävention, Projektmanagementmethoden und der Anwendung theoretischer Konzepte in der Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Projektmanagement in der Sozialen Arbeit immer wichtiger?
Durch wachsenden Konkurrenzdruck zwischen Dienstleistern und den Einzug des New Public Management müssen Arbeitsprozesse in der Sozialen Arbeit effizienter und rascher gestaltet werden.
Welche Formen der Projektorganisation gibt es?
Die Arbeit untersucht die Linienorganisation, Stablinien-Organisation, Matrixorganisation und die autonome Projektorganisation in Bezug auf ihre Anwendbarkeit in sozialen Projekten.
Was ist das Projekt "Komma klar!"?
Es handelt sich um ein Praxisbeispiel zur Alkoholprävention, an dem untersucht wird, wie theoretische Projektmanagement-Methoden in der sozialen Praxis umgesetzt werden.
Was ist der Unterschied zwischen Organisations- und Projektmanagement?
Organisationsmanagement bezieht sich auf die dauerhaften Strukturen, während Projektmanagement zeitlich begrenzte, komplexe Vorhaben mit spezifischen Zielen steuert.
Hilft Projektmanagement bei der Effizienzsteigerung in sozialen Berufen?
Ja, die Anwendung wirtschaftlicher Modelle hilft dabei, knappe Ressourcen gezielter einzusetzen und die Ergebnisse sozialer Interventionen durch Evaluation (Projektauswertung) zu verbessern.
- Quote paper
- Florian Lente (Author), 2018, Findet die Theorie von Projektmanagement Anwendung in Projekten der Sozialen Arbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431390