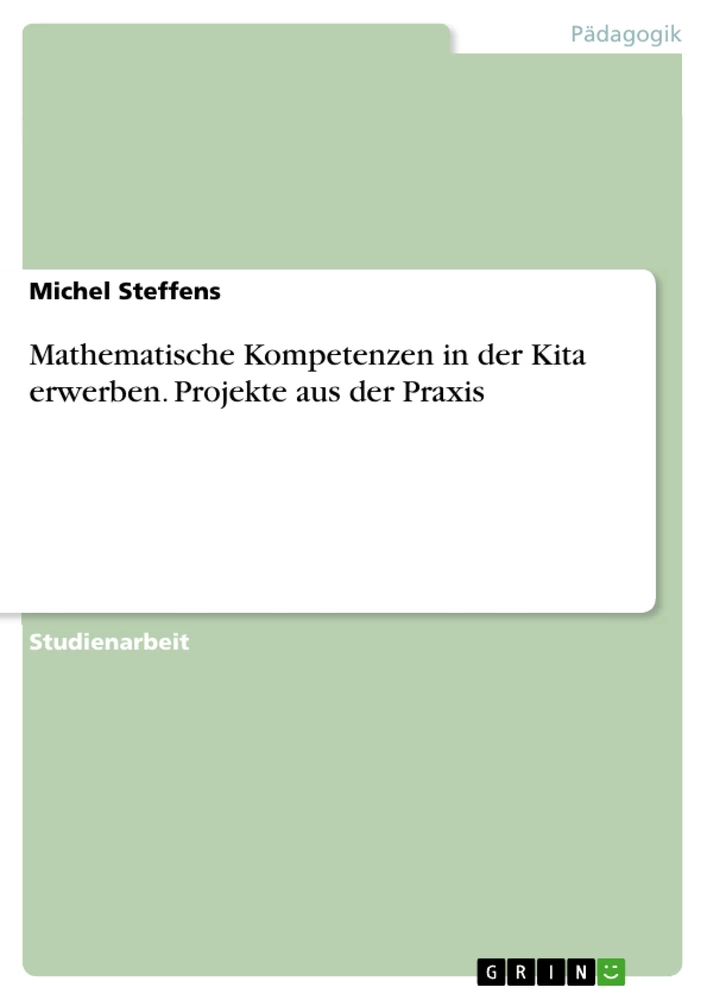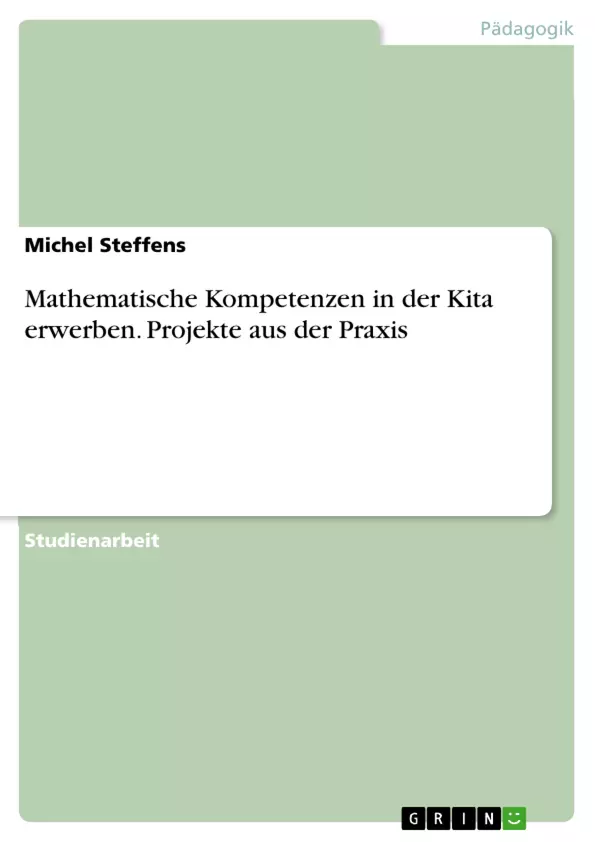Jedes dritte Kind hat Angst vor Mathematik und vor Zahlen. Diese Angst wirkt sich auf die Rechenleistung aus. Wie kann bereits im Elementarbereich dieser Angst gegenüber den Zahlen und der Mathematik im Ganzen entgegengewirkt werden – und den Kindern der Umgang mit Formen, Mustern und Zahlen als spaßige Lernmethode vermittelt werden?
Wie ist die Welt aufgebaut? Wie erkenne ich Zusammenhänge? Wie kann ich sie sinnvoll anwenden? Bereits im Vorschulalter stellen Kinder solche oder ähnliche Fragen und möchten die Welt mit all ihren Phänomenen verstehen. Nicht immer ist jedoch die korrekte Antwort wirklich von Nutzen, sondern vielmehr der Weg zur Beantwortung ist von Bedeutung. Lösungswege vorzugeben oder Fragen einfach zu beantworten scheint eine logische Möglichkeit zu sein, ist in vielerlei Hinsicht aber nicht schlau.
Gerade im Bereich der Mathematik werden während der Schullaufbahn viele Lösungen vorgegeben und der Weg dahin ist gefragt. Aber gerade dieser Weg ist für viele Kinder, die bis dato nicht ausreichend gelernt haben, Lösungswege zu finden, eine große Hürde. Dem kann mit frühkindlicher Förderung mathematischer Fähigkeiten entgegengewirkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Friedrich Fröbel
- 2.1 Spielgaben und Beschäftigungsmittel
- 2.2 Mathematischer Bezug
- 3 Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalen
- 4 Mathematische Lernkultur im Elementarbereich
- 4.1 Frühkindliche Bildung
- 4.2 Mathematische Inhaltsbereiche
- 4.2.1 Raum und Form
- 4.2.2 Zahlen
- 4.2.3 Größen und Messen
- 4.3 Sprachlicher Ausdruck
- 5 Rolle des Pädagogen
- 6 Projekte aus der Praxis
- 6.1 Planung und Durchführung
- 6.2 Anwendungsbeispiele
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie bereits im Elementarbereich die Angst vor Mathematik entgegengewirkt und der Umgang mit Formen, Mustern und Zahlen spielerisch vermittelt werden kann. Sie beleuchtet die Wurzeln der spielenden Mathematik bei Friedrich Fröbel, die Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalens und die mathematische Lernkultur im Elementarbereich.
- Die Bedeutung des Spiels in der frühkindlichen mathematischen Bildung
- Fröbels Spielgaben und deren mathematischer Bezug
- Mathematische Inhaltsbereiche im Elementarbereich (Raum und Form, Zahlen, Größen und Messen)
- Die Rolle des Pädagogen in der Förderung mathematischer Kompetenzen
- Praktische Projekte und Methoden zur Vermittlung mathematischer Inhalte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Möglichkeiten zur frühzeitigen und spielerischen Vermittlung mathematischer Konzepte im Elementarbereich. Sie verweist auf die Angst vieler Kinder vor Mathematik und deren Auswirkungen auf die Lernleistung, und kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich mit den Wurzeln der spielenden Mathematik bei Fröbel, den Bildungsgrundsätzen Nordrhein-Westfalens und der praktischen Umsetzung im Kita-Alltag auseinandersetzt.
2 Friedrich Fröbel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Leben und Werk von Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens. Es beschreibt Fröbels pädagogisches Konzept, das den spielerischen Ansatz in der Kindererziehung betont, und seinen Glauben an die Bedeutung des Spiels für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes. Fröbels Überzeugung, dass das Spiel die höchste Stufe der Kindesentwicklung darstellt und für die Entfaltung der göttlichen Anlagen im Menschen essentiell ist, wird ausführlich dargestellt. Die Arbeit erläutert, wie Fröbels Spielgaben und Beschäftigungsmittel im Kontext der mathematischen Bildung gesehen werden können, und hebt deren Bedeutung für die sinnliche Erfahrung und das Verständnis von Formen und Raum hervor.
3 Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalen: Dieses Kapitel analysiert die Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalens im Hinblick auf die mathematische Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Es beschreibt die Ziele und Vorgaben des Landes für die frühkindliche Bildung und untersucht, wie diese Ziele in der Praxis umgesetzt werden können, insbesondere im Kontext der mathematischen Förderung. Die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für die spätere Entwicklung mathematischer Kompetenzen wird hervorgehoben.
4 Mathematische Lernkultur im Elementarbereich: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die mathematische Lernkultur im Elementarbereich. Es beginnt mit einer Diskussion der allgemeinen frühkindlichen Bildung und beleuchtet dann detailliert die mathematischen Inhaltsbereiche, einschließlich Raum und Form, Zahlen und Größen und Messen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks für das mathematische Verständnis. Die Kapitel unterstreicht die Interdependenz zwischen den verschiedenen mathematischen Inhaltsbereichen und wie sie aufeinander aufbauen.
5 Rolle des Pädagogen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der pädagogischen Fachkräfte bei der Förderung mathematischer Kompetenzen im Elementarbereich. Es beschreibt die Bedeutung von Unterstützung und Begleitung der Kinder durch die Erzieher*innen und gibt konkrete Anhaltspunkte für eine optimale Förderung. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines positiven Lernumfelds, welches die Kinder ermutigt, aktiv und selbstständig mathematische Konzepte zu erforschen.
Schlüsselwörter
Mathematische Bildung, Elementarbereich, Frühkindliche Bildung, Friedrich Fröbel, Spielgaben, Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalen, Raum und Form, Zahlen, Größen und Messen, Sprachlicher Ausdruck, Rolle des Pädagogen, Projekte, Lernkultur, Angst vor Mathematik.
Häufig gestellte Fragen zu: Mathematische Bildung im Elementarbereich
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie man im Elementarbereich der Angst vor Mathematik entgegenwirken und den Umgang mit Formen, Mustern und Zahlen spielerisch vermitteln kann. Sie beleuchtet dabei die Wurzeln der spielenden Mathematik bei Friedrich Fröbel, die Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalens und die mathematische Lernkultur im Elementarbereich.
Welche Aspekte der mathematischen Bildung im Elementarbereich werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte, darunter die Bedeutung des Spiels in der frühkindlichen mathematischen Bildung, Fröbels Spielgaben und deren mathematischer Bezug, mathematische Inhaltsbereiche (Raum und Form, Zahlen, Größen und Messen), die Rolle des Pädagogen, und praktische Projekte zur Vermittlung mathematischer Inhalte.
Welche Rolle spielt Friedrich Fröbel in dieser Arbeit?
Friedrich Fröbel, der Begründer des Kindergartens, und seine pädagogischen Konzepte, insbesondere seine Spielgaben und Beschäftigungsmittel, werden als wichtige Grundlage für eine spielerische Vermittlung mathematischer Konzepte im Elementarbereich betrachtet. Seine Überzeugung von der Bedeutung des Spiels für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes wird ausführlich dargestellt.
Wie werden die Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalens berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalens im Hinblick auf die mathematische Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Sie untersucht, wie die Ziele und Vorgaben des Landes in der Praxis umgesetzt werden können, insbesondere im Kontext der mathematischen Förderung.
Welche mathematischen Inhaltsbereiche werden im Detail untersucht?
Die Arbeit beleuchtet detailliert die mathematischen Inhaltsbereiche Raum und Form, Zahlen und Größen und Messen im Elementarbereich. Dabei wird die Interdependenz zwischen diesen Bereichen und die Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks für das mathematische Verständnis hervorgehoben.
Welche Rolle spielt der Pädagoge in der Förderung mathematischer Kompetenzen?
Die Arbeit betont die wichtige Rolle der pädagogischen Fachkräfte bei der Förderung mathematischer Kompetenzen. Sie beschreibt die Bedeutung von Unterstützung und Begleitung der Kinder und gibt konkrete Anhaltspunkte für eine optimale Förderung und die Schaffung eines positiven Lernumfelds.
Gibt es praktische Beispiele oder Projekte in der Arbeit?
Ja, die Arbeit enthält praktische Projekte aus der Praxis, die die Planung und Durchführung sowie Anwendungsbeispiele zur Vermittlung mathematischer Inhalte im Elementarbereich zeigen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Mathematische Bildung, Elementarbereich, Frühkindliche Bildung, Friedrich Fröbel, Spielgaben, Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalen, Raum und Form, Zahlen, Größen und Messen, Sprachlicher Ausdruck, Rolle des Pädagogen, Projekte, Lernkultur, Angst vor Mathematik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in Einleitung, Kapitel zu Friedrich Fröbel, den Bildungsgrundsätzen Nordrhein-Westfalens, der mathematischen Lernkultur im Elementarbereich, der Rolle des Pädagogen, praktischen Projekten und einem Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen.
- Citar trabajo
- Michel Steffens (Autor), 2018, Mathematische Kompetenzen in der Kita erwerben. Projekte aus der Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431648