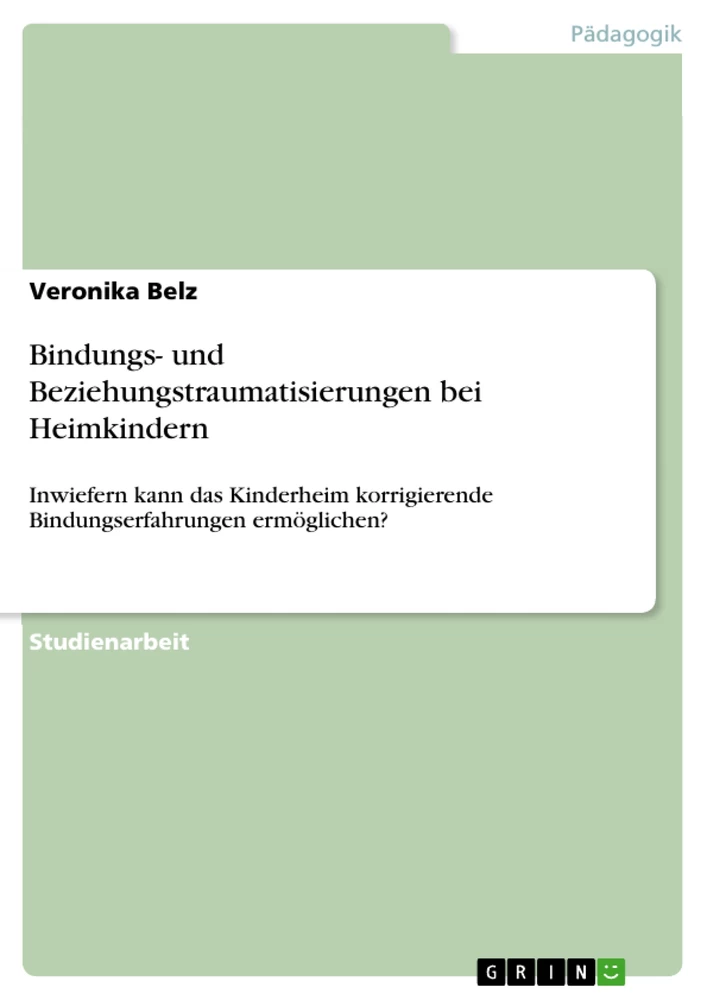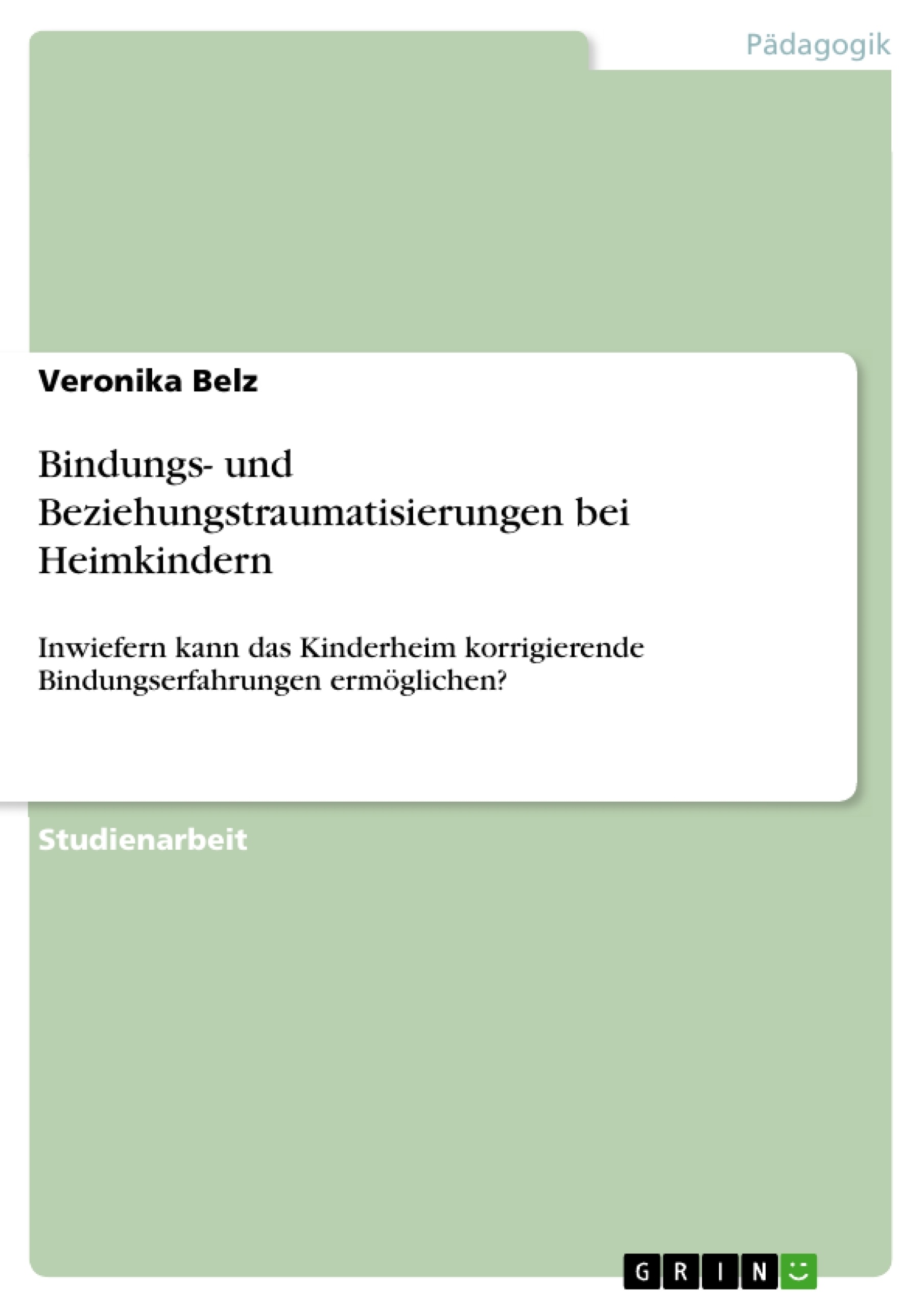80% der Kinder und Jugendlichen in stationären Heimen haben in der häuslichen Situation über einen längeren Zeitraum hinweg Traumatisierungen in Form von Vernachlässigung, Missbrauch oder Isolation durchlebt. Besonders gravierend sind die Folgen von traumatisierenden Erlebnissen, wenn diese durch die eigenen Bezugsperson(en) ausgelöst wurden und somit die Rolle des sicheren Hafen missachtet wurde. Derartige kumulative Traumata bewirken einen Zusammenbruch des kindlichen Ichs. Daher ist es unsere Aufgabe als Pädagogen das Netz psychischer Sicherheit wieder herzustellen und den Kindern Erfahrungen zur Entwicklung einer straken psychischen Widerstandsfähigkeit, Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und Erfahrungen des Selbstwertes zu ermöglichen, sodass die Autonomie des Kindes wieder hergestellt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Bindung
- 1.1 Grundannahmen der Bindungstheorie
- 1.2 Bindungsqualitäten
- 2. Traumata
- 2.1 Trauma - eine Definition
- 2.2 Traumatisierung durch Bindungsverlust
- 2.3 Umgang mit traumatisierten Kindern
- 3. Heimkinder und Heimerziehung
- 3.1 Strukturwandel der Heimerziehung
- 3.2 Bindungsverhalten bei Heimkindern
- 3.3 Das Heim als sicherer Ort?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Bindungs- und Beziehungstraumatisierungen bei Heimkindern und analysiert die Möglichkeiten, wie Kinderheime korrigierende Bindungserfahrungen ermöglichen können.
- Die Bedeutung der Bindungstheorie für die Entwicklung und das Verhalten von Kindern
- Die verschiedenen Arten von Traumata und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern
- Die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse traumatisierter Heimkinder
- Der Strukturwandel der Heimerziehung und seine Bedeutung für die Schaffung eines sicheren und förderlichen Umfelds
- Die Rolle der traumapädagogischen Arbeit in der Heimerziehung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Bindungs- und Beziehungstraumatisierungen bei Heimkindern dar und betont die Bedeutung eines sicheren Ortes für die Entwicklung des Kindes.
- Kapitel 1: Bindung: Dieses Kapitel erläutert die Grundannahmen der Bindungstheorie, die verschiedenen Bindungsqualitäten und deren Einfluss auf die psychische Entwicklung des Kindes.
- Kapitel 2: Traumata: Das Kapitel liefert eine Definition von Trauma und erläutert die verschiedenen Arten von Traumata, insbesondere die durch Bindungsverlust verursachten Traumatisierungen.
- Kapitel 3: Heimkinder und Heimerziehung: Dieses Kapitel beschreibt den Strukturwandel der Heimerziehung und die besonderen Herausforderungen, denen Heimkinder aufgrund ihrer Traumatisierungen gegenüberstehen. Es untersucht, ob und inwiefern das Heim einen sicheren Ort für korrigierende Bindungserfahrungen bieten kann.
Schlüsselwörter
Bindung, Traumatisierung, Beziehungstrauma, Heimkinder, Heimerziehung, Strukturwandel, Traumapädagogik, sicherer Ort, korrigierende Bindungserfahrungen, Internal Working Models, Feinfühligkeit, PTBS, Retraumatisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Bindungstraumatisierungen bei Heimkindern so häufig?
Etwa 80% der Heimkinder haben in ihrer Herkunftsfamilie Vernachlässigung, Missbrauch oder Isolation erlebt, oft durch die eigenen Bezugspersonen, was die Basis für sichere Bindung zerstört.
Was sind die Folgen eines Zusammenbruchs des kindlichen Ichs?
Ein solches kumulatives Trauma führt zu tiefen psychischen Erschütterungen, mangelndem Selbstwertgefühl und einer gestörten Autonomieentwicklung.
Wie kann Heimerziehung als "sicherer Ort" fungieren?
Durch korrigierende Bindungserfahrungen, pädagogische Feinfühligkeit und ein Netz psychischer Sicherheit kann das Heim helfen, die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Kinder zu stärken.
Was ist die Aufgabe von Pädagogen bei traumatisierten Kindern?
Pädagogen müssen Erfahrungen der Selbstwirksamkeit ermöglichen und das Kind dabei unterstützen, sein Vertrauen in Beziehungen und in sich selbst wiederaufzubauen.
Welchen Einfluss hat der Strukturwandel der Heimerziehung?
Der Wandel zielt darauf ab, weg von reiner Verwahrung hin zu traumapädagogischen Konzepten zu kommen, die den spezifischen Bedürfnissen traumatisierter Kinder gerecht werden.
- Citar trabajo
- Veronika Belz (Autor), 2018, Bindungs- und Beziehungstraumatisierungen bei Heimkindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431857