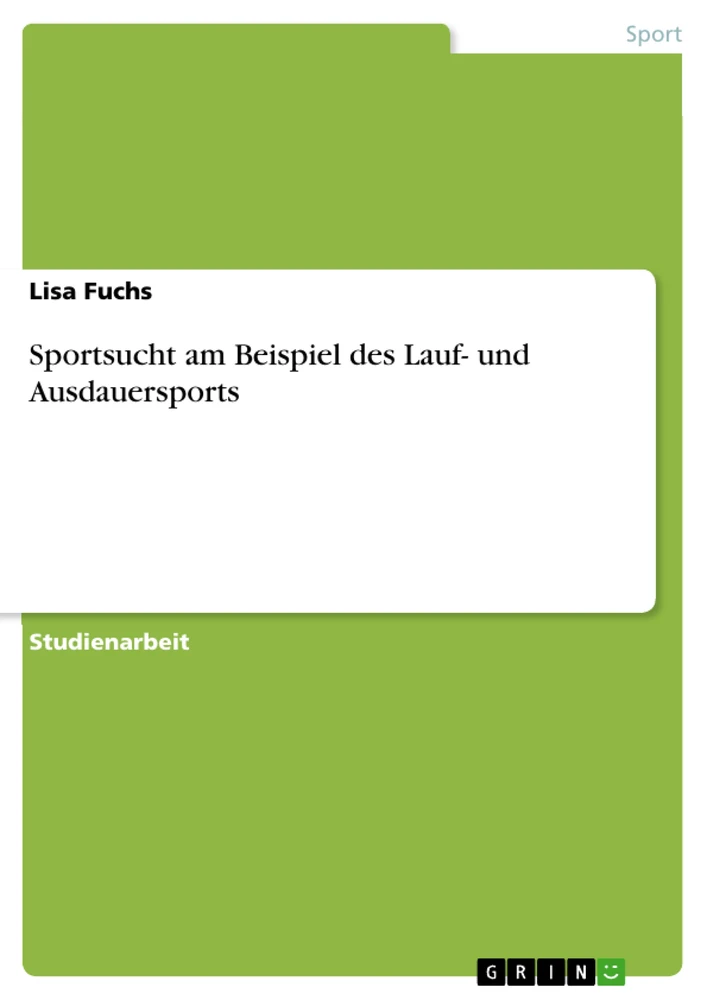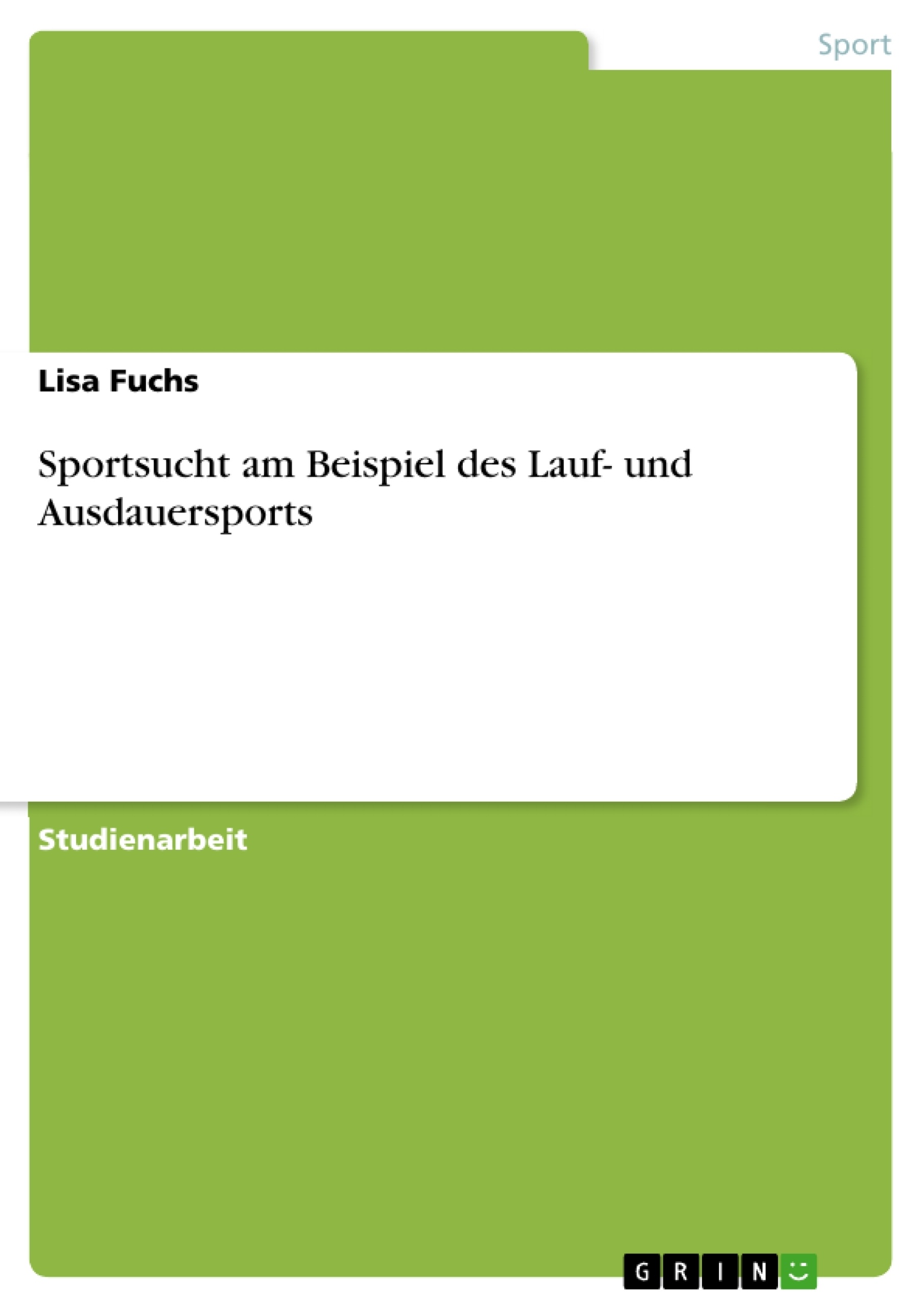„Was bewegt die Menschen dazu, eine extrem hohe Distanz zurückzulegen und täglich Strecken zu laufen von 20 bis hin zu 100 Kilometern?“ Diese Frage stellten sich Sportmediziner und Sportwissenschaftler im Zuge der seit 1983 ständig wachsenden Zahl an Marathonteilnehmern und dem daraus resultierenden Anstieg an Marathonläufen. Blickt man nur zurück auf den Anfang der 2000er Jahre, gab es rund 110 Marathonläufe in Deutschland. 2011 waren es schon 200 Marathonläufe, was einem Wachstum von beinahe 100% entspricht. Es folgten Triathlonwettbewerbe und immer härtere Wettkämpfe, wie zum Beispiel der Iron Man. Dieser entspricht einem Ultratriathlon, welcher sich aus 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und anschließend einem Marathon (42,195 km Laufen) zusammensetzt.
Diese Wettkämpfe fordern also eine extreme Ausdauerleistung von den Teilnehmern. Bezüglich des Marathons gibt es mittlerweile sogar Varianten, die sich über ein Vielfaches der ursprünglichen Distanz hinziehen und teilweise über mehrere Tage ausgetragen werden. Was also bewegt einen Menschen dazu, sich dieser Aufgabe anzunehmen und viele Stunden dafür zu trainieren? Was hilft ihm dabei, diese Distanzen zu überwinden? Schon vor einigen Jahren wurde von Dr. William Glasser der Begriff ‚Laufsucht‘ bzw. ‚running addiction‘ als Erklärungsansatz herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Theorie zur Fragestellung – Das Phänomen Sportsucht
- Sportsucht in der Forschung
- Formen und Prävalenz
- Kriterien der Sportsucht
- Methodisches Vorgehen
- Die Erhebungsmethode: Das Leitfadeninterview
- Die Auswertungsmethode: Grounded Theory
- Das Kodieren
- Auswertung der Interviews
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Gefährdung junger Frauen mit einem hohen Sportpensum, einer Sportsucht zu verfallen, zu untersuchen. Im Fokus steht dabei die Lauf-/Ausdauersucht, die als die am häufigsten erforschte Form der Sportsucht gilt.
- Das Phänomen der Sportsucht: Definition, Formen und Prävalenz
- Die Rolle von exzessivem Ausdauertraining und körperlichen Veränderungen bei der Entstehung der Sportsucht
- Die Bedeutung der psychischen Verfassung und Persönlichkeit der betroffenen Person
- Kriterien und Symptome der Sportsucht
- Die Gefährdung von jungen Frauen im Kontext von Leistungssport und Schönheitsidealen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und erläutert den Hintergrund der Untersuchung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Theorie zur Sportsucht, darunter die Forschung, Formen und Prävalenz sowie Kriterien der Sportsucht. Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen, wobei die Erhebungs- und Auswertungsmethoden vorgestellt werden. Die Auswertung der Interviews erfolgt in Kapitel 4. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Sportsucht, Laufsucht, Ausdauersucht, exzessives Sporttreiben, Abhängigkeit, psychische Störung, Forschung, Prävalenz, Kriterien, junge Frauen, Leistungssport, Schönheitsideale, Grounded Theory, Leitfadeninterview.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Sportsucht im Kontext des Ausdauersports?
Sportsucht bezeichnet ein zwanghaftes Verhaltensmuster, bei dem Betroffene trotz körperlicher oder sozialer Schäden extrem hohe sportliche Leistungen (z.B. Marathons) erbringen.
Warum sind besonders junge Frauen gefährdet?
Die Arbeit untersucht die Gefährdung junger Frauen im Spannungsfeld zwischen Leistungssport, gesellschaftlichen Schönheitsidealen und psychischer Verfassung.
Welche Kriterien weisen auf eine Sportsucht hin?
Dazu gehören Entzugserscheinungen bei Sportverzicht, Kontrollverlust über das Trainingspensum und die Vernachlässigung anderer Lebensbereiche.
Was ist der Begriff „Running Addiction“?
Der von Dr. William Glasser geprägte Begriff dient als Erklärungsansatz für die psychische Abhängigkeit von Langstreckenläufen.
Welche Forschungsmethode wurde in der Studie angewandt?
Die Untersuchung basiert auf Leitfadeninterviews, die nach der Methode der Grounded Theory (Kodieren) ausgewertet wurden.
- Citation du texte
- Lisa Fuchs (Auteur), 2018, Sportsucht am Beispiel des Lauf- und Ausdauersports, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432213