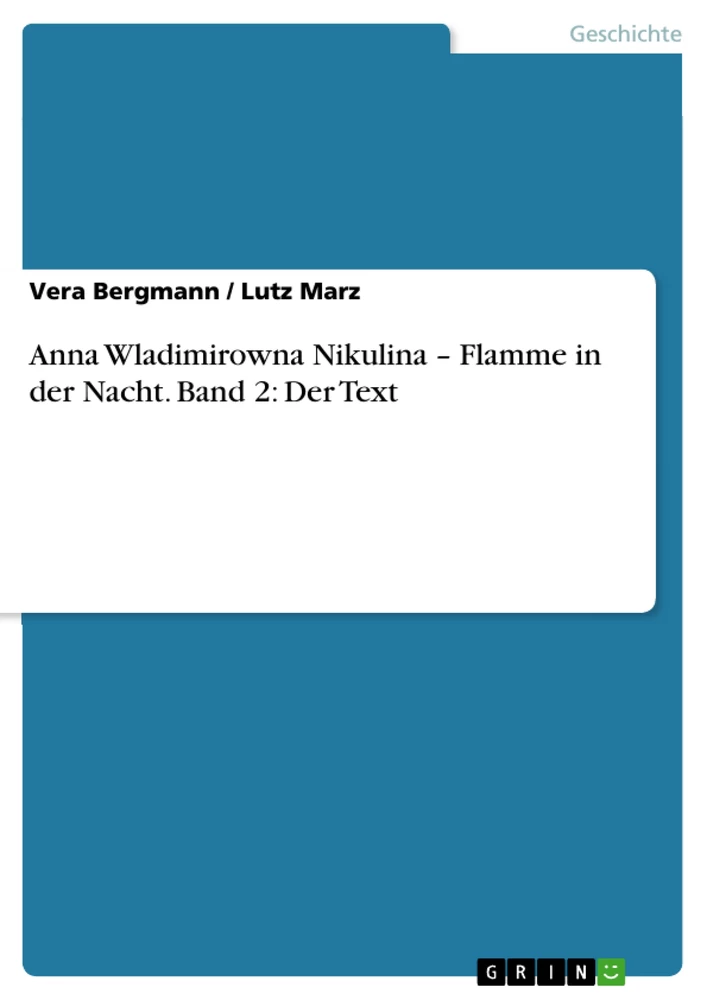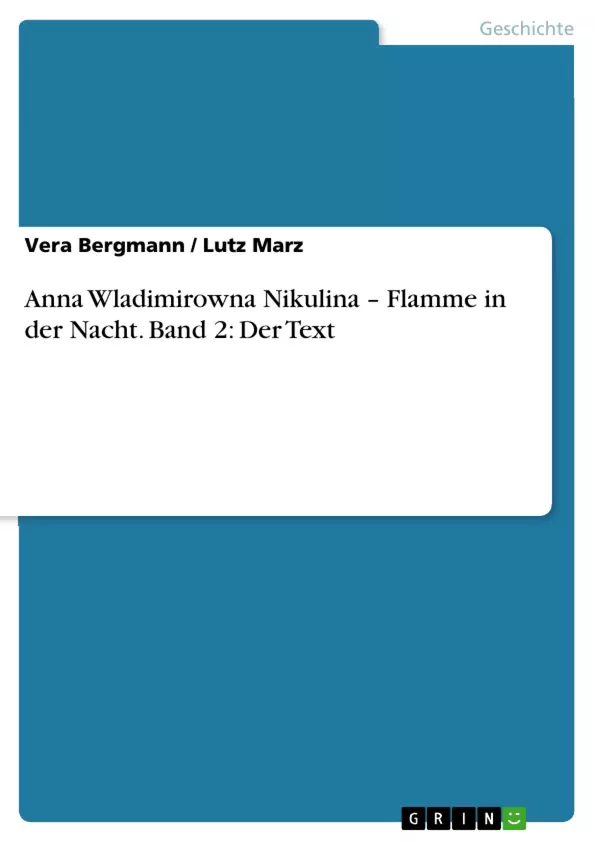Anna … Wer? Diese Frage werden sich fast alle stellen, die dieses Buch in die Hand nehmen, Russlandexperten nicht ausgenommen. Diese Frau ist heute eine Unbekannte, eine Vergessene. Und das, obwohl sie eine der großen Symbolfiguren des 20. Jahrhunderts ist. Würde es nicht zu vielerlei Missverständnissen Anlass geben und überdies der Bescheidenheit dieser Frau zutiefst zuwiderlaufen, dann wäre man versucht, sie als eine moderne Heroine oder eine sowjetische Jeanne d’Arc zu bezeichnen.
Auf das Drängen vieler Menschen hin, denen sie von ihren Erlebnissen im 2. Weltkrieg berichtete, hat Anna Nikulina Anfang der 80er Jahre des vorherigen Jahrhunderts ihre Erinnerungen an jene Zeit veröffentlicht. Darin schildert die Kosakentochter ihren 5.000 Kilometer langen Weg vom nordkaukasischen Mosdok bis nach Berlin. Diese Erinnerungen werden im vorliegenden Band 2 des Buches „Anna Wladimirowna Nikulina Flamme in der Nacht“ erstmalig komplett in deutscher Sprache vorgelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Band 2: Der Text
- Vorwort
- Zu Anmerkungen, Korrekturen und Übersetzungen
- Das Buch und die Geschichte
- Die literarische Gestalt
- Die Liebe
- Die Sprache
- Die Geschichte
- Die Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausgabe von „Flamme in der Nacht“ von Anna Wladimirowna Nikulina widmet sich der intensiven Analyse des Textes und seiner literarischen Bedeutung. Die Herausgabe zielt darauf ab, das Werk sowohl literarisch als auch historisch zu beleuchten und Einblicke in die Geschichte und die Lebenswelt des Autors zu geben. Die Edition bietet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Roman, seiner literarischen Gestalt, der Darstellung von Liebe, Sprache, Geschichte und Literatur.
- Die literarische Gestalt von „Flamme in der Nacht“
- Die Darstellung von Liebe und ihren Facetten im Roman
- Die Analyse der Sprache und ihrer Funktion in Nikulinas Werk
- Die Einbettung der Geschichte in den historischen Kontext
- Die Bedeutung des Romans für die russische Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort bietet einen ersten Überblick über die Edition und ihre Zielsetzung.
- Die Kapitel „Zu Anmerkungen, Korrekturen und Übersetzungen“ und „Das Buch und die Geschichte“ beleuchten die Entstehung des Romans und die biografischen Hintergründe des Autors.
- „Die literarische Gestalt“ widmet sich der Analyse der literarischen Form und der Gestaltungstechniken des Romans.
- „Die Liebe“ untersucht die verschiedenen Arten von Liebe und ihren Einfluss auf die Handlung und die Figuren.
- „Die Sprache“ analysiert die Sprachkunst des Romans, die Verwendung von Symbolen und Metaphern.
- „Die Geschichte“ setzt den Roman in den historischen Kontext des frühen 20. Jahrhunderts und untersucht seine Bedeutung für die russische Geschichte.
- „Die Literatur“ beleuchtet die Bedeutung des Romans für die russische Literatur und seinen Platz im literarischen Kanon.
Schlüsselwörter
Anna Wladimirowna Nikulina, Flamme in der Nacht, Roman, Literatur, Geschichte, Liebe, Sprache, Russland, Sowjetunion, Geschichte des 20. Jahrhunderts, literarische Analyse, Biografische Hintergründe, Stil, Sprache, Figuren, Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Anna Wladimirowna Nikulina?
Eine heute fast vergessene Symbolfigur des 20. Jahrhunderts, die als sowjetische Soldatin im Zweiten Weltkrieg von Kaukasus bis nach Berlin zog.
Wovon handelt das Buch "Flamme in der Nacht"?
Es enthält die persönlichen Erinnerungen der Kosakentochter Nikulina an ihren 5.000 Kilometer langen Weg während des Zweiten Weltkriegs.
Warum ist dieser zweite Band der Edition besonders wichtig?
Er bietet den Text der Erinnerungen erstmals komplett in deutscher Sprache an und analysiert ihn literaturwissenschaftlich.
Welche Themen werden in der Textanalyse schwerpunktmäßig behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf die literarische Gestalt, die Darstellung der Liebe, die Sprachkunst und die historische Einbettung des Werks.
Wie wird Nikulina in der Einleitung charakterisiert?
Sie wird als moderne Heroine oder "sowjetische Jeanne d’Arc" bezeichnet, wobei ihre tiefe Bescheidenheit betont wird.
- Citar trabajo
- Vera Bergmann (Autor), Lutz Marz (Autor), 2018, Anna Wladimirowna Nikulina – Flamme in der Nacht. Band 2: Der Text, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432556