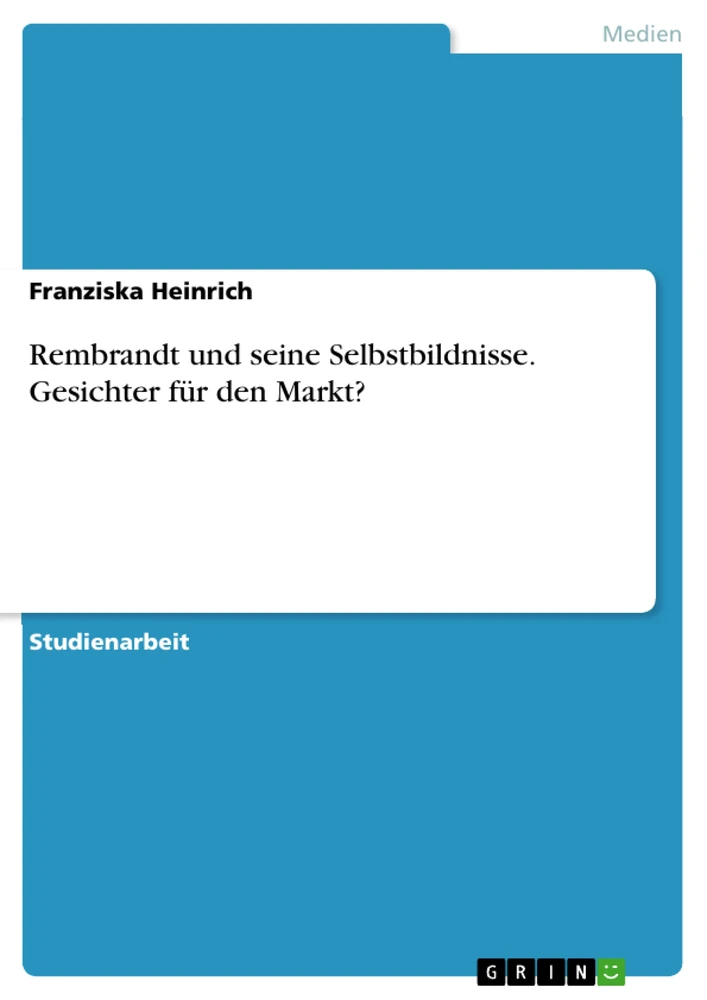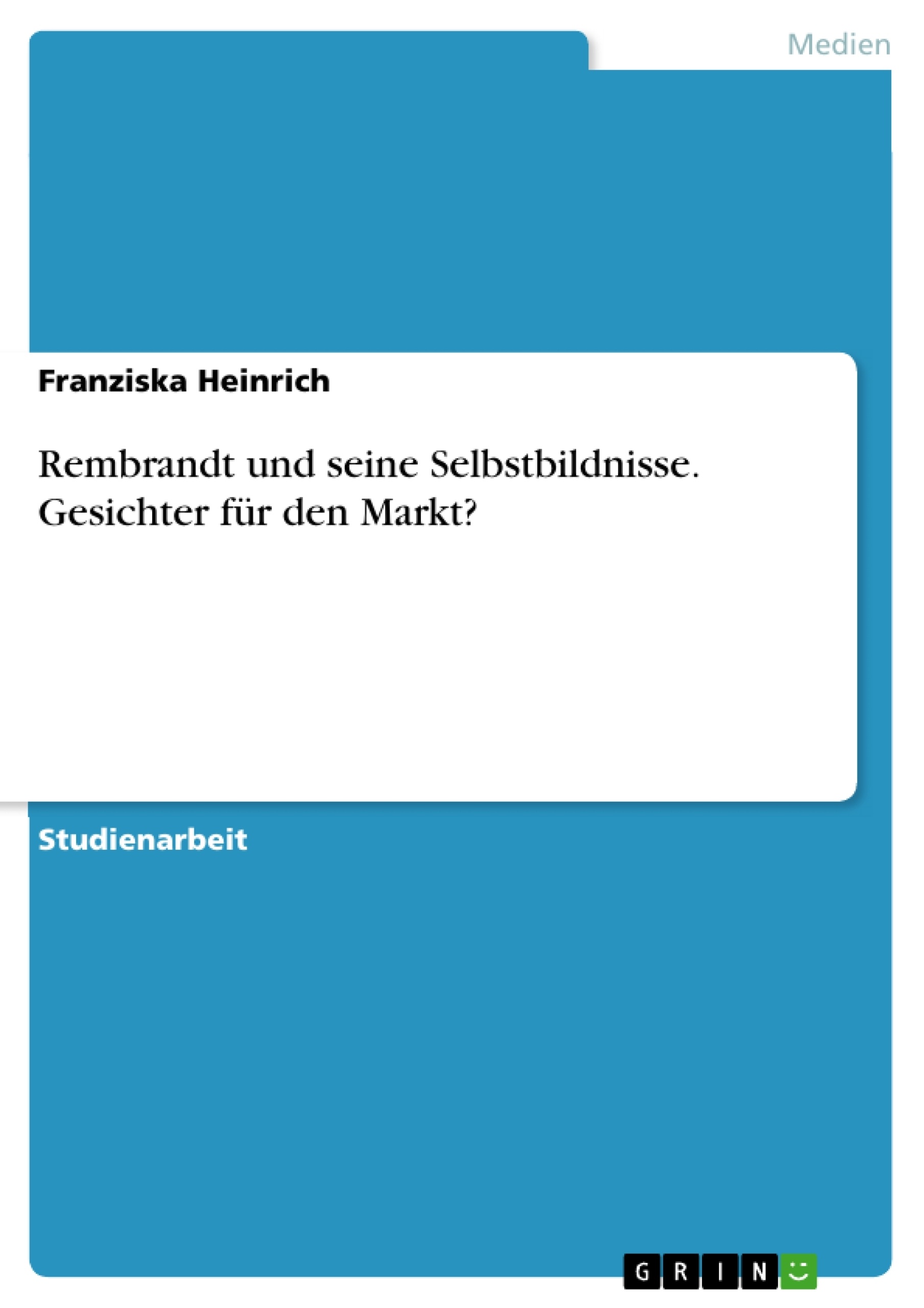In seiner Geschichte des wohlhabenden Schönlings, der ein Bild von sich besitzt, das anstelle seiner Selbst altert, stellt OSKAR WILDE eine Vermutung auf, die bereits LEONARDO DA VINCI geäußert haben soll. Die Vorstellung, dass ein Künstler in jedem seiner Werke einen Teil seiner Seele abbildet, existierte bereits in der Renaissance, sie hält sich bis heute und wird wohl bei keinem Maler so vielfältig diskutiert wie bei REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN. Kein Künstler betrachtete sich so häufig im Spiegel, um die eigene Erscheinung kritisch zu beobachten, wieder und wieder zu studieren und detailverliebt für die Ewigkeit festzuhalten. Die Zahl der ihm zugeschrieben Selbstbildnisse variiert stark und ändert sich jährlich, aber sie ist mit Abstand die höchste uns bekannte aus dem Œuvre eines einzigen Menschen.
Seine Gründe hierfür boten der Forschung seit jeher einen fruchtbaren Nährboden für Spekulationen aller Art. Vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren diese zumeist biografisch-psychologischer Natur und erzählten mit viel Pathos eine Mär vom einsamen Genie auf der Suche nach sich selbst. Genauere Untersuchungen der Umstände in denen REMBRANDT lebte und arbeitete, ein Blick auf den gerade entstehenden Kunstmarkt und das Aufblühen des Kapitalismus im „goldenen Zeitalter“ der Niederlande, wecken jedoch Zweifel an den eingestaubten Thesen. Sind seine Selbstporträts der malerische Versuch, das eigene Ich zu verstehen? Waren seine Leinwände das Fundament einer in dunklen Farben verbildlichten Depression? War er ein Narzisst? Oder war er viel eher ein gewiefter Geschäftsmann, ein Trendsetter, der wusste was gefragt war und genau das produzierte? Diese Fragen stehen im Zentrum der vorliegenden Seminararbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter.1
- Selbstbildnisse Rembrandts: Motivation, Funktion und Rezeption
- Ä$lles was er liebte, waren VHLQH)UHLKHLW GLH 0DOHUHLXQGGDV *HOG ³3
- Die Bedeutung der Selbstbefragung
- Selbstbildnis mit aufgerissenen Augen (Abb. 1) aus dem Jahr 1630
- Radierung
- Emotionen
- Affektstudien
- HOOGSTRATEN ZDUHVDXFK GHULPPHQVFKOLFKHQ *HVLFKWHLQHQ Ä6SLHJHOGHV *HLVWHV³19
- Porträtsammlungen im Wandel
- Der Kunstmarkt im 17. Jahrhundert
- Rembrandts Werkstatt und Geschäftsmodell
- Selbstbildnis mit Barett und goldener Kette (um 1630/31) (Abb. 2)
- Rembrandts Selbstporträts als Wirtschaftsfaktor
- Der Stellenwert von REMBRANDTs Selbstporträts in der Kunstgeschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beleuchtet die Selbstporträts von Rembrandt van Rijn und untersucht die Motivation und Rezeption dieser Werke im 17. Jahrhundert. Besondere Aufmerksamkeit gilt den kunsthistorischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Hintergründen von Rembrandts Selbstbildnissen.
- Die Bedeutung von Rembrandts Selbstbildnissen für die Entwicklung des Kunstmarktes.
- Rembrandts künstlerisches Schaffen im Kontext der Frühaufklärung und des wachsenden Interesses an der menschlichen Psyche.
- Die Rolle der Affekte und Emotionen in Rembrandts Kunst und deren Rezeption durch Zeitgenossen.
- Die Verbindung zwischen Rembrandts Selbstbildnissen und seinen Porträtaufträgen für zahlungskräftige Kunden.
- Die Rolle von Druckgrafiken, insbesondere Radierungen, im Werdegang von Rembrandt und deren Bedeutung für die Verbreitung seiner Selbstbildnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die historische und theoretische Grundlage für die Untersuchung von Rembrandts Selbstbildnissen dar. Es beleuchtet die Verbindung zwischen künstlerischem Schaffen und dem Selbstbild sowie den Einfluss der Renaissance und des Barocks auf die Künstlerpersönlichkeit.
- Das zweite Kapitel setzt sich mit der Bedeutung der Selbstbefragung in der Frühaufklärung auseinander und analysiert den Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Kunstwerken und Künstlern. Es untersucht die Entwicklung des Kunstmarktes im 17. Jahrhundert und die Bedeutung von Rembrandts Selbstbildnissen in diesem Kontext.
- Das dritte Kapitel analysiert Rembrandt van Rijns Selbstbildnis mit aufgerissenen Augen aus dem Jahr 1630. Es untersucht die Bedeutung von Affekten und Emotionen in Rembrandts Kunst und setzt die Radierung als künstlerisches Medium in den Kontext seiner künstlerischen Praxis und der Entwicklung des Kunstmarktes.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Rembrandts Werkstatt und seinem Geschäftsmodell. Es beleuchtet die Verbindung zwischen Künstler, Kunstwerk und Markt und analysiert den Einfluss von Rembrandts Selbstbildnissen auf die Wahrnehmung und Rezeption seines künstlerischen Schaffens.
- Das fünfte Kapitel untersucht die Verbreitung und Rezeption von Rembrandts Selbstbildnissen. Es betrachtet die unterschiedlichen Formen der Reproduktion und die Bedeutung von Druckgrafiken, insbesondere Radierungen, für die Verbreitung von Rembrandts Werk.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit Rembrandts Selbstbildnissen, deren Bedeutung für die Entwicklung des Kunstmarktes, die Rolle der Selbstbefragung in der Frühaufklärung, die Affekte und Emotionen in Rembrandts Kunst und die Verbreitung von Selbstbildnissen durch Druckgrafik, insbesondere Radierungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum malte Rembrandt so viele Selbstbildnisse?
Die Gründe reichen von psychologischen Studien des eigenen Ichs bis hin zu rein geschäftlichen Motiven, da seine Porträts auf dem Kunstmarkt sehr gefragt waren.
War Rembrandt ein "gewiefter Geschäftsmann"?
Die Arbeit untersucht die These, dass Rembrandt den entstehenden Kunstmarkt im "goldenen Zeitalter" der Niederlande gezielt nutzte und seine Selbstporträts als Markenprodukt einsetzte.
Welche Rolle spielen Affektstudien in seinen Werken?
In Werken wie dem "Selbstbildnis mit aufgerissenen Augen" studierte Rembrandt menschliche Emotionen und Gesichtsausdrücke, die er auch für seine Auftragswerke nutzte.
Wie verbreitete Rembrandt seine Bildnisse?
Neben Ölgemälden nutzte er vor allem Radierungen (Druckgrafiken), um seine Werke einer breiteren Käuferschicht zugänglich zu machen.
Wie hat sich die Forschung zu Rembrandt verändert?
Während man früher oft das "einsame Genie" sah, betrachtet die moderne Forschung stärker die ökonomischen Zwänge und den Kontext des frühen Kapitalismus.
- Arbeit zitieren
- Franziska Heinrich (Autor:in), 2018, Rembrandt und seine Selbstbildnisse. Gesichter für den Markt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432729