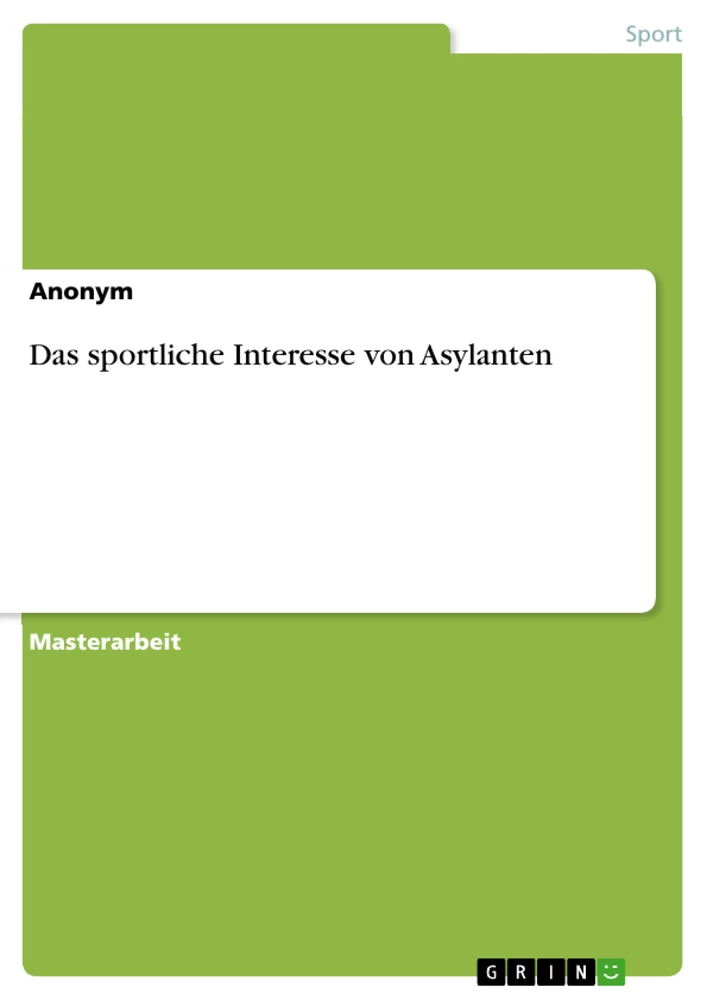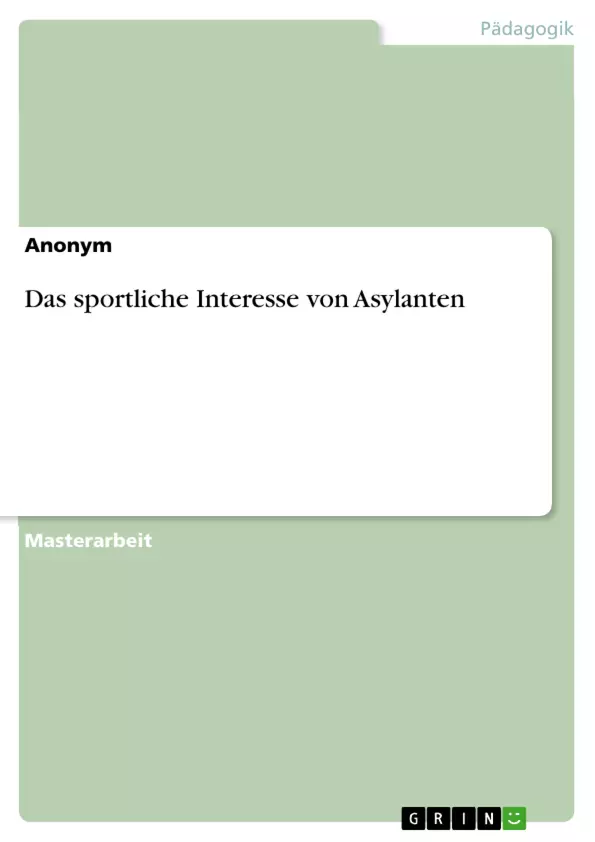Angesichts der unstabilen politischen Lage in vielen Ländern der Welt sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Statistiken des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR besagen, dass seit 2015 weltweit 65,3 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Ein Jahr zuvor waren es 59,5 Millionen und im Jahr 2011 42,5 Millionen. Insofern ist die Anzahl der weltweit Flüchtenden in den letzten fünf Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen.
Die Menschen fliehen aufgrund von Kriegen oder allgemein ungünstigen Lebensbedingungen. Bei den meisten Flüchtenden handelt es sich um Vertriebene innerhalb des Heimatlandes (40, 8 Millionen, 2015). Der restliche Anteil flieht in die Nachbarländer oder macht sich auf den Weg nach Europa. Aufgrund des Sozialsystems und der florierenden Wirtschaft gilt auch Deutschland als ein beliebtes Ziel.
Aus den Berichten des UNHCR geht hervor, dass 2015 weltweit zwei Millionen Asylanträge (Erstanträge) eingereicht worden sind. Davon wurden allein rund 442.000 in Deutschland gestellt – mehr als in jedem anderen Land. Von Januar bis November 2016 wurden insgesamt 723.027 Asylanträge vom Bundesamt entgegengenommen, dies bedeutet eine Erhöhung der Antragszahlen um 70,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr desselben Zeitraums (rund 425.000 Asylanträge von Januar bis November 2015).
In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in den Hauptherkunftsländern, zu denen unter anderem Syrien und Afghanistan angehören, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Flüchtenden zukünftig weiter steigen wird. Demzufolge gewinnt die Integration dieser Menschen immer mehr an Relevanz und ist zukünftig eine der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Herausforderung. Um ein gemeinsames Miteinander verwirklichen zu können, muss die Integration als ein wechselseitiger Prozess angesehen werden.
Dafür bedarf es einerseits der Bereitschaft der Zuwanderer sich zu integrieren und andererseits der Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft sich mit fremden Kulturen auseinanderzusetzen. Ein besonders integratives Potenzial wird dem Sport zugeschrieben. Nach dem Motto „Sport spricht alle Sprachen“ stellt er eine ideale Plattform zur Zusammenführung von Menschen unterschiedlicher Herkunft dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition: Migration
- Zahlen und Fakten
- Sport als Integrationsmotor – theoretische Grundlagen
- Der allgemeine Integrationsbegriff
- Vereinswesen in Deutschland
- Herausforderungen
- Sportbezogene Integration
- Ein kritischer Überblick
- Hindernisse im Bereich Sport und Integration
- Kulturelle Differenzen
- Sozioökonomische Differenzen
- Integrative Maßnahmen
- Spin-sport interkulturell
- Methodik
- Das Erhebungsinstrument
- Gestaltung des Interviewleitfadens
- Zugänge zum Forschungsfeld
- Beschreibung der Befragten
- Beschreibung des Interviewablaufs
- Auswertungsmethode
- Aussagekraft der Daten
- Ergebnisdarstellung
- Kategorien im Überblick
- Kategorie „Sport im Heimatland“
- Subkategorie „Sportarten“
- Subkategorie „Anzahl der Tage pro Woche“
- Subkategorie „Schulsport“
- Subkategorie „Organisation“
- Subkategorie „Stellenwert“
- Subkategorie „Hindernisse“
- Kategorie „Sport in Deutschland“
- Subkategorie „ausführende Sportarten“
- Subkategorie „Anzahl der Tage pro Woche“
- Subkategorie „Organisation“
- Subkategorie „Hindernisse“
- Kategorie „Motive des Sporttreibens“
- Kategorie „Spezifische Bedürfnisse“
- Subkategorie „Sportarten“
- Subkategorie „Geschlechtertrennung“
- Subkategorie „Ort der Sportausübung“
- Subkategorie „Gruppensport“
- Subkategorie „Gruppenzusammensetzung“
- Subkategorie „Interesse am vermehrten Sporttreiben“
- Kernkategorie Gewohnheit
- Kategorie „Sport im Heimatland“ zur Kernkategorie Gewohnheit
- Kategorie „Sport im Deutschland“ zur Kernkategorie Gewohnheit
- Kategorie „Spezielle Bedürfnisse“ zur Kernkategorie Gewohnheit
- Kategorie „Motive“ zur Kernkategorie Gewohnheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das sportliche Interesse von Asylanten in Deutschland. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration von Asylanten durch den Sport.
- Der Einfluss kultureller und sozioökonomischer Faktoren auf das sportliche Interesse von Asylanten.
- Die Rolle des Sports als Integrationsmotor.
- Die Herausforderungen und Chancen des Vereinswesens in der Integration von Asylanten.
- Die Analyse von sportlichen Bedürfnissen und Präferenzen von Asylanten.
- Die Entwicklung von integrativen Maßnahmen im Sportbereich.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit, die Relevanz des Themas und den Forschungsstand vor.
- Begriffsdefinition: Migration: Hier werden zentrale Begriffe wie Migration und Integration definiert und in den Kontext der Arbeit eingeordnet.
- Zahlen und Fakten: In diesem Kapitel werden relevante Zahlen und Fakten zur Asylmigration in Deutschland dargestellt.
- Sport als Integrationsmotor – theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des Sports als Integrationsmotor und analysiert den Integrationsbegriff sowie das Vereinswesen in Deutschland.
- Methodik: Das Kapitel beschreibt die angewandte Methodik der Arbeit, wie die Erhebungsmethoden, das Forschungsdesign und die Auswertungsmethode.
- Ergebnisdarstellung: Die Ergebnisse der Untersuchung werden hier präsentiert und nach Kategorien geordnet, um ein umfassendes Bild des sportlichen Interesses von Asylanten zu zeichnen.
- Kernkategorie Gewohnheit: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Gewohnheiten im Zusammenhang mit dem sportlichen Verhalten von Asylanten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sport, Integration, Asylanten, Vereinswesen, kulturelle Differenzen, sozioökonomische Differenzen, integrative Maßnahmen, Sportinteresse, Gewohnheit, Empirische Forschung, qualitative Forschung, Interviewmethode.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Sport als guter Integrationsmotor für Asylanten?
Nach dem Motto „Sport spricht alle Sprachen“ bietet er eine Plattform zur Zusammenführung von Menschen unterschiedlicher Herkunft ohne hohe sprachliche Barrieren.
Welche Hindernisse erschweren Asylanten den Zugang zum Sport?
Kulturelle Differenzen, sozioökonomische Faktoren (Kosten, Mobilität) und fehlendes Wissen über das deutsche Vereinswesen sind häufige Barrieren.
Welche Motive haben Asylanten, Sport zu treiben?
Neben gesundheitlichen Aspekten stehen soziale Kontakte, Ablenkung vom Alltag und die Fortführung von Gewohnheiten aus dem Heimatland im Vordergrund.
Welche Rolle spielen Gewohnheiten beim Sportinteresse?
Die Arbeit zeigt, dass das Sportverhalten in Deutschland stark davon geprägt ist, welche Sportarten und Organisationsformen bereits im Heimatland praktiziert wurden.
Welche spezifischen Bedürfnisse haben Asylanten im Sport?
Dazu gehören Wünsche nach bestimmten Sportarten, teilweise Geschlechtertrennung oder die bevorzugte Gruppenzusammensetzung beim Training.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Das sportliche Interesse von Asylanten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432903