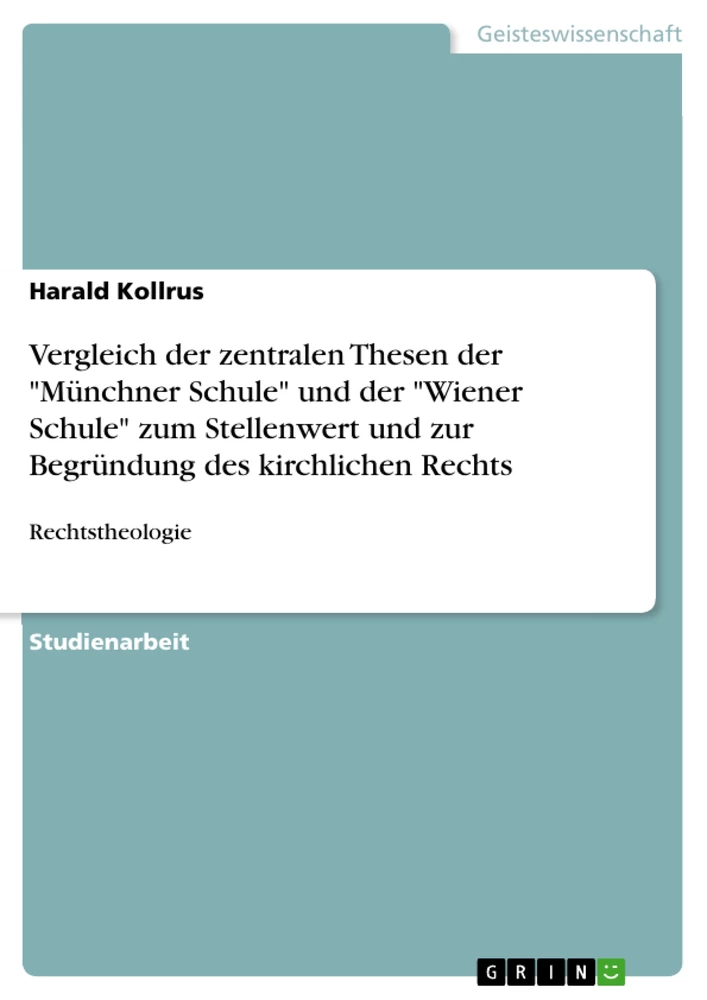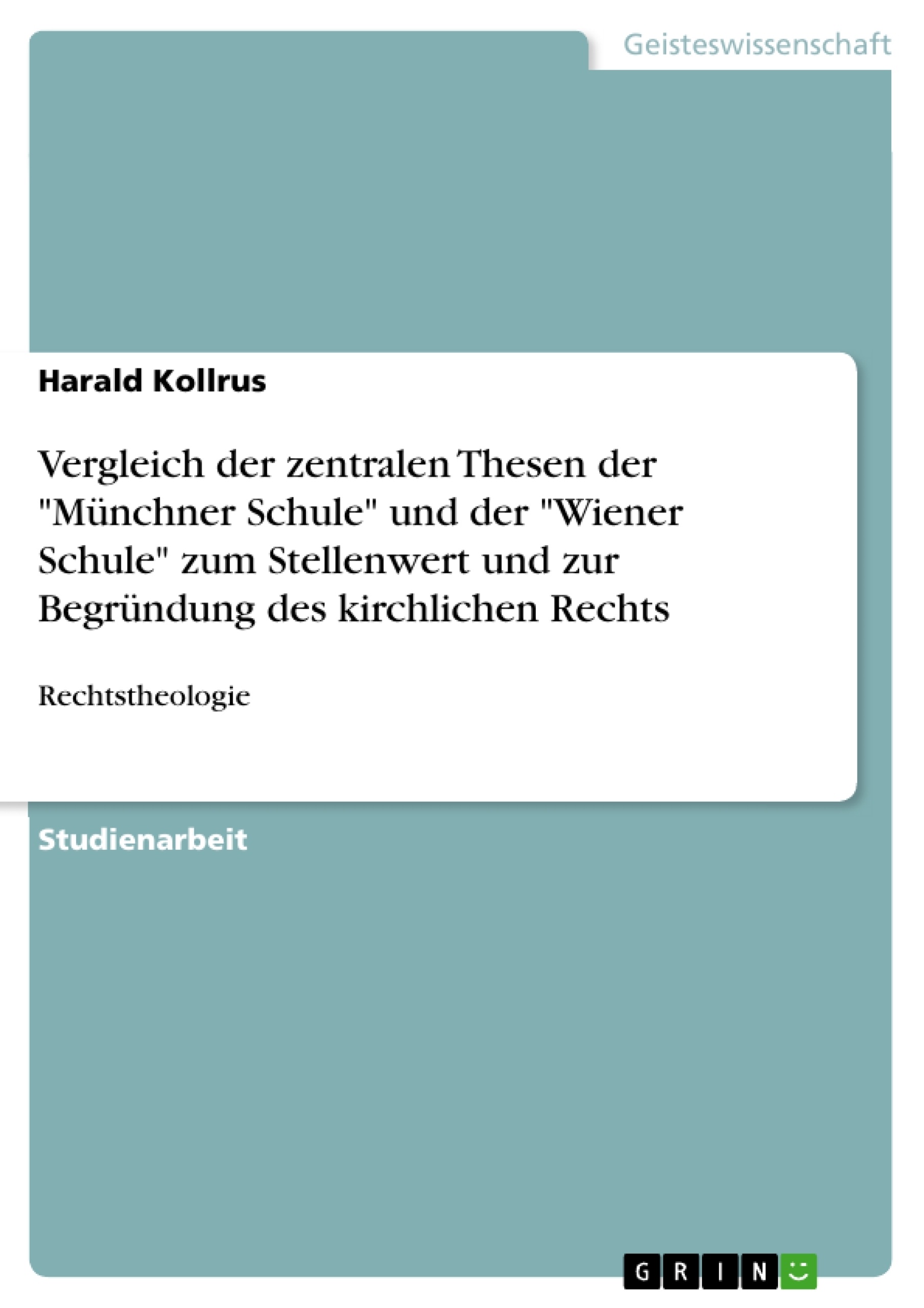Beide Schulen, die sog. „Münchner Schule“ und die „Wiener Schule“, befassen sich mit der Frage nach der grundlegenden Legitimierung von Kirchenrecht, also seiner Daseinsberechtigung, ob und inwieweit das Phänomen „Recht“ zur Kirche gehört. Grundlage dafür ist die Frage nach dem Wesen des kanonischen Rechts. Im ersten Teil werden die Thesen zur Grundlegung des kanonischen Rechts (Kirchenrecht) von der „Münchner Schule“ in Ziff. II. 1. und von der „Wiener Schule“ in Ziff. II. 2. dargelegt. Im Anschluss wird der Auslöser für diese Grundlagendiskussion beleuchtet (II. 3.). Im zweiten Teil werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Folgewirkungen auf Rechtserzeugung (III. 1.), den wissenschaftlichen Stellenwert (III. 2.) und auf die Bedeutung und Ausgestaltung des Kirchenrechts aufgezeigt (III. 3. und 4.).
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. BEGRÜNDUNG DES KIRCHLICHEN RECHTS
- 1. Kerygmatisch-sakramentale Begründung der „,Münchner Schule”
- a) ius divinum (positivum) bestimmt die Kirche als communio hierarchica
- (1) communio-Theologie als Ausgangsbasis der Argumentationskette
- (2) Göttliches Gehorsamsgebot
- (3) Verwirklichung der Heilsordnung durch ius mere ecclesiae
- b) Funktionelle Ähnlichkeit von Wurzelsakrament der Kirche und Rechtssymbolen
- c) Der Gläubige als Rechtssubjekt
- d) Wechselwirkungen zwischen kanonischem Recht und dem Glauben
- e) Kanonische Folgerung aus theologischen Fakten
- f) Ableitung des Kirchenrechtsbegriffs
- a) ius divinum (positivum) bestimmt die Kirche als communio hierarchica
- 2. Theologisch-rechtsphilosophische Begründung der „Wiener Schule“
- a) Praktische Notwendigkeit eines erweiterten Kirchenrechtsverständnisses
- (1) Moralisierung\" des Kirchenrechts
- (a) Gefahr eines innerkirchlichen Machtmissbrauchs
- (b) Innerkirchliche Konfliktpotentiale
- (2) Notwendigkeit allgemeiner Gerechtigkeits- und Rechtsstandards
- (1) Moralisierung\" des Kirchenrechts
- b) Freiheitsfunktionale Konzipierung des Rechtsbegriffs
- (1) Freiheit zur Verwirklichung einer christlichen Lebensweise
- (2) Sakramentale Grundlegung dieses Freiheitsanspruchs
- (3) Sicherung von Freiheit durch die Kirche
- c) Allgemeine Sakramentalität der Kirche und Humanität in der Welt
- d) Effektiver Rechtsschutz vor übermäßiger Jurisdiktionsgewalt
- (4) Unzulässige Gesetzgebungsdelegation auf staatlichen Gesetzgeber
- e) Das klassische Rechtsverständnis
- f) Akzeptanz des kanonischen Rechts durch Gläubige
- g) Relative Autonomie des kanonischen Rechts
- h) communio mit rechtlicher Verbindlichkeit
- i) Unvereinbarkeit des ius mere ecclesiae mit der communio als Liebesgemeinschaft
- j) Ableitung eines Kirchenrechtsbegriffs
- a) Praktische Notwendigkeit eines erweiterten Kirchenrechtsverständnisses
- 3. Der Anlass für beide Schulen zur Begründung des Kirchenrechts
- a) Abkehr von der Lehre der Schule der „ius publicum ecclesiasticum“ (IPE)
- b) Einfluss der Sohm´schen Thesen auf die konziliare Ekklesiologie
- 1. Kerygmatisch-sakramentale Begründung der „,Münchner Schule”
- III. FOLGEWIRKUNGEN AUF DEN STELLENWERT DES KIRCHENRECHTS IN SEINER ANWENDUNG
- 1. Arbeitsablauf für die Erzeugung des Kirchenrechts
- 2. Verhältnis zwischen Kanonistik und theologischer Wissenschaft
- 3. Der funktionale Stellenwert des Kirchenrechts
- a) Auf Legitimationsfunktion reduziertes Rechtsverständnis der „Münchner Schule”
- b) Gerechtigkeitsverständnis der „Wiener Schule” im göttlichen und juristischen Sinn
- 4. Prägnanz der juristischen Sprache
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert und vergleicht die zentralen Thesen der „Münchner“ und der „Wiener Schule“ in Bezug auf den Stellenwert und die Begründung des kirchlichen Rechts. Sie untersucht, wie die beiden Schulen das Wesen des Kirchenrechts verstehen und welche Folgerungen sich daraus für die Praxis ergeben.
- Theologisch-rechtsphilosophische Fundierung des Kirchenrechts
- Konzeption des Kirchenrechts als Ausdruck der göttlichen Ordnung
- Bedeutung des Kirchenrechts für die Lebensordnung der Kirche
- Verhältnis von Kirche, Recht und Glauben
- Zusammenspiel von theologischer und juristischer Perspektive im Kirchenrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Legitimierung des Kirchenrechts ein und skizziert den Aufbau der Hausarbeit. Kapitel II stellt die zentralen Thesen zur Begründung des Kirchenrechts der „Münchner Schule“ und der „Wiener Schule“ dar. Kapitel III analysiert die Auswirkungen der verschiedenen Thesen auf die Rechtserzeugung, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Kirchenrecht und die Bedeutung des Kirchenrechts in der Praxis.
Schlüsselwörter
Kirchenrecht, kanonisches Recht, „Münchner Schule“, „Wiener Schule“, Legitimation, Theologie, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, communio, ius divinum, ius mere ecclesiae, Gerechtigkeit, Freiheit, Sakrament, Heilsordnung, Kirche, Gläubige, Göttliches Gesetz, Evangelische Botschaft, Ekklesiologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der "Münchner Schule" im Kirchenrecht?
Die Münchner Schule betont eine kerygmatisch-sakramentale Begründung, wonach das Kirchenrecht untrennbar mit der Heilsordnung und dem Wesen der Kirche als communio hierarchica verbunden ist.
Wie begründet die "Wiener Schule" das kirchliche Recht?
Die Wiener Schule verfolgt einen theologisch-rechtsphilosophischen Ansatz, der die Freiheitsfunktion des Rechts und den Schutz des Gläubigen vor Machtmissbrauch in den Vordergrund stellt.
Was ist der Unterschied zwischen "ius divinum" und "ius mere ecclesiae"?
Ius divinum ist göttliches Recht, das als unveränderlich gilt, während ius mere ecclesiae rein kirchliches Recht ist, das der Organisation dient und vom Gesetzgeber angepasst werden kann.
Welchen Stellenwert hat Gerechtigkeit in der Wiener Schule?
In der Wiener Schule ist Gerechtigkeit ein zentraler Maßstab, um das kanonische Recht an allgemeinen Rechtsstandards zu messen und die Autonomie des Rechts gegenüber der Theologie zu wahren.
Wer war Rudolf Sohm und warum ist er für diese Diskussion wichtig?
Rudolf Sohm behauptete, das Wesen des Kirchenrechts stehe im Widerspruch zum Wesen der Kirche. Beide Schulen versuchen, seine Thesen zu widerlegen und die Daseinsberechtigung des Rechts in der Kirche neu zu begründen.
- Citar trabajo
- Harald Kollrus (Autor), 2017, Vergleich der zentralen Thesen der "Münchner Schule" und der "Wiener Schule" zum Stellenwert und zur Begründung des kirchlichen Rechts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432970