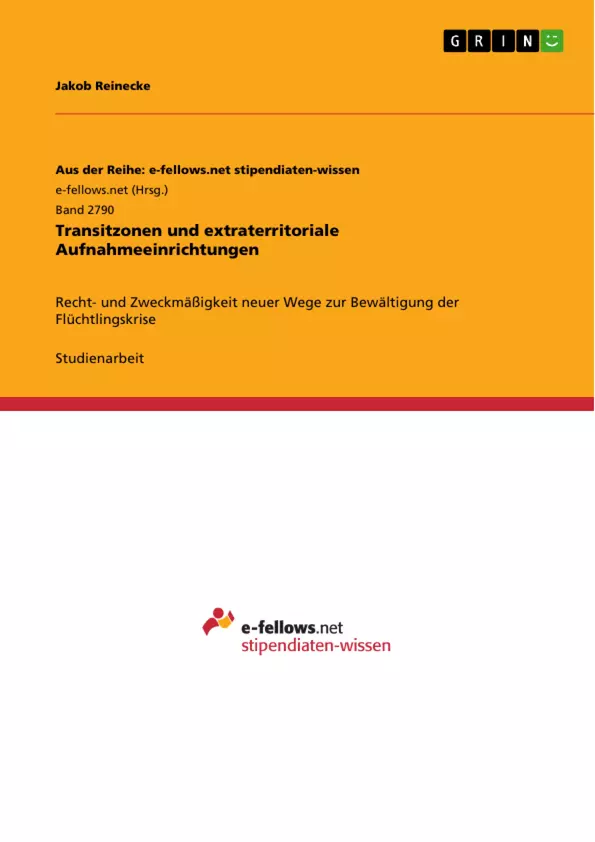Sie ist seit mehreren Jahren eines der bestimmenden Themen in der Tagespolitik: Die sogenannte Flüchtlingskrise. Nach Jahrzehnten vergleichsweise geringer Zuwanderung ist Europa im 21. Jahrhundert von Migration in einem Ausmaß betroffen, welches zumindest in der jüngeren Geschichte des Kontinents seinesgleichen sucht. Gerade für Deutschland ist freilich die Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten des ehemaligen Reiches nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest rein quantitativ keine geringere Belastung gewesen. Gleichwohl ist die Erinnerung hieran im kollektiven Gedächtnis nicht mehr so präsent, dass dies zu einer rationaleren Debatte führte. Während niemand keine Meinung zum Thema hat und jede politische Partei ihre eigenen Lösungsansätze vertritt, so lassen sich einige Begriffe doch als immer wiederkehrend ausmachen: „Transitzonen“ oder „Einreisezentren“ an den Grenzen werden gefordert, „Hot-Spots“ an neuralgischen Punkten der Zuwanderung eingerichtet, „Auffanglager“ sollen die „Flut“ der Migranten eindämmen und in geregelte Bahnen lenken.
Die vorliegende Arbeit untersucht mehrere Instrumente, welche jeweils einen Teil zur Bewältigung der Krise besteuern sollen: In einem ersten Teil wird der Begriff der sogenannten Transitzonen beleuchtet, welche sich nach Beginn der öffentlichen Diskussion im Jahre 2015 mittlerweile – zumindest teilweise und unter anderen Namen – in § 30a AsylG wiederfinden. Hierbei wird der Vergleich zum Flughafenverfahren nach § 18a AsylG gezogen, die neuen „besonderen Aufnahmeeinrichtungen“ untersucht und die verbleibende Relevanz von weitergehenden Forderungen bewertet. Es folgt eine kurze Erläuterung der Begrifflichkeit der „Hot-Spots“ zu Abgrenzungszwecken. Sodann wird in einem dritten Teil der Begriff der sogenannten Auffanglager behandelt, soweit greifbar in seiner ursprünglich vorgeschlagenen Form problematisiert und dessen Grundidee dann in einem weiteren Schritt zu einem tragfähigeren und nachhaltigeren Mechanismus zur Förderung der legalen und „Bekämpfung“ der illegalen Migration weiterentwickelt. Der Maßstab rechtlicher Bewertungen ist hierbei je nach Problemstellung sowohl das Grundgesetz als auch das Unionsrecht sowie – auszugsweise – das Völkerrecht. Insgesamt soll die Arbeit über den bloßen analytischen Aspekt hinaus einen konstruktiven Beitrag zum Diskurs über den Umgang mit der Flüchtlingskrise leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Transitzonen
- Begriffsbestimung und allgemeinrechtliche Rahmenbedingungen
- Transitzonen sind kein exterritorialer Raum
- Hinkender Vergleich mit dem Missionsgelände nach dem Völkerrecht
- Hoheitsgewalt wird tatsächlich ausgeübt
- Keine Befreiung von der Bindungswirkung der Grundrechte
- Ergebnis zur Exterritorialitätsfrage
- Das Flughafenverfahren gem. § 18a AsylG
- Rechtswidrige Inhaftierung?
- Transitzonen nach Unionsrecht nur an den Außengrenzen?
- Zwischenergebnis zur Definition der Transitzone
- Das beschleunigte Verfahren gem. § 30a AsylG
- Erfasster Personenkreis
- Funktion der Einrichtungen
- Fehlen der Fiktion
- Einreisezentren – (k)ein anderer Ansatz?
- Verbleibende Unterschiede, Zweckmäßigkeit weitergehender Forderungen
- Hot-Spots
- Extraterritoriale Aufnahmeeinrichtungen
- Grundidee: „Auffanglager“
- Allgemeine Probleme des Konzepts
- Asylrecht und Rechtsschutz
- Unmittelbar humanitäre Perspektive
- ,,Auffanglager\" in Nordafrika: Nicht mehr als nur ein Teil der Lösung
- Alternative: Extraterritoriale Aufnahmeeinrichtungen
- Entscheidungsumfang vor Ort: Humanitäre Visa oder Botschaftsverfahren?
- Konsequenz/Verfahren bei Ablehnung
- Effektive Sicherung der Außengrenzen als notwendige Bedingung
- Aufnahmeeinrichtungen auch in Krisenregionen sind essenziell
- Schaffung eines Unionsasylrechts und einer EU-Asylbehörde
- Kooperation mit den Transitstaaten
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Schriftliche Arbeit befasst sich mit der rechtlichen und zweckmäßigen Beurteilung von Transitzonen und extraterritorialen Aufnahmeeinrichtungen im Kontext der aktuellen Flüchtlingskrise. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Verfassungsrechtliche Perspektive, sowie die praktische Anwendung dieser Konzepte. Die Arbeit beleuchtet die Problematik der Exterritorialität und die Einhaltung von Grundrechten in den jeweiligen Kontexten.
- Rechtliche und zweckmäßige Beurteilung von Transitzonen und extraterritorialen Aufnahmeeinrichtungen
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Verfassungsrechtliche Perspektive und Einhaltung von Grundrechten
- Praktische Anwendung und Probleme der Konzepte
- Exterritorialität und ihre Auswirkungen auf das Asylrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Arbeit und stellt die zentralen Fragestellungen vor. Das Kapitel „Transitzonen“ analysiert den Begriff der Transitzone, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die rechtliche Einordnung von Transitzonen im Kontext des Völkerrechts und des Grundgesetzes. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Flughafenverfahren gem. § 18a AsylG und dem beschleunigten Verfahren gem. § 30a AsylG.
Das Kapitel „Hot-Spots“ behandelt die Konzeption und die Problematik von „Hot-Spots“ als Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in den Transitstaaten.
Das Kapitel „Extraterritoriale Aufnahmeeinrichtungen“ befasst sich mit der Idee von „Auffanglagern“ außerhalb des EU-Territoriums. Es beleuchtet die rechtlichen und humanitären Probleme dieser Konzepte und diskutiert verschiedene Alternativen, wie z.B. humanitäre Visa oder Botschaftsverfahren.
Schlüsselwörter
Transitzonen, extraterritoriale Aufnahmeeinrichtungen, Flüchtlingskrise, Asylrecht, Grundrechte, Völkerrecht, EU-Recht, Exterritorialität, Hot-Spots, humanitäre Visa, Botschaftsverfahren, Entscheidungsumfang, Aufnahmeeinrichtungen, Transitstaaten, Grundgesetz, Europäische Menschenrechtskonvention.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Transitzonen im Kontext der Flüchtlingspolitik?
Transitzonen sind Bereiche an Grenzen, in denen Asylverfahren in einem beschleunigten Modus durchgeführt werden, bevor eine offizielle Einreise erfolgt.
Sind Transitzonen völkerrechtlich exterritorialer Raum?
Nein, die Arbeit stellt klar, dass dort tatsächlich Hoheitsgewalt ausgeübt wird und somit eine volle Bindung an die Grundrechte besteht.
Was ist das Flughafenverfahren gemäß § 18a AsylG?
Es ist ein spezielles Verfahren für Personen, die über den Luftweg einreisen und um Asyl bitten, wobei das Verfahren noch im Transitbereich des Flughafens stattfindet.
Was versteht man unter extraterritorialen Aufnahmeeinrichtungen?
Das sind Einrichtungen außerhalb des EU-Territoriums (z.B. in Nordafrika), in denen über Asylanträge oder humanitäre Visa entschieden werden soll.
Welche Rolle spielen "Hot-Spots"?
Hot-Spots sind Registrierungszentren an neuralgischen Punkten der Zuwanderung, die der Erstaufnahme und Identifizierung von Migranten dienen.
- Quote paper
- Jakob Reinecke (Author), 2017, Transitzonen und extraterritoriale Aufnahmeeinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433462