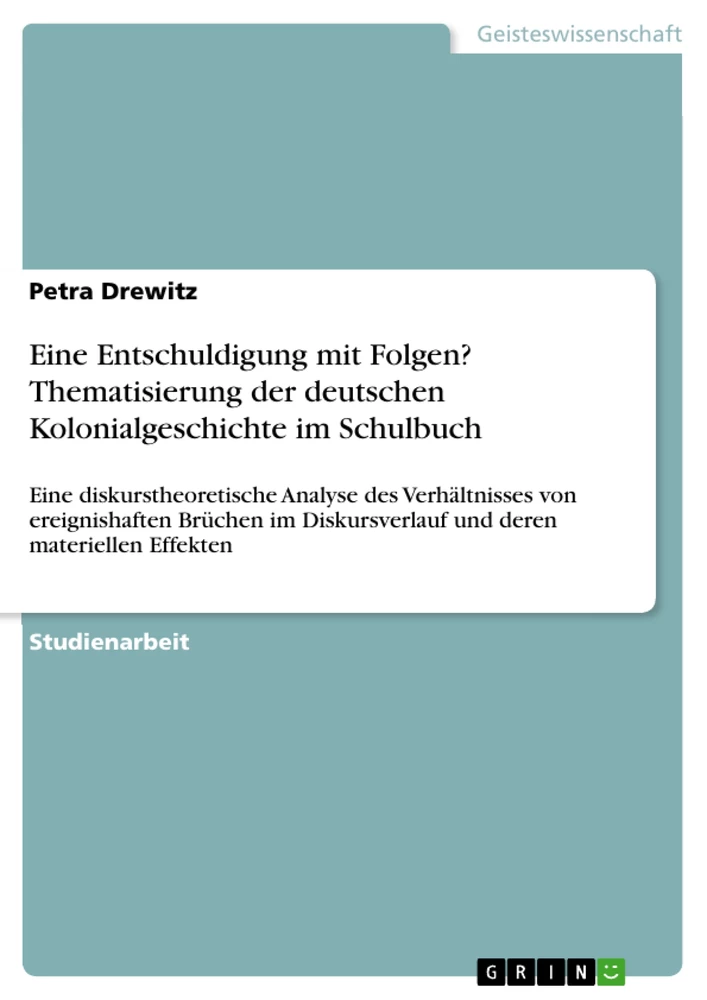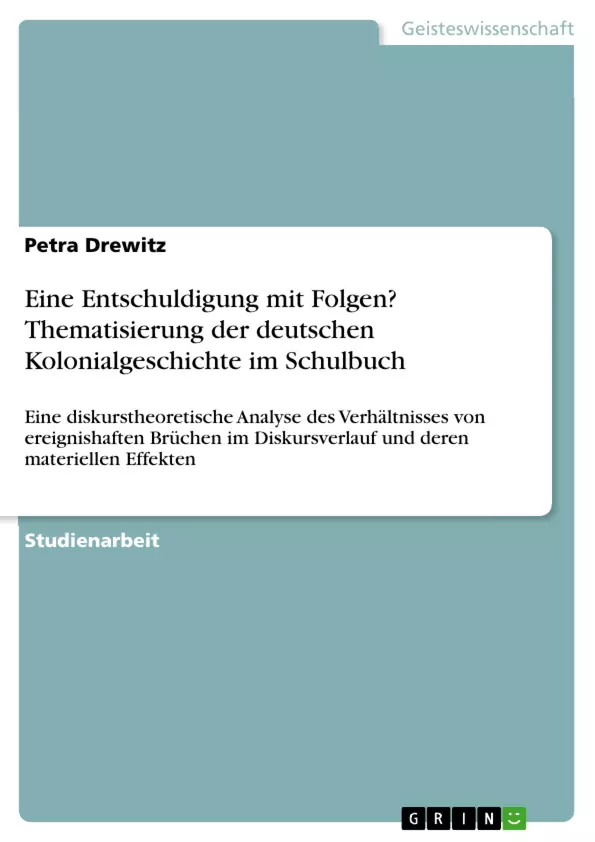Im August 2004 besucht die damalige deutsche Bundesentwicklungsministerin, Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul, die Gedenkfeiern zum 100. Jahrestag der Niederschlagung des Aufstands der Herero und Narma gegen die deutschen Kolonieherren. Bei dieser Gedenkfeier entschuldigte sich die Ministerin als erste Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland bei den Volksgruppen in Namibia für die gewaltsame Niederschlagung des Aufstands und sprach als erste offizielle Vertreterin Deutschlands von einem Völkermord. Infolgedessen ist eine neue Entschuldigungs- und Entschädigungsdebatte in der deutschen Gesellschaft aufgekommen, die zu einer Bedeutungsverschiebung des politischen Diskurses geführt hat.
Diese Arbeit will untersuchen, welche Wirkung die Entschuldigung auf die anderen gesellschaftlichen Teilbereiche hat. Eine Betrachtung aller gesellschaftlichen Teilbereiche würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Beispielhaft wird die Bedeutungsverschiebung des Diskurses im Bereich der Bildung analysiert. Hierzu wird das Schulbuch herangezogen. Schulbücher sind Orte, an denen gesellschaftliche Diskurse rekonstruiert werden. Die Arbeit soll aufzeigen, ob der geänderte gesellschaftliche Diskurs sich auf die Darstellung im Schulbuch auswirkt. Die Fragestellung lautet daher: Welche Wirkung hat ein geänderter gesellschaftlicher Diskurs auf die Darstellung der deutschen Kolonialgeschichte im Schulbuch? Ändert sich der Sprachgebrauch, um die historischen Ereignisse zu beschreiben? Werden andere Bilder oder Quellen genutzt als bisher? Wandelt sich die Darstellung von einer kolonialgefärbten einseitigen, rassistischen Geschichtsbetrachtung zu einer neutralen Sichtweise auf die Ereignisse?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Foucaults Werkzeugkiste
- 2.2 Die Diskursanalyse
- 3. Der Völkermord an den Herero und Nama
- 4. Wissenschaftliche Neuentdeckung der deutschen Kolonialvergangenheit
- 5. Auswirkung der Diskursverschiebung auf die Darstellung im Schulbuch
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wirkung einer öffentlichen Entschuldigung auf die Darstellung der deutschen Kolonialgeschichte im Schulbuch. Sie untersucht, ob und wie der geänderte gesellschaftliche Diskurs, ausgelöst durch die Entschuldigung der deutschen Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul für den Völkermord an den Herero und Nama, in der Darstellung der Kolonialgeschichte in Schulbüchern zum Ausdruck kommt.
- Der Einfluss von Diskursen auf gesellschaftliche Bereiche
- Die Analyse des Diskurskonzepts von Michel Foucault
- Die Darstellung der deutschen Kolonialgeschichte im Schulbuch
- Die Wirkung von Diskursverschiebungen auf die Darstellung historischer Ereignisse
- Die Bedeutung von Schulbüchern als Orte der Rekonstruktion gesellschaftlicher Diskurse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen der Arbeit dar, der im zweiten Kapitel ausführlicher behandelt wird. Hier wird das Diskurskonzept von Michel Foucault vorgestellt und erläutert, wie Macht in Diskursen wirkt. Das dritte Kapitel gibt einen kurzen Einblick in die deutsche Kolonialgeschichte, insbesondere den Völkermord an den Herero und Nama. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit und der Darstellung des Afrikabildes im Schulbuch. Das fünfte Kapitel untersucht, welche Auswirkungen der geänderte gesellschaftliche Diskurs auf die Darstellung der deutschen Kolonialgeschichte im Schulbuch hat.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Diskurs, Macht, Kolonialgeschichte, Schulbuch, Völkermord, Entschuldigung, Diskursanalyse, Foucault, Herero, Nama und Afrikabild.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für die neue Debatte über die deutsche Kolonialgeschichte?
Die Entschuldigung der Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul im Jahr 2004 zum 100. Jahrestag der Niederschlagung des Herero-Aufstands, bei der sie erstmals offiziell von Völkermord sprach.
Wie beeinflusst ein geänderter politischer Diskurs die Schulbücher?
Schulbücher rekonstruieren gesellschaftliche Diskurse. Ein Wandel in der offiziellen Bewertung historischer Ereignisse führt oft zu einer neutraleren oder kritischeren Darstellung statt einer kolonialgefärbten Sichtweise.
Welche Rolle spielt Michel Foucault in dieser Analyse?
Foucaults Diskursanalyse dient als theoretisches Werkzeug, um zu untersuchen, wie Machtverhältnisse und Wissen in gesellschaftlichen Debatten und Texten wie Schulbüchern reproduziert werden.
Was wird am traditionellen „Afrikabild“ in Schulbüchern kritisiert?
Kritisiert wird oft eine einseitige, rassistisch geprägte Darstellung, die die Perspektive der Kolonisierten vernachlässigt und koloniale Gewalt verharmlost.
Wer waren die Herero und Nama?
Es handelt sich um Volksgruppen im heutigen Namibia, die gegen die deutsche Kolonialherrschaft aufbegehrten und Opfer des ersten Völkermords des 20. Jahrhunderts wurden.
- Citar trabajo
- Petra Drewitz (Autor), 2018, Eine Entschuldigung mit Folgen? Thematisierung der deutschen Kolonialgeschichte im Schulbuch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433630