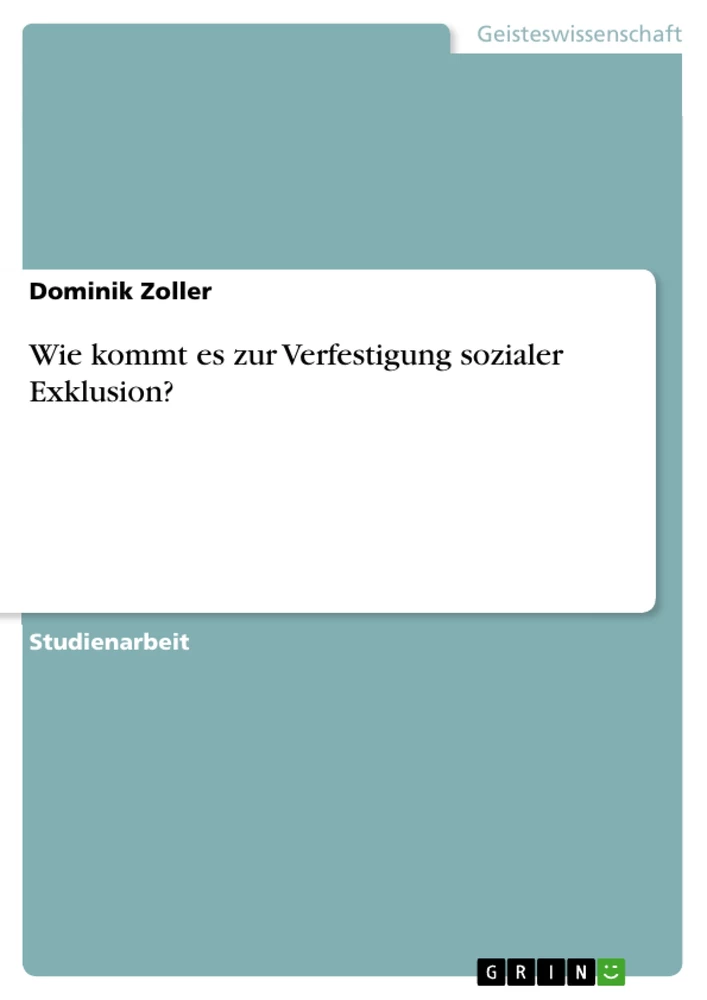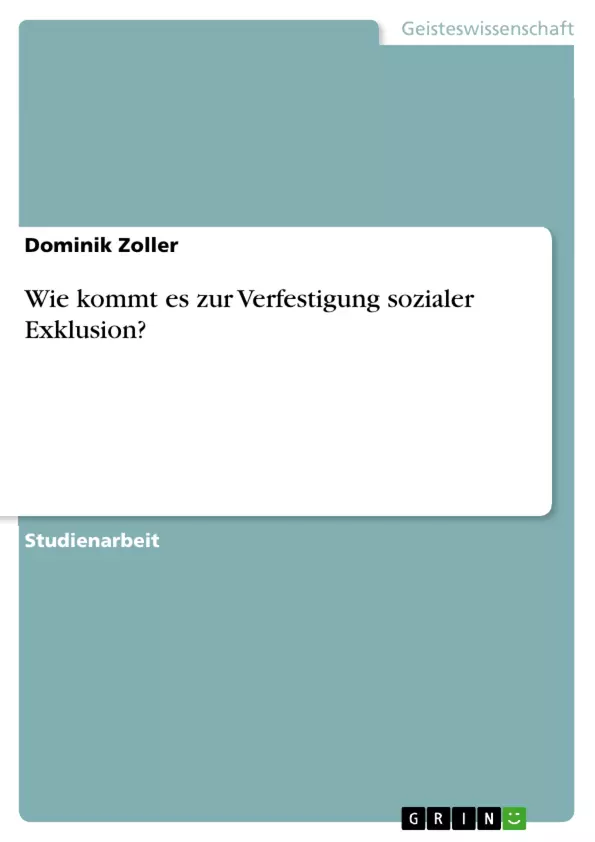Die vorliegende Arbeit setzt sich eingehend mit der Frage auseinander, wie es zur Verfestigung von sozialer Exklusion kommen kann und wie diese Ausgrenzung von den Betroffenen subjektiv wahrgenommen wird, aber auch wie sie objektiv feststellbar und messbar ist. Dabei soll zunächst der Begriff Exklusion definiert und seine gesellschaftliche Bedeutung erläutert werden. Anschließend werden die subjektive und die objektive Exklusion dargestellt. Daran anknüpfend sollen sowohl die Ursachen als auch die Rolle des sozialen Milieus als Faktoren der Verfestigung sozialer Ausgrenzung erläutert werden. Den Abschluss der Arbeit bildet eine kurzen Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte und es soll zudem näher auf die Bedeutung der sozialen Exklusion für die Gesamtgesellschaft und für die Demokratie eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist soziale Exklusion?
- Objektive und subjektive Exklusion
- Objektive Exklusion
- Subjektive Exklusion
- Verfestigung sozialer Exklusion
- Ursachen sozialer Exklusion
- Rolle des sozialen Milieus
- Schluss und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Verfestigung sozialer Exklusion. Sie analysiert die Ursachen und Folgen sozialer Ausgrenzung und untersucht, wie diese von Betroffenen subjektiv wahrgenommen wird. Die Arbeit zielt darauf ab, die objektiven und subjektiven Dimensionen der Exklusion zu beleuchten und die Rolle des sozialen Milieus in diesem Zusammenhang zu untersuchen.
- Definition und gesellschaftliche Bedeutung der sozialen Exklusion
- Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Exklusion
- Ursachen der Verfestigung sozialer Exklusion
- Einfluss des sozialen Milieus auf die soziale Exklusion
- Bedeutung der sozialen Exklusion für die Gesamtgesellschaft und die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor, indem sie von aktuellen Ereignissen ausgeht, die soziale Exklusion veranschaulichen. Sie führt in die Problemstellung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Was ist soziale Exklusion?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "soziale Exklusion". Es untersucht den Ursprung des Begriffs und zeigt verschiedene Definitionsmöglichkeiten auf. Darüber hinaus wird das Modell der Exklusion und Inklusion erläutert, um die Dimensionen der sozialen Exklusion zu veranschaulichen.
- Objektive und subjektive Exklusion: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Formen der sozialen Exklusion, indem es zwischen objektiver und subjektiver Exklusion unterscheidet. Die objektive Exklusion bezieht sich auf messbare Faktoren, während die subjektive Exklusion die individuelle Wahrnehmung der Exklusion beschreibt.
- Verfestigung sozialer Exklusion: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen der Verfestigung sozialer Exklusion. Es analysiert Faktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit und Diskriminierung und beleuchtet die Rolle des sozialen Milieus in diesem Zusammenhang.
Schlüsselwörter
Soziale Exklusion, objektive Exklusion, subjektive Exklusion, Verfestigung sozialer Exklusion, Ursachen sozialer Exklusion, Rolle des sozialen Milieus, Partizipation, gesellschaftliche Auflösungsphänomene, Armut, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Exklusion?
Objektive Exklusion bezieht sich auf messbare Faktoren wie Einkommen oder Arbeitsstatus, während subjektive Exklusion die individuelle Wahrnehmung der Ausgrenzung beschreibt.
Wie verfestigt sich soziale Exklusion?
Die Verfestigung erfolgt durch ein Zusammenspiel von Armut, Langzeitarbeitslosigkeit, Diskriminierung und der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Milieus.
Welche Rolle spielt das soziale Milieu bei der Ausgrenzung?
Das soziale Milieu kann als Barriere wirken, die den Zugang zu Ressourcen und Teilhabechancen erschwert und so die Exklusion stabilisiert.
Warum ist soziale Exklusion eine Gefahr für die Demokratie?
Exklusion führt zu einem Rückzug aus der politischen Partizipation und gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ist soziale Exklusion dasselbe wie Armut?
Nein, Armut ist oft eine Ursache, aber Exklusion umfasst weit mehr Dimensionen wie den Ausschluss von Bildung, Kultur und sozialen Netzwerken.
- Quote paper
- Dominik Zoller (Author), 2017, Wie kommt es zur Verfestigung sozialer Exklusion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433792