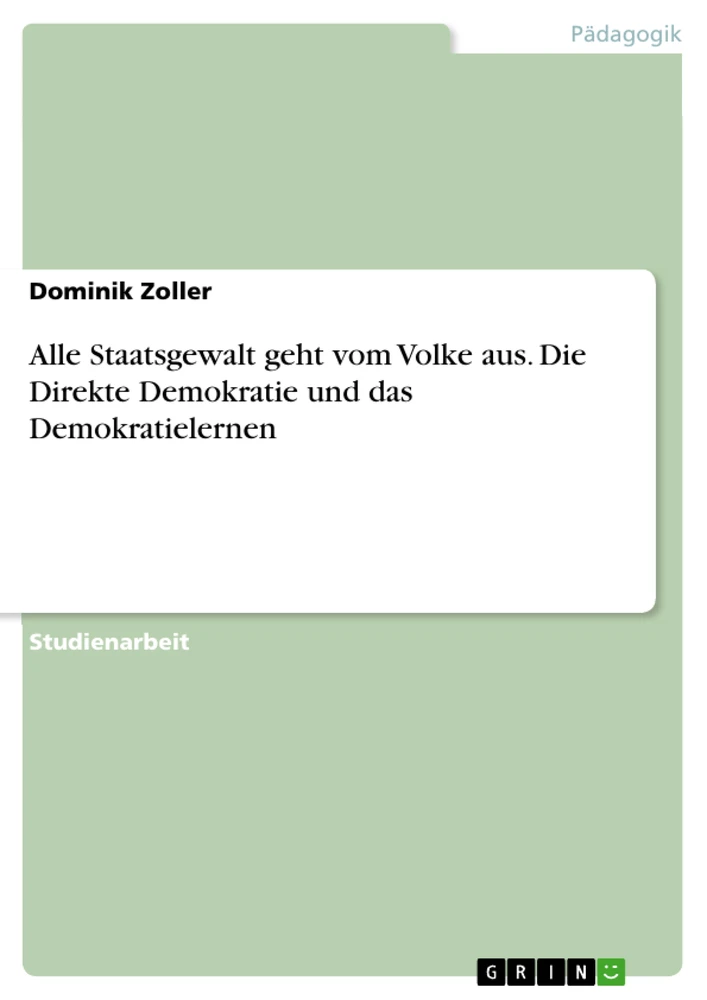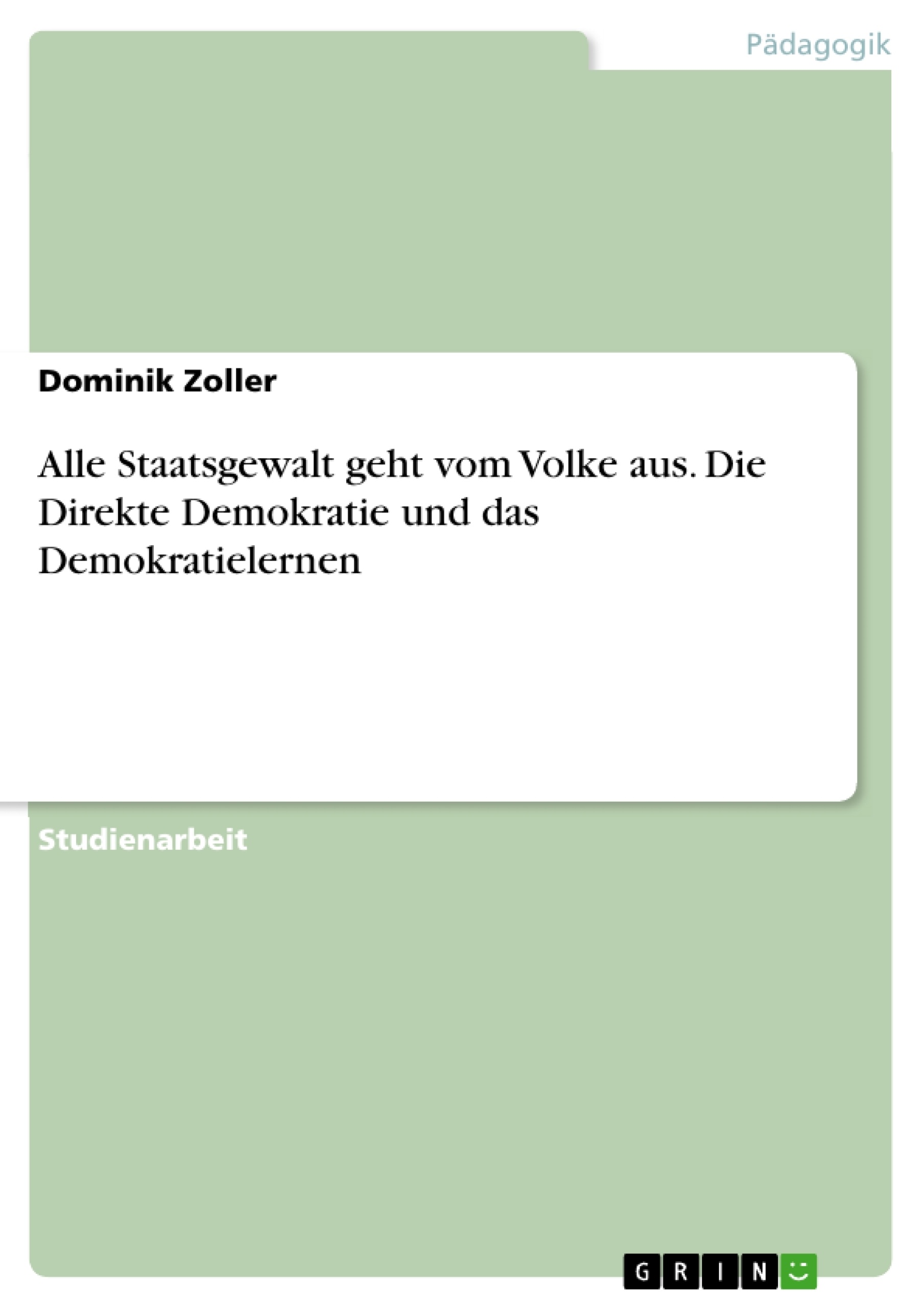Was ist die Direkte Demokratie ist und wie unterscheidet sie sich von der Repräsentativen Demokratie? Und warum können Forderungen nach dem Einsatz direkt-demokratischer Mittel auf Bundesebene - also die unmittelbare Herrschaft des Volkes über die Länderebene hinaus - als Vertrauensbeweis in die Wählerinnen und Wähler gelten, wie es Die Grünen ausdrückten - und damit einhergehend, warum gibt es in Deutschland die Möglichkeit zu Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden nicht auch auf Bundesebene?
Die Klärung dieser Fragen ist Thema der vorliegenden Arbeit. Dazu soll zunächst auf den Beginn der politischen Ideengeschichte der Direkten Demokratie anhand von Jean-Jacques Rousseau eingegangen werden. Anschließend werden die deutschen Erfahrungen mit dieser Form der Demokratie in der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und den daraus resultierenden Folgen für das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland thematisiert. Damit können die Vorbehalte gegenüber der Direkten Demokratie in Deutschland umfassend beantwortet werden.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dann dem Demokratielernen als einem wichtigen Bestandteil der politischen Bildung. Im Anschluss werden Gedanken Rousseaus über die Erziehung zum Menschen und zum Staatsbürger dargestellt und ein historischer Einblick in das Demokratielernen anhand der politischen Bildung und Erziehung in der Weimarer Republik und der national-sozialistischen Erziehungsideologie sowie der Re-Education-Politik nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Daran schließt sich die Vorstellung einiger Methoden zur unterrichtlichen Umsetzung an. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung der genannten Aspekte und es wird auf einige Vorteile der direkten Demokratie eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rousseau und die Direkte Demokratie
- 2.1 Der Einzelwillen und der Allgemeinwillen
- 2.2 Lehre von der Souveränität
- 3. Deutsche Erfahrungen mit der Direkten Demokratie
- 3.1 Weimarer Republik
- 3.1.1 Die direkte Demokratie in der Weimarer Verfassung
- 3.1.2 Volksbegehren und Volksentscheide in der Weimarer Republik
- 3.2 Nationalsozialismus
- 3.3 Auswirkungen auf das Grundgesetz
- 3.1 Weimarer Republik
- 4. Demokratielernen als wichtiger Bestandteil der politischen Bildung
- 5. Unterrichtliche Umsetzung des Demokratielernens
- 5.1 Sachanalyse
- 5.2 Didaktische Analyse
- 5.3 Bezug zum Lehrplan
- 6. Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Direkte Demokratie, ihre theoretischen Grundlagen bei Rousseau und ihre praktische Anwendung in Deutschland. Sie beleuchtet die Rolle der direkten Demokratie in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus und analysiert die daraus resultierenden Auswirkungen auf das deutsche Grundgesetz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des Demokratielernens in der politischen Bildung.
- Die theoretischen Grundlagen der direkten Demokratie nach Rousseau
- Die Geschichte der direkten Demokratie in Deutschland
- Die Auswirkungen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus auf die deutsche Demokratie
- Demokratielernen in der politischen Bildung
- Methoden der unterrichtlichen Umsetzung des Demokratielernens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Debatte um die Stärkung direkter Demokratieelemente in der deutschen Bundespolitik, wie sie in den Wahlprogrammen verschiedener Parteien zum Ausdruck kommt. Sie führt die zentrale Forschungsfrage ein: Warum gibt es in Deutschland keine bundesweiten Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide, obwohl diese von Parteien als Vertrauensbeweis in die Wählerschaft gesehen werden? Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die methodische Vorgehensweise, die von Rousseau über die deutschen Erfahrungen mit direkter Demokratie bis hin zum Demokratielernen in der politischen Bildung reicht.
2. Rousseau und die Direkte Demokratie: Dieses Kapitel analysiert Rousseaus Konzept des Gesellschaftsvertrags und die Unterscheidung zwischen Einzelwillen und Allgemeinwillen. Es beleuchtet Rousseaus Lehre von der Volkssouveränität und seine Ablehnung einer repräsentativen Demokratie, was ihn zu einem zentralen Theoretiker der direkten Demokratie macht. Die Diskussion von Rousseaus Werk "Du contrat social" bildet die theoretische Grundlage für das Verständnis der direkten Demokratie im weiteren Verlauf der Arbeit.
3. Deutsche Erfahrungen mit der Direkten Demokratie: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der direkten Demokratie in verschiedenen Phasen der deutschen Geschichte. Es analysiert die Erfahrungen in der Weimarer Republik, inklusive der rechtlichen Grundlagen und der Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden. Der Abschnitt über den Nationalsozialismus zeigt, wie die direkte Demokratie instrumentalisiert und missbraucht werden kann. Schließlich werden die langfristigen Folgen dieser historischen Erfahrungen für das Grundgesetz und die heutige politische Kultur Deutschlands diskutiert, und wie diese die Zurückhaltung gegenüber bundesweiten Initiativen beeinflusst haben könnten.
4. Demokratielernen als wichtiger Bestandteil der politischen Bildung: Dieses Kapitel widmet sich der Bedeutung des Demokratielernens als essentieller Bestandteil politischer Bildung. Es argumentiert, dass ein tiefes Verständnis der direkten Demokratie für die aktive Teilhabe an demokratischen Prozessen unerlässlich ist. Der Abschnitt legt dar, warum das Verständnis und die praktische Anwendung der direkten Demokratie für die Stärkung und den Erhalt einer funktionierenden Demokratie essentiell sind. Es werden die Implikationen für die politische Bildung und die Förderung von Bürgerengagement herausgearbeitet.
5. Unterrichtliche Umsetzung des Demokratielernens: Dieses Kapitel präsentiert methodische Ansätze zur unterrichtlichen Umsetzung des Demokratielernens. Es beinhaltet eine Sachanalyse, eine didaktische Analyse und einen Bezug zum Lehrplan. Es wird auf konkrete didaktische Methoden eingegangen, die ein vertieftes Verständnis der direkten Demokratie ermöglichen und die aktive Beteiligung der Schüler fördern. Das Kapitel liefert konkrete Beispiele und Anregungen für den Unterricht, die die theoretischen Überlegungen praktisch umsetzen.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Rousseau, Gesellschaftsvertrag, Allgemeinwille, Einzelwille, Volkssouveränität, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Grundgesetz, Demokratielernen, Politische Bildung, Bürgerbeteiligung, Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiative.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Direkte Demokratie in Deutschland"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die direkte Demokratie, ihre theoretischen Grundlagen bei Rousseau und ihre praktische Anwendung in Deutschland. Sie beleuchtet die Rolle der direkten Demokratie in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus und analysiert die daraus resultierenden Auswirkungen auf das deutsche Grundgesetz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des Demokratielernens in der politischen Bildung und der methodischen Umsetzung im Unterricht.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Rousseaus Theorie der direkten Demokratie (Gesellschaftsvertrag, Allgemeinwille, Volkssouveränität), die Geschichte der direkten Demokratie in Deutschland (Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Grundgesetz), die Bedeutung des Demokratielernens in der politischen Bildung, sowie methodische Ansätze zur unterrichtlichen Umsetzung des Demokratielernens (Sachanalyse, Didaktische Analyse, Lehrplanbezug).
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum gibt es in Deutschland keine bundesweiten Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide, obwohl diese von Parteien als Vertrauensbeweis in die Wählerschaft gesehen werden?
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Rousseau und die Direkte Demokratie, Deutsche Erfahrungen mit der Direkten Demokratie, Demokratielernen als wichtiger Bestandteil der politischen Bildung, Unterrichtliche Umsetzung des Demokratielernens und Zusammenfassung/Schluss. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte.
Welche Rolle spielt Rousseau in der Arbeit?
Rousseau's Konzept des Gesellschaftsvertrags und die Unterscheidung zwischen Einzelwillen und Allgemeinwillen bilden die theoretische Grundlage der Arbeit. Seine Lehre von der Volkssouveränität und seine Ablehnung einer repräsentativen Demokratie werden analysiert.
Wie werden die deutschen Erfahrungen mit der direkten Demokratie dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Erfahrungen der Weimarer Republik (rechtliche Grundlagen, Volksbegehren, Volksentscheide), den Missbrauch der direkten Demokratie im Nationalsozialismus und die langfristigen Folgen für das Grundgesetz und die heutige politische Kultur Deutschlands.
Welche Bedeutung hat Demokratielernen in der politischen Bildung?
Die Arbeit betont die essentielle Bedeutung des Demokratielernens für die aktive Teilhabe an demokratischen Prozessen und die Stärkung und den Erhalt einer funktionierenden Demokratie. Sie arbeitet die Implikationen für die politische Bildung und die Förderung von Bürgerengagement heraus.
Wie wird die unterrichtliche Umsetzung des Demokratielernens behandelt?
Das Kapitel zur unterrichtlichen Umsetzung bietet methodische Ansätze, eine Sachanalyse, eine didaktische Analyse und einen Bezug zum Lehrplan. Es enthält konkrete didaktische Methoden, Beispiele und Anregungen für den Unterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Rousseau, Gesellschaftsvertrag, Allgemeinwille, Einzelwille, Volkssouveränität, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Grundgesetz, Demokratielernen, Politische Bildung, Bürgerbeteiligung, Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiative.
- Citation du texte
- Dominik Zoller (Auteur), 2018, Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Direkte Demokratie und das Demokratielernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433795