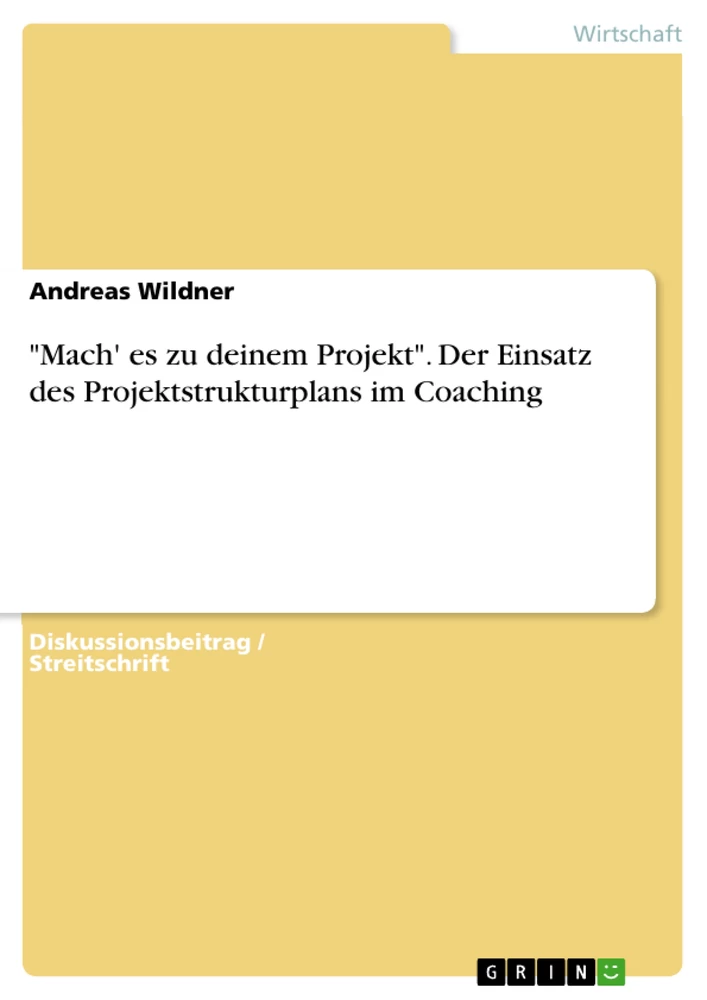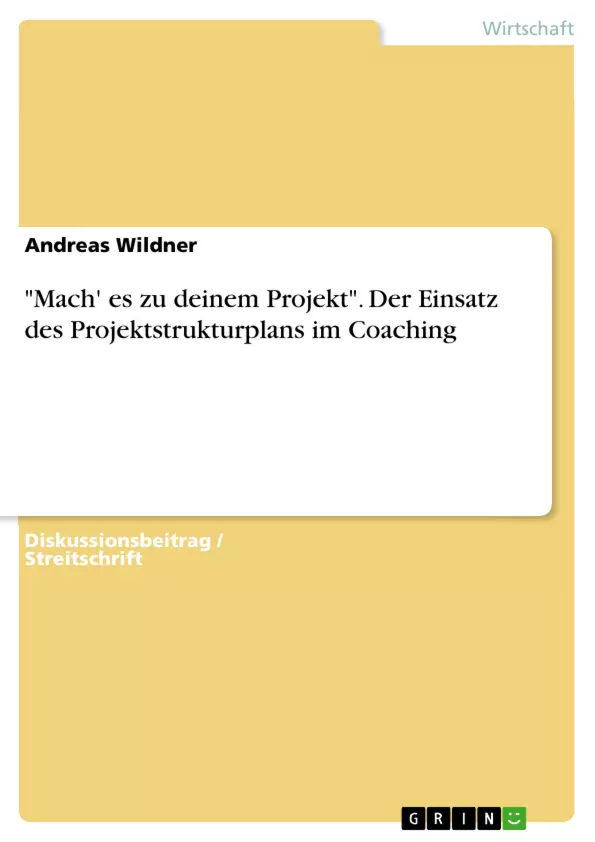Ziel dieser Arbeit ist es, den Projektstrukturplan hinsichtlich seiner Anwendbarkeit für das Coaching zu untersuchen. Die systemische Beratung folgt dem personenzentrierten Ansatz nach Carl Rodgers und ist durch Elemente des Hypnosystemischen angereichert worden. Der Projektstrukturplan ist als Methode im Projektmanagement bekannt und kommt bisher ausschließlich im klassischen Projektumfeld zum Einsatz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Fragestellung
- 3. Hintergrund
- 4. Bedingungen für die Geeignetheit von Methoden im personenzentrierten-hypnosystemischen Coaching
- 4.1 Aufstellungsarbeit von sozialen Beziehungen im Coaching
- 4.2 Bedingungen für nachhaltiges Selbstmanagement im personenzentrierten Coaching (Rodgers, Sparrer, von Kibèd)
- 4.3 Bedingungen für nachhaltiges Selbstmanagement in der Time-Line-Therapy (James, Woodsmall, Bandler)
- 5. Der Projektstrukturplan in der Praxis
- 5.1 Die Arbeit mit dem Projektstrukturplan im Projektmanagement
- 5.2 Die Arbeit mit dem Projektstrukturplan im Coaching
- 6. Reflexion
- 7. Konklusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Projektstrukturplans im Coaching. Sie analysiert die funktionale Differenzierung zwischen klassischer Beratung und personenzentriert-hypnosystemischem Coaching und prüft, unter welchen Bedingungen der Projektstrukturplan im Coaching-Kontext eingesetzt werden kann. Die empirische Überprüfung basiert auf den praktischen Erfahrungen des Autors als systemischer Coach und Veränderungsmanager.
- Anwendbarkeit des Projektstrukturplans im Coaching
- Funktionale Differenzierung zwischen klassischer Beratung und Coaching
- Bedingungen für den Einsatz des Projektstrukturplans im Coaching
- Theoretische Herleitung und empirische Überprüfung der Bedingungen
- Kritische Reflexion des Projektstrukturplans als Coaching-Tool
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar. Sie beginnt mit dem bekannten Werbeslogan „Mach´ es zu deinem Projekt“ und verknüpft ihn mit dem im Coaching häufig anzutreffenden Bedürfnis nach Strukturierung bei Klienten. Der Projektstrukturplan wird als potenzielles Hilfsmittel vorgestellt, wobei die Arbeit die Anwendbarkeit im Coaching kontextualisiert und als Forschungsfrage etabliert. Die Einleitung dient der Begründung der Relevanz des Themas und skizziert den weiteren Verlauf der Arbeit.
2. Fragestellung: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage: die Anwendbarkeit des Projektstrukturplans im Coaching. Es stellt zwei Thesen auf: These 1 postuliert die Undenkbarkeit des Einsatzes aufgrund funktionaler Unterschiede, während These 2 die Möglichkeit des Einsatzes unter bestimmten Bedingungen annimmt. Diese Thesen strukturieren die Argumentationslinie der gesamten Arbeit und liefern den roten Faden für die folgenden Kapitel.
3. Hintergrund: Dieses Kapitel beschreibt den Projektstrukturplan als Instrument des Projektmanagements, seine Funktionen (Terminplanung, Ressourcenallokation, Priorisierung) und seine Bedeutung in der Projektplanung und -steuerung. Es hebt den Unterschied zwischen der rationalen Planung und der Berücksichtigung menschlicher Faktoren hervor, die im Projektmanagement als Risiko wahrgenommen werden. Der Abschnitt dient als theoretische Grundlage für den Vergleich mit den Prinzipien des personenzentrierten Coachings.
4. Bedingungen für die Geeignetheit von Methoden im personenzentrierten-hypnosystemischen Coaching: Dieses Kapitel befasst sich mit den Bedingungen für den Erfolg von Coaching-Methoden und diskutiert den Unterschied zwischen den Ansätzen im Projektmanagement und Coaching. Es stellt die Frage nach der Vereinbarkeit von strukturierten Vorgehensweisen wie dem Projektstrukturplan mit den Prinzipien der personenzentrierten und hypnosystemischen Ansätze. Die Unterkapitel betrachten spezifische Methoden und ihre Voraussetzungen für nachhaltiges Selbstmanagement.
5. Der Projektstrukturplan in der Praxis: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Anwendung des Projektstrukturplans sowohl im Projektmanagement als auch im Coaching. Es analysiert den Unterschied in der Anwendung, und erörtert die Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Anwendung im Coaching. Es stellt die Brücke zwischen der Theorie und den empirischen Erfahrungen des Autors her.
Schlüsselwörter
Projektstrukturplan, Coaching, Selbstmanagement, personenzentrierter Ansatz, hypnosystemisches Coaching, Projektmanagement, funktionale Differenzierung, empirische Überprüfung, Ressourcen, Zielerreichung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anwendbarkeit des Projektstrukturplans im Coaching
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Projektstrukturplans im personenzentriert-hypnosystemischen Coaching. Sie analysiert die Unterschiede zwischen klassischer Beratung und Coaching und prüft, unter welchen Bedingungen der Projektstrukturplan im Coaching-Kontext sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Untersuchung basiert auf den praktischen Erfahrungen des Autors.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Unter welchen Bedingungen ist der Projektstrukturplan im Coaching anwendbar? Es werden zwei gegensätzliche Thesen aufgestellt: These 1 verneint die Anwendbarkeit aufgrund funktionaler Unterschiede, These 2 bejaht sie unter bestimmten Bedingungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anwendbarkeit des Projektstrukturplans im Coaching, die funktionale Differenzierung zwischen klassischer Beratung und Coaching, die Bedingungen für den Einsatz des Projektstrukturplans im Coaching, die theoretische Herleitung und empirische Überprüfung dieser Bedingungen sowie eine kritische Reflexion des Projektstrukturplans als Coaching-Tool. Sie beinhaltet auch eine detaillierte Betrachtung verschiedener Coaching-Methoden und deren Voraussetzungen für nachhaltiges Selbstmanagement.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Fragestellung, Hintergrund, Bedingungen für die Geeignetheit von Methoden im personenzentrierten-hypnosystemischen Coaching, Der Projektstrukturplan in der Praxis, Reflexion und Konklusion. Jedes Kapitel bearbeitet einen Aspekt der Forschungsfrage und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Welche Methoden werden im Kontext der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Projektstrukturplan als Methode des Projektmanagements und analysiert dessen Anwendbarkeit im personenzentrierten und hypnosystemischen Coaching. Spezifisch werden Aufstellungsarbeit sozialer Beziehungen, Methoden nach Rodgers, Sparrer und von Kibèd sowie die Time-Line-Therapy nach James, Woodsmall und Bandler im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem Projektstrukturplan untersucht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht im bereitgestellten Textzusammenfassung enthalten und müssten aus dem vollständigen Dokument entnommen werden.) Die Konklusion fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Anwendbarkeit des Projektstrukturplans im Coaching Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Projektstrukturplan, Coaching, Selbstmanagement, personenzentrierter Ansatz, hypnosystemisches Coaching, Projektmanagement, funktionale Differenzierung, empirische Überprüfung, Ressourcen, Zielerreichung.
Auf welcher Grundlage basiert die empirische Überprüfung?
Die empirische Überprüfung basiert auf den praktischen Erfahrungen des Autors als systemischer Coach und Veränderungsmanager.
Wie wird der Projektstrukturplan im Coaching kontextualisiert?
Die Arbeit vergleicht den rationalen Ansatz des Projektstrukturplans aus dem Projektmanagement mit den Prinzipien des personenzentrierten und hypnosystemischen Coachings, um die Herausforderungen und Möglichkeiten der Anwendung im Coaching-Kontext zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Andreas Wildner (Autor:in), 2018, "Mach' es zu deinem Projekt". Der Einsatz des Projektstrukturplans im Coaching, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434086