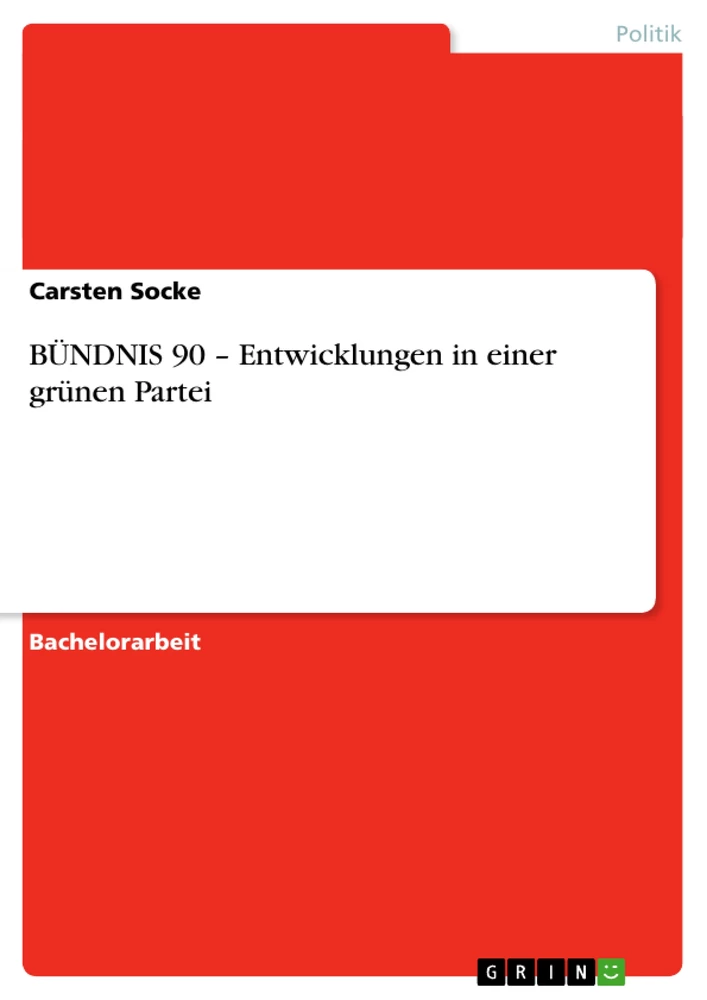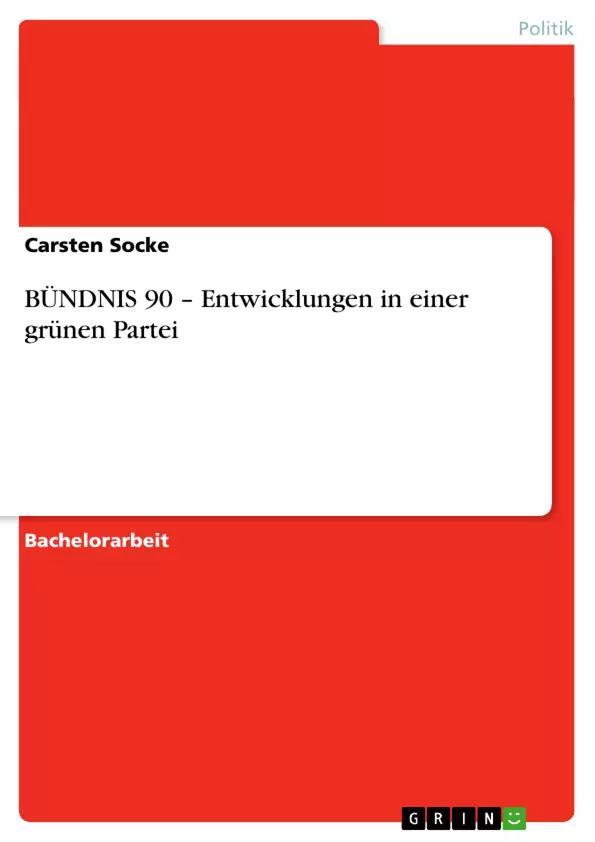Der Zusammenbruch der DDR hat Deutschland, mit der deutsch-deutschen Vereinigung vor fünfzehn Jahren, vor eine enorme Herausforderung gestellt. Diese Vereinigung war allumfassend politisch, ökonomisch, gesellschaftlich und machte natürlich auch vor dem Parteiensystem nicht halt. Schnell übernahmen die etablierten Parteien des Westens die Führungsrolle im politischen Meinungsbildungsprozess, der in der Praxis bald ähnlich ablief, wie dies im „Referenzsystem Bundesrepublik“ der Fall war.
Abgeschlossen wurde dieser Prozess mit der Vereinigung von Bündnis 90 und den Grünen im Jahre 1993. Dabei sollte es sich, im Gegensatz zu den anderen Ost-West-Parteivereinigungen, nicht um eine bloße Übernahme des Ost-Partners handeln, sondern eine Vereinigung zweier gleichberechtigter Parteien stattfinden. Alle anderen westdeutschen Parteien hatten sich bereits vor der Wiedervereinigung mit ihrem ostdeutschen Pendant vereinigt, und waren schon zur ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 gemeinsam angetreten. Erst einen Tag später haben sich die Grünen mit ihrer ostdeutschen „Schwesterpartei“ vereinigt. Man vollzog also in knapp drei Jahren gleich zwei Vereinigungen mit ostdeutschen Parteien. Jürgen Hoffmann spricht in diesem Zusammenhang auch von der „doppelten Vereinigung“. Zudem waren die Grünen die einzigen, die bereit waren, ihren Namen im Verlauf des Vereinigungsprozesses zu ändern.
Die Ausgangssituation, die sich den Grünen in Ostdeutschland Anfang der Neunziger bot, schien viel versprechend. Schließlich bestand das Bündnis 90 personell aus einer Vielzahl von Aktivisten der Bürgerbewegung, die bei der ostdeutschen Bevölkerung ein hohes Ansehen besaßen, so dass man sich eine sichere Wählerschicht im Osten erhoffte. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Vereinigung aus Bündnis 90, den Grünen und den Ost-Grünen als ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches, gleichberechtigtes Zusammengehen von Ost und West zu werten ist.
In wie weit dieser erste Eindruck richtig oder falsch ist, soll sich im Verlauf dieser Arbeit klären. Sind Bündnis 90/Die Grünen wirklich die Verschmelzung zweier gleichberechtigter Partner, oder ist das Bündnis 90 zwölf Jahre nach der Fusion in Wirklichkeit nicht nur noch Teil des Namens und innerparteilich abgemeldet?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Forschungsstand
- 2. Entstehung und Entwicklung der Grünen in der BRD.
- 2.1. Ursprung außerparlamentarische Opposition der Siebziger
- 2.2. Gründung der Partei „Die Grünen“
- 2.3. 1980 - 1989 turbulente grüne Jahre.
- 2.4. „Burgfrieden“ der Neunziger
- 3. Entstehung und Entwicklung des Bündnis 90,
- 3.1. DDR-Opposition als Keimzelle.
- 3.2. Der revolutionäre Herbst 1989
- 3.3. Bündnis 90 - von der Bewegung zur Partei.
- 3.3.1. Wahlbündnisse als erste Schritte zur Partei
- 3.3.2. Vom Wahlbündnis zur Bundespartei
- 4. Der Zusammenschluss zum Bündnis 90/Die Grünen...........
- 4.1. Zusammenschluss als einzige Option.
- 4.2. Meinungsverschiedenheiten im Verhandlungsprozess
- 4.2.1. Weltanschauliche Differenzen
- 4.2.2. Inhaltliche Differenzen
- 4.2.3. Verhältnis zwischen Bündnis 90 und Ost-Grünen
- 4.2.4. Widerstand im Bündnis 90.
- 4.3. Verhandlungsergebnisse und Assoziationsvertrag...
- 4.3.1. Grundkonsens
- 5. Bündnis 90 als Teil von Bündnis 90/Die Grünen.....
- 5.1. Schneller Einflussverlust des Bündnis 90
- 5.2. Zurück zu grünen Werten.
- 5.3. Mangel an profilierten Persönlichkeiten
- 6. Bündnis 90/Die Grünen in Ostdeutschland..
- 6.1. Mitgliederzahlen.
- 6.2. Wahlergebnisse der Grünen in Ostdeutschland..
- 6.3. Gründe der Erfolglosigkeit im Osten.
- 6.3.1. Fehlen der traditionellen Wählerschichten im Osten
- 6.3.2. PDS als Konkurrenz
- 6.3.3. Falsche Themensetzung..
- 6.4. Sind die Grünen eine Regionalpartei des Westens?.
- 7. Resümee & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung und den Zusammenschluss von Bündnis 90 und den Grünen zu Bündnis 90/Die Grünen im Kontext der deutschen Wiedervereinigung. Sie analysiert die unterschiedlichen Entstehungsgeschichten der beiden Parteien sowie die Herausforderungen des Vereinigungsprozesses. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Rolle von Bündnis 90 innerhalb der Gesamtpartei und untersucht die Erfolge und Schwierigkeiten der Grünen in Ostdeutschland.
- Entwicklung von Bündnis 90 und den Grünen vor dem Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung
- Herausforderungen und Chancen des Zusammenschlusses von Bündnis 90 und den Grünen
- Rolle von Bündnis 90 innerhalb der Gesamtpartei Bündnis 90/Die Grünen
- Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Grünen in Ostdeutschland
- Analyse der Entwicklung der Partei im Osten und ihre Positionierung im politischen System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und den Forschungsstand. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Grünen in der Bundesrepublik Deutschland, während Kapitel 3 die Entwicklung von Bündnis 90 in der DDR und die Herausforderungen des Übergangs von einer Bewegung zu einer Partei beschreibt. Kapitel 4 analysiert den Zusammenschluss der beiden Parteien und die damit verbundenen Herausforderungen. Kapitel 5 untersucht den Einflussverlust von Bündnis 90 nach der Fusion. Kapitel 6 widmet sich der Entwicklung der Partei in Ostdeutschland und analysiert die Gründe für die Schwierigkeiten der Grünen in dieser Region. Die Arbeit endet mit einem Resümee und einem Ausblick.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Bündnis 90, Die Grünen, deutsche Wiedervereinigung, Parteiensystem, Ost-West-Vereinigung, Wahlbündnisse, Mitgliederzahlen, Wahlergebnisse, politische Entwicklung, Ostdeutschland, politische Kultur, Identität, Parteiprogramm, Grundkonsens, Integration, Herausforderungen, Erfolgsfaktoren, Wählerstimmen, Parteipolitik, politisches System, Politische Ökologie, Umweltpolitik, Sozialpolitik, Friedenspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand die Partei Bündnis 90/Die Grünen?
Sie entstand 1993 durch die Vereinigung der westdeutschen Grünen mit der ostdeutschen Bürgerbewegung Bündnis 90.
Was versteht man unter der „doppelten Vereinigung“?
Jürgen Hoffmann beschreibt damit, dass die Grünen innerhalb kurzer Zeit zwei Fusionen vollzogen: erst mit den Ost-Grünen und dann mit dem Bündnis 90.
War die Fusion eine Vereinigung gleichberechtigter Partner?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Bündnis 90 heute noch Einfluss hat oder ob es lediglich ein Namensbestandteil ohne innerparteiliches Gewicht ist.
Warum sind die Grünen in Ostdeutschland weniger erfolgreich?
Gründe sind das Fehlen traditioneller Wählerschichten, die starke Konkurrenz durch die PDS (heute Die Linke) und eine oft als falsch wahrgenommene Themensetzung.
Wer war die Keimzelle des Bündnis 90?
Die Keimzelle war die DDR-Opposition und die Bürgerbewegungen des revolutionären Herbstes 1989.
- Quote paper
- Carsten Socke (Author), 2005, BÜNDNIS 90 – Entwicklungen in einer grünen Partei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43414