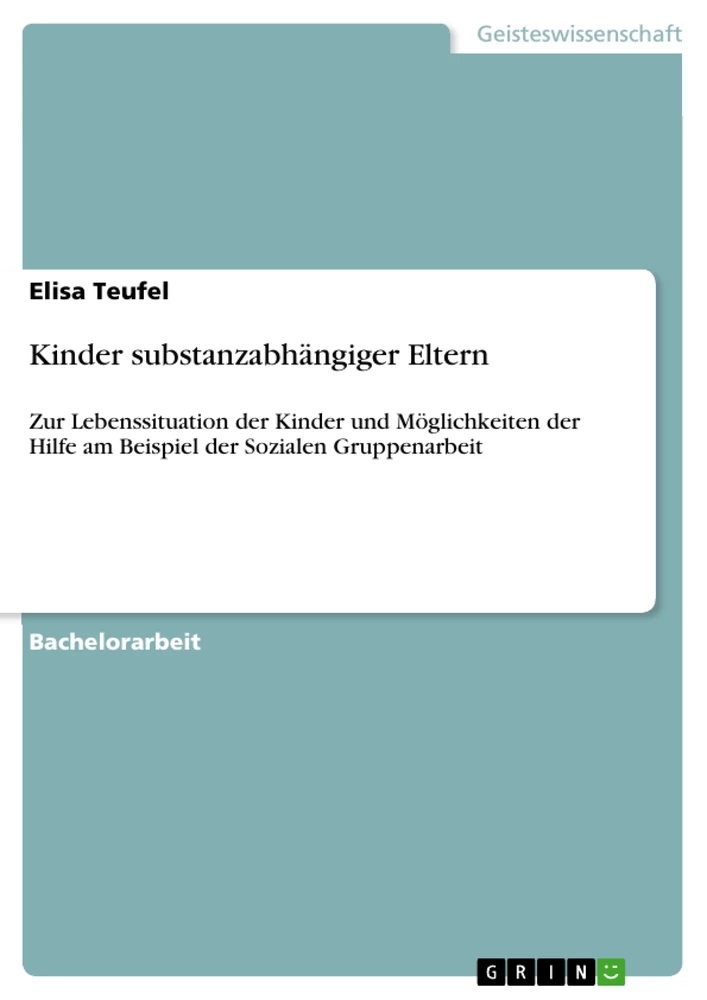Die Frage die in dieser Bachelorarbeit bearbeitet wurde lautet: "Welche Auswirkungen hat die elterliche Substanzabhängigkeit auf deren Kinder in Bezug auf eine eigene Abhängigkeitsentwicklung und wie kann die Soziale Arbeit dort präventiv tätig sein?" Laut Michael Klein leben in Deutschland 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr zeitweise oder die gesamte Kindheit in einer abhängigkeitsbelasteten Familie aufgewachsen sind. Diese Zahl lässt erkennen, dass Sucht ein gesamtgesellschaftlichen Problem darstellt, das nur durch die gesamte Gesellschaft gelöst werden kann. Neben den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit muss sich auch die Wirtschaft, Politik, Familie, Schule und jeder Einzelne mit diesem Thema beschäftigen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Sozialwissenschaften und soziokulturellen Bedingungen als auch mit psychologischen und neurobiologischen Komponenten. Neben substanzbezogenen Grundlagen bedarf es auch der Erläuterung des Familienbegriffs. Um die Zusammenhänge der Belastung von Kindern Substanzabhängiger zu verstehen, wird über interne Familienregeln, das Familiensystem und das Erziehungsverhalten informiert. Fachliche Grundlagen sind die Themen der Bindung und der Entwicklungspsychologie. Im Kapitel 3.4 geht es anschließend um die Risiko- und Schutzfaktoren des Kindes und der Umwelt, die in den folgenden Kapiteln näher ausgeführt werden. Im vierten Hauptgliederungspunkt geht es um die Rolle der Sozialen Arbeit und der konkreten Hilfemöglichkeiten. Im Anhang befindet sich ein ausgearbeitetes Konzept einer Sozialen Gruppe für Kinder Substanzabhängiger.
Es handelt sich hierbei um eine Bachelorarbeit der Fakultät Soziale Arbeit und wurde getreu den Hochschulstandards erstellt. Das Ergebnis dieser Arbeit beruht auf einer ausführlichen Literaturrecherche. Alle Quellen sind ordnungsgemäß angegeben und im Literaturverzeichnis ausführlich aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erkenntnisinteresse
- Wissenschaftliche Relevanz
- Politische Aktualität
- Definitionen
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Substanzbezogene Störungen am Beispiel Alkohol
- Epidemiologie
- Entstehungsbedingungen einer Abhängigkeit
- Die Droge
- Das Sozialfeld
- Das Individuum
- Verlauf einer Alkoholabhängigkeit
- Auswirkungen einer Alkoholabhängigkeit
- Familie
- Der Familienbegriff
- Familienregeln
- Familiensystem
- Erziehungsverhalten
- Bindung
- Entwicklungspsychologie
- Kinder substanzabhängiger Eltern
- Zahlen und Fakten
- Familiensituation
- Kontrollparameter
- Risiko- und Schutzfaktoren bei der Aufklärung einer erhöhten Abhängigkeitsgefährdung
- Kindbezogene Risikofaktoren (Vulnerabilität)
- Biologische Erklärungsansätze/ genetische Risikofaktoren
- Umgebungsbezogene Risikofaktoren (Stressoren)
- Kindbezogene Schutzfaktoren (Resilienz)
- Umgebungsbezogene Schutzfaktoren (Soziale Unterstützung)
- Auswirkungen auf das Kind/Entwicklungsprognose des Kindes
- Anpassungsbestrebungen/Anstrengungen zur Belastungsbewältigung
- Auswirkungen auf die Zukunft
- Die Rolle der Sozialen Arbeit und ihre Hilfemöglichkeiten
- Hilfen für Kinder substanzabhängiger Eltern
- Theoretische Bezugswissenschaften
- Zuständigkeiten innerhalb der Sozialen Arbeit
- Grundsätze der Präventionsarbeit
- Soziale Gruppenarbeit
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Zielgruppe
- Eckdaten
- Methoden
- Zielsetzung
- Rahmenbedingungen
- Elternarbeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Lebenssituation von Kindern substanzabhängiger Eltern und den Möglichkeiten der Hilfe durch die Soziale Gruppenarbeit. Ziel ist es, die Auswirkungen elterlicher Substanzabhängigkeit auf die Kinder hinsichtlich einer eigenen Abhängigkeitsentwicklung zu beleuchten und zu analysieren, wie die Soziale Arbeit präventiv eingreifen kann.
- Die Auswirkungen elterlicher Substanzabhängigkeit auf die Entwicklung des Kindes
- Die Rolle von Risiko- und Schutzfaktoren für die Abhängigkeitsentwicklung bei Kindern
- Die Bedeutung der sozialen Unterstützungssysteme für Kinder substanzabhängiger Eltern
- Die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit, Kinder substanzabhängiger Eltern zu unterstützen
- Die Besonderheiten der Sozialen Gruppenarbeit im Kontext der Präventionsarbeit für Kinder substanzabhängiger Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Erkenntnisinteresse der Arbeit vor und erläutert die wissenschaftliche Relevanz des Themas. Sie beleuchtet die politische Aktualität und definiert wichtige Begriffe. Außerdem wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich den Grundlagen, indem es zunächst die Substanzbezogene Störung am Beispiel von Alkohol betrachtet. Hier werden epidemiologische Daten, Entstehung, Verlauf und Auswirkungen einer Alkoholabhängigkeit beleuchtet. Anschließend wird der Familienbegriff und seine Relevanz für die Arbeit mit Kindern substanzabhängiger Eltern erläutert.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Situation von Kindern substanzabhängiger Eltern. Es beleuchtet Zahlen und Fakten zur Verbreitung des Phänomens und beschreibt die spezifischen Herausforderungen der Familiensituation. Neben der Analyse von Kontrollparametern werden Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung einer Abhängigkeit bei Kindern substanzabhängiger Eltern untersucht.
Schlüsselwörter
Kinder substanzabhängiger Eltern, Suchtprävention, Soziale Gruppenarbeit, Abhängigkeitsentwicklung, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Familie, Entwicklungspsychologie, Soziale Arbeit, Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kinder in Deutschland leben in Familien mit Suchtproblemen?
Schätzungen zufolge leben rund 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche zeitweise oder dauerhaft in einer abhängigkeitsbelasteten Familie.
Welche Risikofaktoren gibt es für Kinder substanzabhängiger Eltern?
Zu den Risikofaktoren zählen genetische Veranlagung, gestörtes Erziehungsverhalten, instabile Bindungen und umgebungsbezogene Stressoren.
Was ist Resilienz im Kontext von Suchtfamilien?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern, die es ihnen ermöglicht, sich trotz der belastenden Situation gesund zu entwickeln.
Wie kann Soziale Gruppenarbeit helfen?
Sie bietet Kindern einen geschützten Raum für Austausch, stärkt soziale Kompetenzen und hilft bei der Bewältigung der familiären Belastung.
Warum ist Elternarbeit in der Suchtprävention wichtig?
Elternarbeit ist notwendig, um das Familiensystem langfristig zu stabilisieren und die Erziehungskompetenz der Eltern trotz ihrer Erkrankung zu fördern.
- Citar trabajo
- Elisa Teufel (Autor), 2012, Kinder substanzabhängiger Eltern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434370