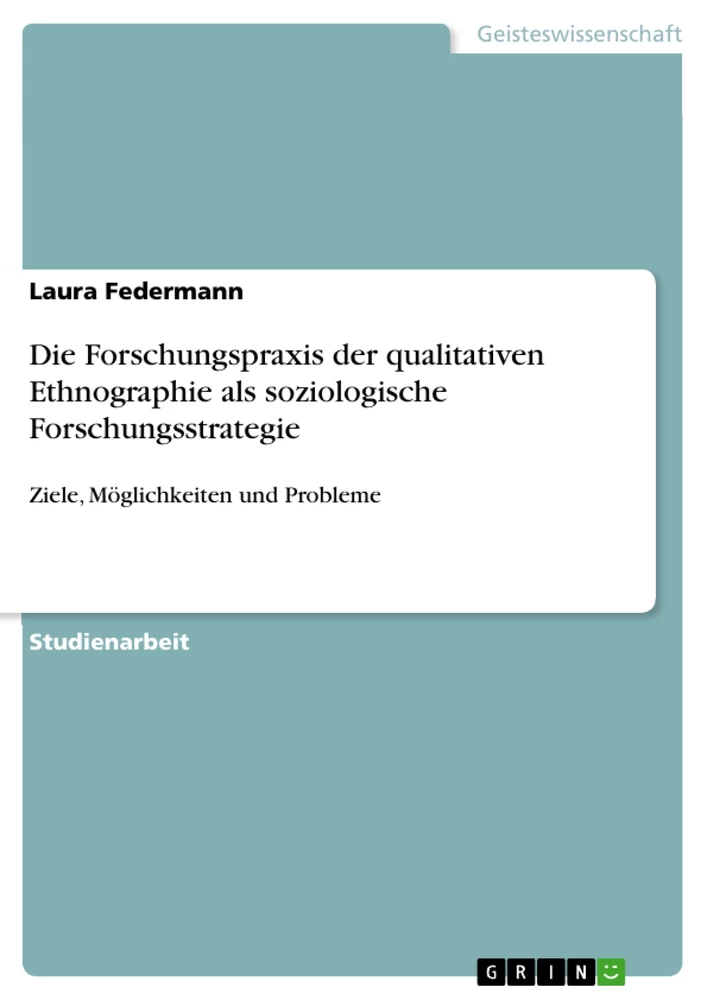Ethnographische Forschung wird vor allem in den Bereichen der Soziologie, der Ethnologie und der Erziehungswissenschaft genutzt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Ethnographie als soziologische Forschungsstrategie.
In Abgrenzung zur ethnologischen Ethnographie, die sich der Erforschung fremder Kulturen widmet, wird die soziologische Ethnographie in der eigenen Gesellschaft durchgeführt. Die Nähe zum Feld beziehungsweise das Integriert sein in die zu erforschende (sub)kulturelle Lebenswelt, wie sie in der modernen Ethnographie praktiziert wird, liegt einer langjährigen Entwicklung zugrunde. Aufgrund globaler Veränderungen und Entwicklungen in Richtung einer komplexeren, vielgeschichteten Gesellschaft kommt es zunehmend zu Differenzierung, Individualisierung oder dem Streben nach Identitätsbildung durch verschiedene Lebensstile. Diese Ausbildungen zu untersuchen und der Allgemeinheit zugänglich zu machen, ist Aufgabe der Ethnographie, wodurch sie für die Wissenschaft immer stärker an Bedeutung gewinnt. Dies zeigt sich an einer Zunahme ethnographischer Studien in den letzten Jahren.
Diese Arbeit thematisiert die methodische Praxis der soziologischen Ethnographie, als eine durch Ambivalenzen bestimmte Forschungsstrategie. Zunächst soll der Begriff der soziologischen Ethnographie in Abgrenzung zu verwandten Forschungsstrategien betrachtet werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die praktische Umsetzung ausgeführt und Probleme, mit denen die Ethnograph/innen konfrontiert werden aber auch Chancen, die sich ihnen bieten erörtert mit dem Ziel Aufschluss darüber zu geben, welche Ziele ethnographische Forschung verfolgt, welche Möglichkeiten sie bietet und inwiefern Probleme in ethnographischen Forschungsprozessen auftreten können. Darauf folgt der abschließende Versuch, die Bedeutung der Forschungsstrategie in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile, herauszustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ethnographie-eine Begriffserklärung
- 3. Methoden der Ethnographie
- 3.1 Der Feldzugang
- 3.2 Datengewinnung
- 3.2.1 teilnehmende Beobachtung
- 3.2.2 Verfremdung
- 4. Schwierigkeiten und Probleme
- 4.1 Schwierigkeiten in der Einstiegsphase
- 4.2 Schwierigkeiten in der Phase der Datengewinnung
- 4.3 Die Kritik der mangelnden Kontrollierbarkeit
- 5. Chancen und Möglichkeiten
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziologische Ethnographie als Forschungsstrategie. Im Fokus steht die methodische Praxis, inklusive der Herausforderungen und Chancen dieser ambivalenten Methode. Die Arbeit beleuchtet den Begriff der soziologischen Ethnographie im Vergleich zu verwandten Forschungsansätzen und erörtert die praktische Umsetzung, die damit verbundenen Probleme und die sich bietenden Möglichkeiten. Ziel ist es, Aufschluss über die Ziele, Möglichkeiten und Probleme ethnographischer Forschung zu geben und deren Bedeutung im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu herausstellen.
- Abgrenzung der soziologischen Ethnographie von verwandten Forschungsansätzen
- Methodische Herausforderungen des Feldzugangs und der Datenerhebung
- Probleme und Schwierigkeiten in ethnographischen Forschungsprozessen
- Chancen und Möglichkeiten ethnographischer Forschung
- Bedeutung der Ethnographie im gesamtgesellschaftlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der soziologischen Ethnographie ein und hebt deren Bedeutung in den Sozialwissenschaften hervor. Im Gegensatz zur ethnologischen Ethnographie, die sich mit fremden Kulturen befasst, konzentriert sich die soziologische Ethnographie auf die eigene Gesellschaft. Die zunehmende Komplexität und Differenzierung der Gesellschaft erhöht die Relevanz ethnographischer Forschung zur Untersuchung verschiedener Lebensstile und Identitätsbildungsprozesse. Die Arbeit skizziert ihren weiteren Aufbau und die zentralen Forschungsfragen.
2. Ethnographie-eine Begriffserklärung: Dieses Kapitel differenziert den Begriff "Ethnographie" von verwandten Begriffen wie Ethnologie, Ethnomethodologie und Ethnosoziologie. Es erläutert die Bedeutung von "Ethos" und "Ethnie" im Kontext der Ethnographie und betont das umfassende, wertungsfreie Untersuchen von Menschen in verschiedenen Lebenswelten. Der naturalistische Charakter der Forschung und die Bedeutung des "Forschens ohne Vorurteile" werden hervorgehoben. Der Begriff der "Feldforschung" wird eingeführt und der Gegensatz zu künstlichen Forschungssettings verdeutlicht.
3. Methoden der Ethnographie: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Ansätze der Ethnographie. Der Fokus liegt auf dem Feldzugang, einer der größten Herausforderungen der ethnographischen Forschung. Es wird erläutert, wie Forscher Zugang zu ihrem Forschungsfeld gewinnen und welche Voraussetzungen und Möglichkeiten dafür existieren. Die Bedeutung der Bereitschaft der beteiligten Personen, ihr Feld zu öffnen, wird betont. Das Kapitel beschreibt den zweistufigen Zugang (Anpassungsfähigkeit und Teilnehmerrolle) und erläutert Möglichkeiten, wie z.B. durch vorgeschobene Gründe (Goffmann), den Zugang zu erleichtern.
4. Schwierigkeiten und Probleme: Dieses Kapitel thematisiert die Herausforderungen und Probleme, denen Ethnographen während ihrer Forschung begegnen. Es werden Schwierigkeiten in der Einstiegsphase, der Datenerhebung und die Kritik an der mangelnden Kontrollierbarkeit ethnographischer Forschung diskutiert. Die Kapitel beleuchten die komplexen Herausforderungen, die ein tiefergehendes Verständnis der untersuchten sozialen Welt erfordern.
5. Chancen und Möglichkeiten: Dieses Kapitel widmet sich den Chancen und Möglichkeiten ethnographischer Forschung. Es beleuchtet den Mehrwert dieses Forschungsansatzes und argumentiert für dessen Relevanz in der heutigen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Ethnographie, Soziologische Ethnographie, Feldforschung, qualitative Forschung, teilnehmende Beobachtung, methodische Herausforderungen, Datengewinnung, gesellschaftliche Relevanz, Lebensstile, Identitätsbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur soziologischen Ethnographie
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über die soziologische Ethnographie. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der methodischen Praxis der Ethnographie, einschließlich der Herausforderungen und Chancen dieser Forschungsmethode.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text untersucht die soziologische Ethnographie als Forschungsstrategie. Ziel ist es, Aufschluss über die Ziele, Möglichkeiten und Probleme ethnographischer Forschung zu geben und deren Bedeutung im gesamtgesellschaftlichen Kontext herauszustellen. Dabei werden die methodischen Herausforderungen, die Probleme und die Chancen dieser ambivalenten Methode beleuchtet.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Abgrenzung der soziologischen Ethnographie von verwandten Forschungsansätzen, die methodischen Herausforderungen des Feldzugangs und der Datenerhebung, Probleme und Schwierigkeiten in ethnographischen Forschungsprozessen, die Chancen und Möglichkeiten ethnographischer Forschung und deren Bedeutung im gesamtgesellschaftlichen Kontext.
Welche Methoden der Ethnographie werden beschrieben?
Der Text beschreibt den Feldzugang als eine der größten Herausforderungen und erläutert, wie Forscher Zugang zu ihrem Forschungsfeld gewinnen. Die Bedeutung der teilnehmenden Beobachtung wird hervorgehoben, ebenso wie Methoden zur Erleichterung des Zugangs, z.B. durch vorgeschobene Gründe (Goffmann). Weitere Methoden der Datengewinnung werden angesprochen, wie z.B. die Verfremdung.
Welche Schwierigkeiten und Probleme werden im Zusammenhang mit ethnographischer Forschung genannt?
Der Text thematisiert Schwierigkeiten in der Einstiegsphase, der Datenerhebung und die Kritik an der mangelnden Kontrollierbarkeit ethnographischer Forschung. Die komplexen Herausforderungen, die ein tiefergehendes Verständnis der untersuchten sozialen Welt erfordern, werden beleuchtet.
Welche Chancen und Möglichkeiten bietet die ethnographische Forschung?
Der Text hebt den Mehrwert des ethnographischen Forschungsansatzes hervor und argumentiert für dessen Relevanz in der heutigen Gesellschaft. Er betont die Bedeutung der Ethnographie für das Verständnis verschiedener Lebensstile und Identitätsbildungsprozesse in einer zunehmend komplexen Gesellschaft.
Wie grenzt sich die soziologische Ethnographie von verwandten Forschungsansätzen ab?
Der Text differenziert den Begriff "Ethnographie" von verwandten Begriffen wie Ethnologie, Ethnomethodologie und Ethnosoziologie. Er betont den Fokus der soziologischen Ethnographie auf die eigene Gesellschaft im Gegensatz zur ethnologischen Ethnographie, die sich mit fremden Kulturen beschäftigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Ethnographie, Soziologische Ethnographie, Feldforschung, qualitative Forschung, teilnehmende Beobachtung, methodische Herausforderungen, Datengewinnung, gesellschaftliche Relevanz, Lebensstile, Identitätsbildung.
- Citar trabajo
- Laura Federmann (Autor), 2018, Die Forschungspraxis der qualitativen Ethnographie als soziologische Forschungsstrategie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434728